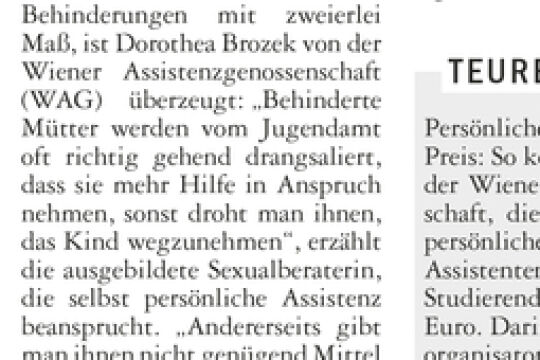Eine leitende Sozialarbeiterin beschreibt die diffizile Arbeit des Wiener Jugendamtes - und sieht keinen wesentlichen Reformbedarf. von regine bogensberger
Sobald ein tragischer Fall von Kindesverwahrlosung bekannt wird, hagelt es Kritik am Jugendamt. Doch wie arbeitet die Jugendwohlfahrt, was sind ihre Befugnisse und wo sehen die Sozialarbeiter der Behörde Reformbedarf?
Der von Familienministerin Andrea Kdolsky angekündigte Ausbau eines Frühwarnsystems zur besseren Prävention solch tragischer Fälle stößt im Jugendamt Wien auf wenig Verständnis. "Es gibt ein Frühwarnsystem und es wird auch genützt", sagt Gabriele Ziering, leitende Sozialarbeiterin im Amt für Jugend und Familie der Stadt Wien. Ziering bezweifelt, dass es notwendig ist, bei jeder Abmeldung eines Kindes zur Heimbeschulung sofort das Jugendamt einzuschalten, wie Kdolsky angeregt hatte. Es gebe bereits jetzt ein gutes Netz sozialer Dienstleistungen, um Familien zu erreichen; angefangen von Schwangerenberatung über das Wäschepakt bei jedem neuen Baby bis hin zur Arbeit in den zahlreichen Eltern-Kind-Zentren der Stadt. Auch der Mutter-Kind-Pass hat sich laut Ziering als gute Präventionsmaßnahme bewährt. Aber selbst wenn ein Sozialarbeiter jeden Tag in eine Familie käme, ließe sich eine Straftat - etwa ein Mord oder schwere Gewalt - nicht verhindern.
"Irrtümer sind selten"
Die Arbeit des Jugendamtes beginnt meist mit einer Meldung über eine mögliche Gefährdung eines Kindes. Ein Lehrer, ein Nachbar, ein Familienmitglied, eine anonyme Person oder die Polizei melden sich beim Jugendamt. "Jeder dieser Meldungen muss nachgegangen werden", betont Ziering. Entweder wird sofort ein unangekündigter Hausbesuch gemacht, oder man holt weitere Informationen von Schule und Kindergarten ein, oder man lädt die Familie zu einem Gespräch ein. "Es kommt immer auf den Inhalt dieser Meldung an", erklärt Ziering vom MAG ELF.
Das Jugendamt arbeite mit festgeschriebenen Standards, die auch ständig evaluiert würden, erklärt Ziering die Vorgehensweise: Es arbeiten immer zwei Sozialarbeiterinnen an einem Fall, die im ständigen Austausch mit der leitenden Sozialarbeiterin stehen. Es muss immer das Kind gesehen und gesprochen werden, sofern es schon sprechen kann. Kinder bis drei Jahre müssen einem Kinderarzt vorgestellt werden. Bei Kindern bis sechs Jahren ist ein Hausbesuch verpflichtend, um das Umfeld genau beurteilen zu können. Wird eine Gefahr festgestellt, wird gemeinsam mit der Familie eine schriftlich festgehaltene Vereinbarung getroffen, wie die Situation verbessert werden kann. Es gibt etwa die Möglichkeit zu Therapie oder Familienhilfe. Wird keine Gefahr festgestellt, ist der Fall meist beendet. "In vielen Fällen reicht das Gespräch während des Abklärungsverfahrens schon aus, um die Eltern zu einer Veränderung anzuregen", sagt Gabriele Ziering.
Doch, was ist, wenn sich die Gefährdung des Kindes beim ersten Besuch nur nicht klar dargestellt hat? Ziering ist sich sicher, dass die Sozialarbeiterinnen sehr gut geschult seien und ein Gespür dafür hätten, was sich in einer Familie wirklich abspiele. "Wenn man beim ersten Mal nichts Besonderes sieht und dann wieder eine Meldung kommt, dass die Wohnung total verdreckt ist, dann geht man wieder hin. Dann heißt das aber auch, dass in der Zwischenzeit etwas passiert sein muss." Aber was ist, wenn die Eltern sich rausreden und sagen, sie seien krank gewesen und nur deshalb sehe es zur Zeit so aus? "Dann vereinbaren wir, dass wir in ein paar Tagen wieder kommen und behalten die Familie im Auge." Irrtümer seien selten. "Ich irre mich nicht, wenn ich blaue Flecken am Kind sehe. Man kann das sehr wohl unterscheiden, ob das vom Spielen oder von Gewalt kommt", betont die langjährige Sozialarbeiterin. Zudem könne man in unklaren Situationen auch einen Kinderarzt oder Psychologen zu Rate ziehen. Wenn eine Meldung kommt und die Situation sei uneindeutig, dann gehe man öfter in die Familie, zudem berate man sich ständig mit der Leiterin und mit Kollegen.
Im Jahr 2006 wurden 11.529 Aufklärungsverfahren durchgeführt, 2001 waren es 5277 (siehe Info-Box). "Die Gesellschaft ist heute viel eher bereit, eine Gefährdung zu melden. Sie ist sensibilisierter, was Verwahrlosung betrifft. Zudem hat sich die Ansicht über den Erziehungsstil geändert", erklärt Ziering den großen Zuwachs. Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit habe sich das Image verbessert. Die Sozialarbeiter von heute würden als Unterstützung wahrgenommen, ist sich Ziering sicher.
Dennoch gibt es immer wieder schlimme Fälle, wo das Kind "bei Gefahr in Verzug" aus der Familie herausgenommen werden muss. "Solche Entscheidungen, bei denen massiv in das Leben von Kindern eingegriffen werden muss, sind immer eine Gratwanderung", betont sie. "Es muss immer die Frage gestellt werden, ob man das Kind durch das Rausnehmen aus der Familie noch mehr traumatisiert als durch die Situation zu Hause. Zum Glück kriegt man die meisten Fälle durch ambulante Hilfe wieder ins Lot."
Wird ein Kind aus der Familie genommen, stehen in Wien zwölf Krisenzentren mit 112 Plätzen zu Verfügung. Diese sind meist ausgelastet. Babys und Kleinkinder kommen in Krisenpflegefamilien und bleiben dort vorerst acht Wochen. Ältere Kinder bleiben vorerst sechs Wochen im Krisenzentrum. In dieser Zeit gibt es regelmäßige Gespräche zwischen Sozialarbeiter und Eltern. "Ziel ist es immer, die Situation so zu verändern, dass das Kind wieder in die Familie zurück kann", erklärt Ziering. Der überwiegende Großteil der Kinder dürfe auch wieder nach Hause. Nur bei Babys sei die Rückkehr oft schwieriger, da die Pflegeeltern zu primären Bezugspersonen geworden seien. Aber auch hier gebe es weiterhin Besuchskontakte.
Gabriele Ziering vom Wiener Jugendamt sieht keinen unmittelbaren Reformbedarf ihrer Behörde. "Im Grunde haben wir relativ gute Möglichkeiten", sagt sie. Sie warnt vor strengeren Gesetzen, die Eltern stärker bevormunden würden. Ziering glaubt auch nicht, dass die Oberösterreichischen Kollegen im Fall um die drei verwahrlosten Mädchen etwas falsch gemacht hätten. Das Jugendamt dürfe erst einschreiten, wenn Gefahr in Verzug sei. Alles andere wäre ein Missbrauch dieser Macht. "Wir müssen per Gesetz immer die gelindesten Mittel anwenden." Eine gravierende Personalknappheit sieht sie nicht; obwohl bei gleich gebliebener Beschäftigungszahl die Zahl von Aufklärungsverfahren rasant angestiegen ist. Das Jugendamt beschäftigt zirka 1600 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter.
Verbesserungen von Nöten
Dringenden und grundsätzlichen Reformbedarf des Jugendamtes sieht hingegen der Sozialwissenschafter Peter Pantucek: "In erster Linie geht es um eine Neupositionierung der Jugendämter als gesellschaftlich aktive Einrichtungen in regem Kontakt zur Zivilgesellschaft." Pantucek, früher selbst im Wiener Jugendamt tätig und heute Professor für Sozialwissenschaft an der Fachhochschule in St. Pölten, kritisiert, dass es kaum eine Diskussion in Österreich darüber gebe, wie das Jugendamt verbessert werden könne. Es gebe kaum Forschung auf diesem Gebiet, internationale Entwicklungen würden ignoriert.
"Die Jugendämter sind personell dürftig besetzt und in vielen Bundesländern als Teil der Bezirksverwaltungsbehörden einer behördlichen Logik untergeordnet, die unflexibel macht und die Präsenz vor Ort erschwert." Da die Jugendämter in allen Bundesländern unterschiedlich organisiert sind, rät Pantucek zu einer "bundesweiten Jugendwohlfahrtsbehörde, die Forschung, fachlichen Diskurs und Politikentwicklung fördert und finanziert." Es müssten auch verstärkt nichtstaatliche Sozialträger eingebunden werden, kritisiert der Experte für Sozialarbeit die "Monopolisierung" der Jugendwohlfahrt etwa in Wien.