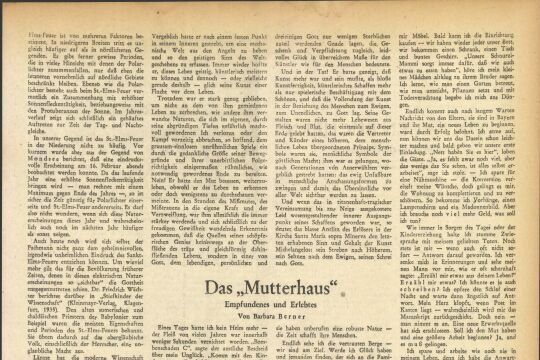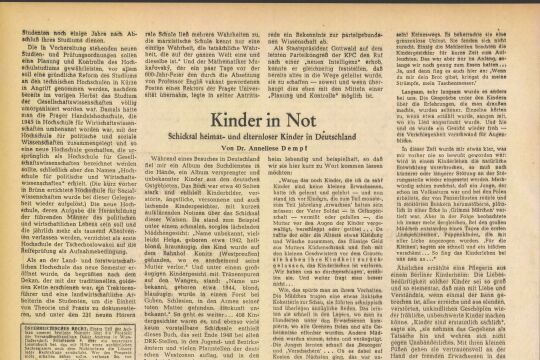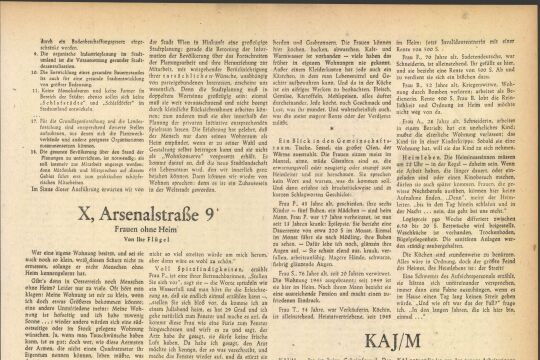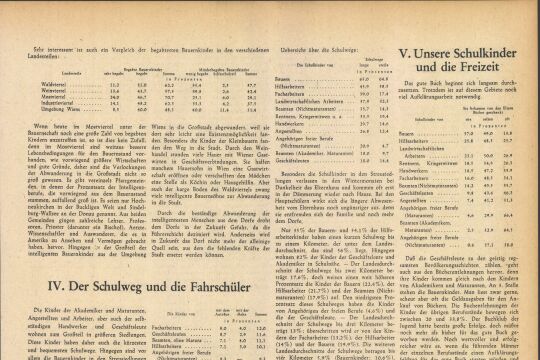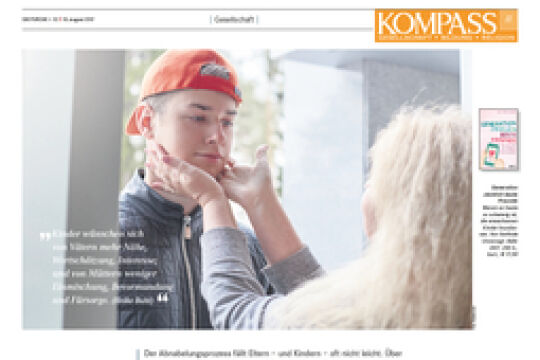Die Armut hat bereits eine Million Moldawier ins Ausland getrieben. Zurück bleiben die Alten - und zehntausende Kinder, die ohne Eltern aufwachsen. Aus Österreich finanzierte Sozialprojekte versuchen ihren Alltag lebenswerter zu machen.
W o ihre Mutter ist, weiß Tatjana nicht. Vor zwölf Jahren ist die verschwunden, seitdem hat sie nie wieder von ihr gehört. Damals war Tatjana acht Jahre alt und kam ins Waisenhaus von Chisinau. Heute ist sie 20, eine ernste junge Frau, und selbst Mutter. Ihre Tochter Anna feiert bald ihren ersten Geburtstag. "Sie soll es einmal besser haben als ich“, sagt Tatjana. "Es ist nicht leicht für mich, aber ich tue alles, um eine gute Mutter zu sein.“
Und das heißt für sie auch: Bei ihrer Tochter bleiben. Dass Kinder bei ihren Eltern aufwachsen, ist in Moldau keine Selbstverständlichkeit. Die Armut zwingt viele Eltern, zum Arbeiten ins Ausland zu gehen. Russland, Kanada oder Italien sind die begehrtesten Ziele. Eine Million Menschen, fast ein Viertel der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, hat das Land schon verlassen. Bis zu einer Milliarde Dollar, ein Fünftel des BIP, überweisen die Auswanderer jedes Jahr in die Heimat. Doch das hat seinen Preis: Zurück bleiben Kinder, die bei entfernten Verwandten oder Großeltern mit winzigen Pensionen aufwachsen. Rund 35.000 Sozialwaisen leben ohne Eltern in Moldau. "Drama der Verlassenheit“ nennt Caritas-Präsident Franz Küberl dieses Schicksal, das eine ganze Generation teilt.
Drama der Verlassenheit
Wenn diese verlassenen Kinder nun selbst Kinder bekommen, gibt es keinen familiären Rückhalt. Niemanden, der beim Windelnwechseln hilft, niemanden, der finanziell einspringt. "Bis kurz vor Annas Geburt hatte ich keine Ahnung, wie ich es schaffen sollte“, erzählt Tatjana. Sie war 18, als sie schwanger wurde, und ihr Freund plötzlich nichts mehr von ihr wissen wollte. Hilfe fand sie im Mutter-Kind-Haus "In bratele mamei“, das die Caritas Wien seit zwei Jahren in Chisinau betreibt. Zehn junge Mütter in Krisensituationen finden hier Unterschlupf: Ein Zimmer zum Wohnen, eine Küche zum Kochen, Sozialarbeiterinnen zum Reden. Und die Gewissheit, nicht allein zu sein. Tatjana kann diese Geborgenheit an ihre Tochter weitergeben.
Andere Kinder und Jugendliche haben dieses Gefühl nie erlebt - mit tragischen Folgen. Die Jugendkriminalität wächst, Alkohol- und Drogenprobleme bei Minderjährigen nehmen zu. Zuletzt schreckte ein neues Phänomen: "Wir beobachten immer mehr Kinderselbstmorde“, sagt Viorica Dumbroveonu vom Sozialministerium. Im Vorjahr haben 100 Kinder und Jugendliche versucht, sich das Leben zu nehmen. In 26 Fällen ging der Selbstmordversuch tödlich aus. Acht Kinder waren nicht einmal 13 Jahre alt, zwölf jünger als 16.
Die Behörden kennen die Tragödien der zerrütteten Familien und beteuern, an Lösungen zu arbeiten. Eine Heimreform hat dafür gesorgt, dass die Zahl von 12.000 Kindern, die in staatlichen Institutionen leben, halbiert wurde. Man bemüht sich um Pflegefamilien und Tageszentren. Beides geht nur schleppend voran.
Erfolgreicher sind private Initiativen, wie "Petrushka“ in Tiraspol. In der Hauptstadt der abtrünnigen Provinz Transnistrien betreibt die Caritas ein Tageszentrum, das für manche Kinder auch Hauptwohnsitz ist. Zwanzig Kinder zwischen sieben und 16 wohnen dauerhaft hier, nochmal doppelt so viele kommen nach der Schule und gehen zum Schlafen nach Hause. Für alle gibt es warme Mahlzeiten, Platz zum Lernen und Spielen und Betreuerinnen, die basteln, trösten und zuhören. Die Eltern der Petrushka-Kinder sind im Ausland, im Gefängnis, oder nicht im Stande, für ihre Kinder zu sorgen.
Ein Zuhause für Sozialwaisen
Zu ihnen zählt Gregorij, 40, der auf den ersten Blick locker zehn Jahre älter sein könnte. Seine 14-jährige Tochter Olga wohnt seit fünf Jahren permanent in Petrushka. Ihre Mutter lebte in der Ukraine, seit zwei Monaten ist sie tot. Sie trank zu viel, sagt er. Auch Gregorij hat einen Hang zum Alkohol. Olgas Lehrerin machte ihn auf das Tageszentrum aufmerksam, als das Trinken überhandnahm. Kurz darauf zog die damals Neunjährige ein: "Am Anfang war es schrecklich“, erinnert sie sich, "lauter fremde Leute, lauter neue Regeln, und ich wollte bei meinem Vater sein.“ Aber dann wurden die Erzieherinnen für sie zu Ersatzmüttern, erzählt das aufgeweckte junge Mädchen. Sie findet es schön, mit anderen Kindern zu leben. Und ihren Noten tut es auch gut, nicht bei ihrem Vater zu sein. "Trotzdem denke ich jeden Tag an meinen Vater, telefonieren hilft ein bisschen.“ Zwei Mal im Monat kommt Gregorij, der mittlerweile für 90 Euro im Monat als Hilfsarbeiter in einem Dorf vor Tiraspol arbeitet, sie besuchen. Dann wohnt er in einer Hütte vor dem Häuschen seiner Tante, in der zwei Betten, ein Tisch und ein Kohlofen Platz haben. An einer Wand hängt ein Foto von Olga an ihrem letzten Volksschultag, an die andere sind ihre Zeugnisse geheftet. Ein Fläschchen Nagellack verrät, dass hier manchmal ein Teenager zu Besuch ist. "Ich bin sehr stolz, dass es sie gibt“, sagt Gregorij. "Ich trinke weniger. Ich wünsche mir, ein Haus zu kaufen und wieder mit ihr zusammen zu leben.“ Auch Olga träumt von einem Leben mit dem Vatar, und von einem Medizinstudium. In Moldau, nicht im Ausland: "Denn meinen Vater könnte ich nie verlassen.“
Eine Einstellung wie diese wünscht Irina Martiniuc bei mehr Mädchen. Die schneidige Dame - schwarzer Dutt, rote Lippen, weiße Baskenmütze - hat sich der Migrationsprävention verschrieben. Im Brotjob ist sie Zeremonienmeisterin bei einem Orchester. Ehrenamtlich möchte sie moldawische Mädchen vom Auswandern abhalten.
Internet-Telefonie mit dem Sohn
Ihre eigene Geschichte liefert den Grund für ihr Engagement: Ihr Mann ging kurz nach der Wende nach Kanada, der gemeinsame Sohn war damals drei. Fünfzehn Jahre später folgte er dem Vater und verließ Moldau ebenfalls. Seit drei Jahren hat Irina ihren Sohn nicht gesehen, mit ihm nur übers Internet telefoniert. Das soll anderen Müttern - und dem Land - erspart bleiben.
Mit ihrer Initiative will sie jungen Mädchen Perspektiven im eigenen Land aufzeigen. Am Nachmittag bietet ihr Verein Schülerinnen der größten Mittelschule in Chisinau eine kostenlose Berufsorientierung an: In Handarbeits-, Koch-, oder Computerkursen sollen sie Perspektiven für ihre Zukunft erkennen. Zusätzlich gibt es ein "Menschenrechtstraining“.
18 Mädchen besuchen den Kurs heute, es geht ums Auswandern. Im Kreis sitzen sie um türkise Schultische und schneiden Blätter aus Papier aus. Darauf schreiben sie Motive fürs Auswandern. Dann heften sie die Blätter an einen Papierbaum. Neben seinen Wurzeln schreiben sie Ursache. Ein Drittel der Schülerinnen hat selbst Eltern im Ausland. Sie wissen, wovon sie sprechen. "Jedes Problem hat eine Wurzel, und auch seine Lösung“, erklärt die Lehrerin beherzt.
"Wer von euch möchte später einmal ins Ausland gehen?“, fragt sie am Ende der Stunde. Zögerlich hebt ein Mädchen die Hand, dann ein zweites, dann noch eines. Zwei Drittel der Mädchen zeigen auf. "Und warum?“ Die Antwort ist schnell parat: "Um ein besseres Leben zu haben.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!