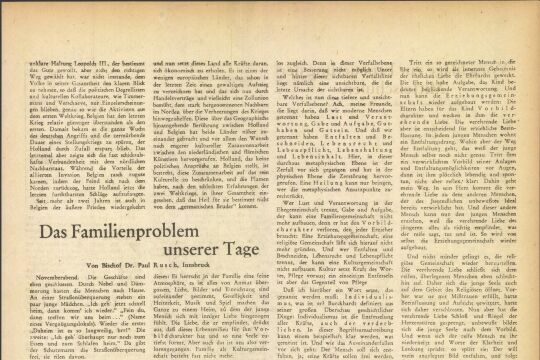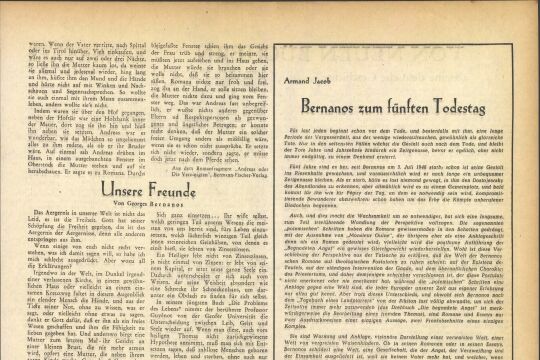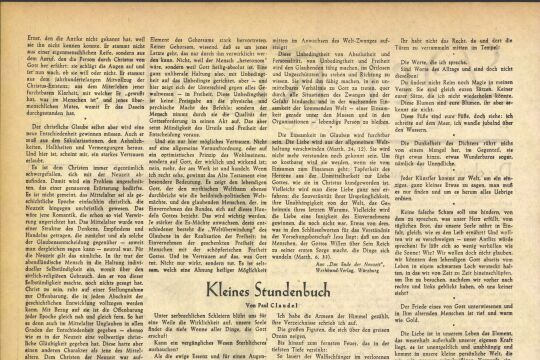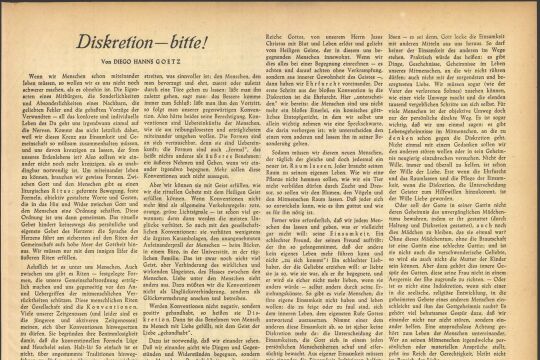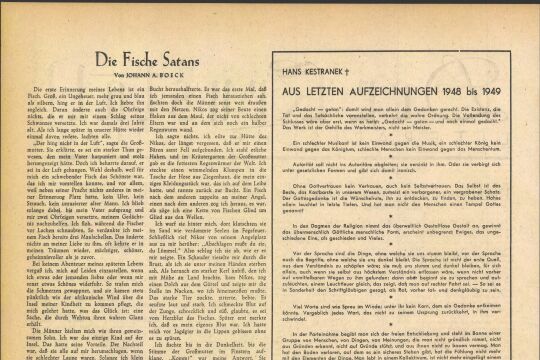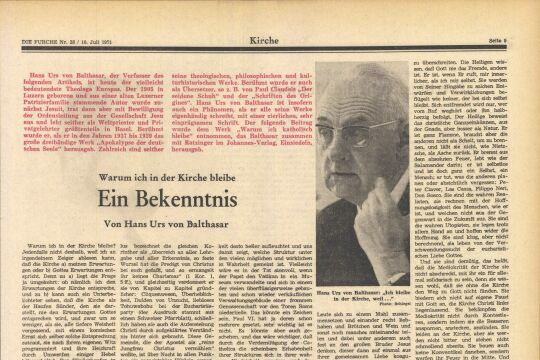Wie du mir, SO ICH DIR
Eine "Beziehung" ist alles und nichts zugleich. Den Anderen "gut leiden" zu können, ist hingegen ein Geschenk. Gedanken zur Gegenseitigkeit.
Eine "Beziehung" ist alles und nichts zugleich. Den Anderen "gut leiden" zu können, ist hingegen ein Geschenk. Gedanken zur Gegenseitigkeit.
Ein Student, der seit Wochen mit seiner Examensarbeit nicht vorankam, erklärte dies damit, dass "seine Beziehung ihm weggelaufen" sei und er deshalb nicht habe arbeiten können. So weit muss es erst einmal kommen, dass die Liebste aus Fleisch und Blut zur "Beziehung" abstraktifiziert wird. Kein Wunder, dass sie ihm weggelaufen ist, und recht geschieht's dem Liebhaber, der auf diese Weise immerhin die Chance bekam, ein wenig durcheinanderzugeraten.
Das Wort "Beziehung" macht das Sprechen über eine heikle Befindlichkeit absolut ungefährlich. Wenn ich meine Verbundenheit mit einem anderen Menschen, sei er Mann, Frau oder Kind, Vater oder Mutter, Freund oder Feind, alt oder jung, fremd oder bekannt als Beziehung deklariere, dann ist das so gut, als hätte ich gar nichts darüber gesagt. Aber so nichtssagend es ist, so machtvoll ist es auch, dieses Unwort. Es hat sich in unserem Sprachgebrauch an die Stelle von - ich weiß nicht wie vielen - Wörtern gesetzt, die einst das Verhältnis zwischen zwei oder mehr besonderen, konkreten Menschen präzise und bedeutungsvoll zu beschreiben vermochten. Welch ein Unterschied, ob ich statt von "Beziehung", von Liebe, Leidenschaft, schlaflosen Nächten, von einer Affäre oder einer Liaison spreche, von Begehren oder Eifersucht, von Hass oder Selbstaufgabe, von Treue oder Innigkeit, von Vertrauen, Zärtlichkeit, Sanftmut oder Unterwerfung, von Zuneigung oder davon, dass ich den oder die andere gut leiden kann.
Sprachliches "Beziehungseinerlei"
"Beziehung" hilft mir, die Gefahren, die mit einem solchen Bekenntnis verbunden wären, zu umschiffen und mir jede Verbindlichkeit vom Halse zu halten. Aber der Sprachgebrauch hat seine eigene Wirkmacht. Die Worte, die ich benutze oder vermeide, rufen die bezeichnete Sache entweder ins Leben oder verbannen sie daraus. Empfindungen, Erleben oder Sinneswahrnehmungen, für die wir keine Worte mehr haben, sind buchstäblich nicht mehr existent. Das sprachliche "Beziehungseinerlei" macht uns selbst fühllos und das, was wir erleben, stumpf, belanglos, langweilig. Und wer dann frustriert zu neuen Ufern aufbricht, gerät in der Sprachwüste in dieselbe Misere. Wahrscheinlich können inmitten dieser sprachlichen Dürre gar keine Begriffsklärungen mehr helfen. Nur Erzählungen und Geschichten über konkrete Begebenheiten und Begegnungen, Andeutungen oder Gesten können uns etwas lehren über das Wesen dessen, was in fideler Unverbindlichkeit "Liebe" oder "Freundschaft" genannt wird.
Ivan Illich erzählt eine solche Episode, die mich -ebenso wie ihn selbst - hellhörig gemacht hat: "Es war an meinem ersten Morgen in Senegal, im Marktviertel von Dakar. Mit einem Freund verließ ich das Haus, in dem ich die Nacht verbracht hatte, und wir gingen an der Mauer einer Sufi-Moschee entlang. Dort standen Bettler mit ausgestreckter Hand. Mit christlicher Selbstverständlichkeit stöberte ich nach einem Zehnfrankenstück in meiner Tasche und legte es so beiläufig wie möglich in eine dieser Hände. Ich hatte den Mann nicht einmal angesehen. Mein Freund blieb stehen und forderte mich auf, dem Bettler in die Augen zu sehen und mich vor ihm zu verbeugen. Ich hatte ihm eine Spende gereicht, und jetzt war es an ihm, mich mit einem Koranspruch zu segnen. Was da vor sich ging, war genau des Gegenteil eines Gabentausches. Es war eine Feier der Unvergleichbarkeit von zehn Franken und Allahs Segen. Und gerade deshalb konnten wir einander in die Augen sehen als Du und Du. Die Unvergleichbarkeit der Spende hatte unsere Ebenbürtigkeit bezeugt."
Jenseits des Tauschprinzips
Warum besteht Illich darauf, dass hier am Fuße der Moschee kein Tausch, sondern eine Feier stattgefunden hat? Weil ein Segen nun einmal nicht für ein Zehn-Frankenstück eingetauscht werden kann - auch wenn heute alles käuflich zu sein scheint. Sie sind eben unvergleichlich. Wir sind gewohnt, uns die Gegenseitigkeit als gerechten Tausch vorzustellen. Gerecht geht es zu, wenn die Gaben, die da getauscht werden, ungefähr den gleichen Wert haben. Aber was kostet ein Segen, ein Lächeln, eine Geste des Respekts?
Sprichwörtlich findet sich das Prinzip der Gegenseitigkeit in der Handlungsmaxime: "Wie du mir, so ich dir" oder -weniger rachsüchtig - "Was du nicht willst, das man dir tu, das füg' auch keinem andern zu." Aber dies sind alles schon buchhalterische Erwägungen, in denen die Vernunft des Tauschprinzips regiert. Recht eigentlich geht es dabei nicht um Gegenseitigkeit, sondern um Einseitigkeit: Ich bin nicht an deinem Wohlergehen interessiert, sondern an meinem Vorteil. Vernünftigerweise muss ich allerdings davon ausgehen, dass du meinen Vorteil nur dann mehren wirst, wenn dabei dein Vorteil nicht zu kurz kommt. Und da wir im Resultat beide einen Vorteil nach Hause tragen, glauben wir einander nicht geschadet zu haben. Tatsächlich haben wir uns gegenseitig unseres Eigen-Sinns beraubt und uns wechselseitig zum Mittel unseres Vorteilsstrebens gemacht, ohne allerdings offene Gewalt anzuwenden. Das ist die List der Tauschvernunft, dass sie scheinbar ohne Gewaltanwendung nichts als Vorteil verschafft.
Wenn aber dieses Wechselverhältnis von Geben und Nehmen, das doch der Inbegriff der Gegenseitigkeit zu sein scheint, diesen Namen nicht verdient, was macht dann ihr Wesen aus? Stellen wir uns die Gestik des Gebens und des Nehmens in diesem Tauschakt bildlich vor Augen: Der Gebende hält das, was er auszuhändigen sich anschickt, mit der einen Hand eisern fest, während die andere schon nach dem greift, worauf er es abgesehen hat. Greifen und Festhalten: beides bringt nicht die Gebärde der offenen, sondern der besitzergreifend verkrallten, der grapschenden Hände hervor. Und die Augen? Wohin ist der Blick der Akteure gerichtet, während sie - gleichzeitig - geben und nehmen? Ich denke, sie schauen auf das Gut, das den Besitzer wechselt, sie schauen einander nicht in die Augen, denn die könnten verraten, dass der Blick scheel und lauernd ist, dass jeder doch des Andern Übervorteilung oder Betrug im Sinn hat und den vertrauensvollen Umgang nur täuschend ähnlich imitiert.
Ganz anders das Wechselspiel von Geben und Empfangen. In ihm teilt der Gebende mit offenen Händen aus, während der Empfangende die Hand zu einer Schale öffnet, in die etwas hineingelegt werden kann. Die Gaben, die ausgeteilt oder empfangen werden, sind keine Besitztümer, die ihren Besitzer wechseln, sondern Geschenke. Und der Blick hat nichts zu verbergen, jeder kann dem andern das offene und unverstellte Antlitz zuwenden.
Das Verhältnis der Gegenseitigkeit erlaubt mir, dem Anderen eine Gabe zu reichen, aber kein Almosen; es erlaubt mir, dem Anderen nah zu sein ,aber nicht, ihn zu okkupieren; ihm Beistand zu leisten, aber nicht, ihn zur Gegenleistung zu verpflichten; mitfühlend zu sein, aber nicht, ihn verstehen zu wollen. Ja, tatsächlich, ich will den guten Ruf des Verstehens schädigen. Verstehen ist invasiv, es will dem Anderen unter die Haut und lässt an ihm nur gelten, was mein Verständnis von ihm nicht gefährdet. Verstehen des Anderen ist ein Akt der Bemächtigung, der ihm seine Fremdheit stiehlt. "Verselbigung des Anderen" nennt Emmanuel Levinas diesen Übergriff.
"Ich kann dich gut leiden" können wir in der deutschen Sprache sagen, und das ist ein wirkliches Geschenk unserer sprachschöpferischen Ahnen. Kein Liebesschwur entgeht dem Schicksal, einen Anspruch an den oder die Andere zu richten. Denn unweigerlich erfordert er die Gegenleistung eines Liebesbekenntnisses. "Ich kann dich gut leiden" sagt etwas anderes: "Ich leide an dir, aber weil du es bist, kann ich es gut." Und vielleicht sogar nur, weil ich an dir leide und dich als fremd und unverstehbar erfahre, können wir einander als "Ich" und "Du" begegnen.
Die Autorin ist Publizistin und war bis 2006 Professorin für Erziehungs- und Sozialwissenschaften in Wiesbaden
DIE FURCHE
26. Juni 1965 Nr. 26
Zwischen Ich und Du.
In memoriam Martin Buber
Von Arno Anzenbacher, em. Prof. für Christliche Anthropologie und Sozialethik an der Universität Mainz.
Die Haltung des Menschen ist zwiefältig nach der Zwiefalt der Grundworte, die er sprechen kann. (...) Das Grundwort Ich-Es gestaltet, ordnet, bewältigt die Welt. Als ein Kontinuum des Raumes und der Zeit, durchwaltet von der Kausalität ohne Geheimnis und völlig der Forschung anheimgegeben, ist sie das Ganze, in dem jedes seinen Platz hat. (...) Das Grundwort Ich-Du aber führt den Menschen aus der Es-Welt in das unvorhergesehene, unberechenbare Wagnis der Begegnung, wo es keine Forschung, kein Wissen und keine Konsistenz gibt, sondern wo Ansprache geschieht und Antwort gefordert ist in der Sprache, welche die Situation bestimmt. (...) Beschränkt sich das Sprechen des Menschen auf das Grundwort Ich-Es, so ist der Mensch in einer Welt behaust, die ihm Ruhe und Sicherheit gewährt. Aber der letzte Sinn alles Menschseins bleibt dabei unerfüllt. Denn der Sinn des Menschen liegt zwischen Ich und Du. Das Du ist das Einzelne, Begegnende, das die Situation darreicht, das Stück Welt, das anspricht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!