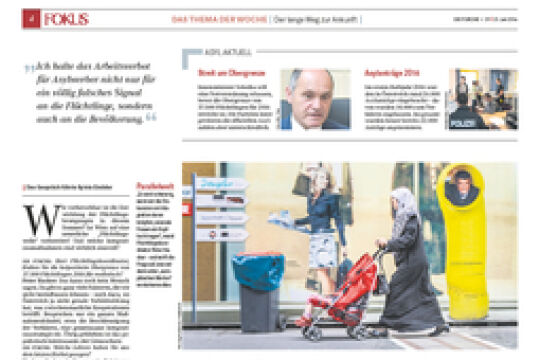In den Niederlanden hat die Regierung im Zuge ihrer restriktiven Asylpolitik Lager für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die keine Chance auf Asyl haben, eingerichtet. Ziel ist es, die Jugendlichen auf die Rückkehr in ihre Heimatländer vorzubereiten.
Die Narbe läuft quer über Henrys linke Wange. Sie gibt seinem Gesicht einen verwegenen Ausdruck. Dabei ist Henry alles andere als ein Haudegen: es war ein Fahrradunfall, und wenn Henry davon erzählt, muss er über sich selbst lachen. Der Sechzehnjährige wirkt schüchtern, hört genau zu, wenn man ihm Fragen stellt, sagt artig bitte und danke. Henry lernt gerne, ein Muster-Teenie.
Er ist einer von 90 Jugendlichen zwischen 15 und 18, die auf einem Campus für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben. Die niederländische Abkürzung für dieses Wortungetüm ist AMA (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers). Der AMA-Campus liegt im Grünen bei Deelen, dreißig Busminuten von Arnhem entfernt.
Feuer im Lager gelegt
Der erste Campus wurde im November 2002 in Vught in den Zentralniederlanden eröffnet. Diese Lager sind ein Experiment der seit 2001 rigiden niederländischen Asylpolitik. Damals verabschiedete die Regierung ein neues Asylverfahrensgesetz, nach dem schnell und endgültig über Asylanträge entschieden wird - innerhalb von 48 Stunden.
Im Februar sah es so aus, als sei das Experiment gründlich fehlgeschlagen. Die jungen Flüchtlinge zettelten einen mehrtägigen Aufstand in Vught an: Sie legten Feuer, setzten die Einrichtung unter Wasser, griffen das Personal an. Der Grund für diese heftige Gegenwehr war die Strenge, die im Campus herrschte. Als Basis für das Gruppenleben diente das "Glenn-Mills-Programm", eine Methode, die in den USA entwickelt wurde, um straffällige Jugendliche zu erziehen.
Die Methode lebt von Hierarchie: Neuankömmlinge, "Rookies" genannt, dürfen nichts, außer lernen, sich den Regeln anzupassen. Die Älteren - "Senioren" - haben Privilegien, zum Beispiel Zimmer mit nur vier Bewohnern, während sich die Rookies eins zu acht teilen. Darüberhinaus bekommen sie für ihre Zimmer Fernseher und Kühlschrank. Durch regelkonformes Verhalten kann man Bonuspunkte sammeln und in der Hierarchie aufsteigen. Oben sein, heißt, mehr Privilegien haben, zum Beispiel Ausgang. Anfangs durften die Jugendlichen den Campus nicht verlassen, mussten bestimmte Kleidung tragen und zwischen sieben Uhr morgens und elf Uhr abends am Gruppenprogramm teilnehmen.
Nach dem Aufstand
Das Ergebnis: Nach dem Aufstand in Vught musste die für die Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern zuständige Behörde mit einer neuen Gruppe von vorn beginnen - mit liberalisierten Regeln. Die Rebellen liefen zum Teil weg, zum Teil wurden sie in andere Einrichtungen verlegt. "Wir haben natürlich begriffen, dass die Jugendlichen bei uns keine Kriminellen sind, sondern lediglich einen Asylantrag gestellt haben", sagt John de Jong, Direktor in Deelen. Hier geht es nicht so streng zu. Die Jugendlichen haben ein paar Stunden in der Woche Ausgang, dürfen sich kleiden wie sie wollen, und ab 16.30 Uhr ist Freizeit angesagt. Privilegien als Stimulanz der Gruppendynamik hält John de Jong trotzdem für notwendig: Auch in Deelen gibt es Rookies in Acht-Bett-Zimmern und Senioren mit Kühlschrank. Senior wird, wer den nötigen Grad an Selbständigkeit erreicht hat.
Im Campus leben junge Flüchtlinge, die keine Aussicht auf Asyl haben. Ziel ist es, sie auf die Rückkehr in ihre Heimatländer vorzubereiten und sie dazu zu bringen, die Tatsache der Rückkehr zu akzeptieren. Auch Henry weiß, dass er gehen muss, sobald er achtzehn ist. "Ich hatte den Plan, Medizin zu studieren, aber wenn das nicht geht, lerne ich etwas anderes, Automechaniker oder so."
Im Campus besuchen die Jugendlichen eine Schule. Sie haben die Möglichkeit, in verschiedene Berufssparten zu schnuppern und eine Fachrichtung zu lernen: Elektronik, Textil, Computer oder Holz. Der Unterricht wird in Englisch erteilt. "Da legen wir ganz viel Wert drauf", sagt John de Jong. "Sie mögen das nicht, aber es ist notwendig, es ist die wichtigste Sprache hier." Henry kommt aus Nigeria und hat keine Probleme mit Englisch, wünscht sich aber inständig, Niederländisch zu lernen. "Weil es sinnvoll ist. Wenn wir rausgehen, wollen wir doch mit den Leuten reden und sie reden nun mal Niederländisch. Das war auch der Grund für die Krise vor zwei Wochen hier. Sie haben uns versprochen, über Niederländisch-Unterricht nachzudenken, aber es passiert nichts."
Doppelt so hohe Kosten
Die Krise? Spuren sind noch zu sehen: Fenster der weißen Containerbauten sind mit Brettern vernagelt, alle Schlösser sind ausgewechselt. "Ehrlich gesagt, ich kann die Jungs verstehen", gibt John de Jong zu. "Viele kommen hierher und Verwandte oder ein ganzes Dorf setzen große Erwartungen in sie. Diese Erwartungen müssen sie erfüllen. Viele haben Schulden gemacht. Und dann kommt die Enttäuschung. Diese Enttäuschung haben wir am Anfang nicht gleich begriffen. Je mehr wir die Botschaft Du musst zurück' vermittelt haben, desto schlimmer wurde es." Vor zwei Monaten musste er die Polizei rufen. Eine Gruppe Afrikaner hatte sich zusammengetan und andere vom Schulbesuch abgehalten. Es kam zu einer Schlägerei. Die Anführer wurden festgenommen und in andere Zentren verlegt. "Ich finde das nicht gut: Sie haben dort mehr Freiheit, aber es gibt dort keine Schule, keine Förderung der Selbständigkeit und keine Akzeptanz der Rückkehrforderung", bedauert Direktor De Jong.
Der Staat lässt sich dieses Konzept einiges kosten: doppelt so viel wie einen normalen Flüchtling. Warum der Staat so viel Geld in Menschen investiert, die sowieso nicht im Land bleiben dürfen, erklärt De Jong so: "Weil es Jugendliche sind; die Jugend hat man nur einmal und man muss diese Zeit optimal nutzen, um zu lernen."
Aber die Niederlande tun sich schwer mit dem Jugendschutz. Der Bericht vom April 2003 von Human Rights Watch stellt fest, dass sich die niederländische Immigrationspolitik über die Interessen und Rechte von Migrantenkindern hinweg setzt. Sie missachte die UN-Kinderrechtskonvention. Insbesondere die Tatsache sei Besorgnis erregend, dass mehr als 30 Prozent aller Kinder, die in den Niederlanden Asyl suchen, durch das beschleunigte 48-Stunden-Verfahren bearbeitet wurden.
Wilma Lozowski vom Flüchtlingswerk teilt diese Kritik: "Die Kinder sind oft traumatisiert und haben keine Gelegenheit, ihre Geschichte vorzutragen." Und die Einwanderungsbehörde befrage Kinder oft, ohne dass ein Anwalt oder ein Vormund dabei ist. Human Rights Watch bemängelt außerdem, dass die Behörde bei den Interviews keine Rücksicht auf den Entwicklungsstand von Kindern nimmt. So beurteilte die Behörde die Aussage eines zehnjährigen Jungen als unglaubwürdig, weil er sich nicht daran erinnern konnte, wie der Mann heißt, der ihn in Angola geschlagen hatte, ihn zwang zu stehlen und Drogen zu nehmen.
Menschenrechtler werfen den Niederlanden vor, gegen die UN-Kinderrechtskonvention zu verstoßen, nach der das Wohl des Kindes über allem anderen steht. Das oberste Verfassungsgericht hat allerdings im Februar 2003 festgestellt, dass diese Konvention nicht auf Kinder zutrifft, deren Eltern kein Recht haben, in den Niederlanden zu bleiben. Diese Kinder könnten auch keine Zweitrechte in Anspruch nehmen, die sich aus der Kinderrechtskonvention ergeben. Sie dürfen keinen staatlichen Schutz einfordern, noch nicht einmal eine Minimalversorgung wie Unterkunft und Essen.
Holland: Vorbild für EU?
Große politische Forderungen hat Sadio nicht. Er ist Vorsitzender der Selbsthilfeorganisation junger unbegleiteter Asylsuchender. Er ist zwanzig, kam mit dem Schiff aus Guinea und wusste ebenso wie Henry nichts über die Niederlande. Aber einmal möchte er den Politikern gegenübersitzen und ihnen erklären, dass Kinder keine Nummern sind, an denen man den Erfolg einer restriktiven Einwanderungspolitik misst.
Den Erfolg der AMA-Lager misst im September die Ministerin für Immigration und Integration Rita Verdonk an den Kriterien: Selbständigkeit, Entwicklung, Sicherheit und freiwillige Rückkehr. Bis jetzt ist erst ein Jugendlicher freiwillig zurückgekehrt. Sollte sich die Ministerin entscheiden, das Campus-Modell weiter zu führen, kann sich Direktor John de Jong vorstellen, dass die Niederlande wieder einmal Vorbild für den Rest der EU werden.
Henrys Erfolgskriterien sehen hingegen ganz anders aus: "Vielleicht kann ich doch noch irgendwo Medizin studieren."
Die Autorin ist freie Journalistin.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!