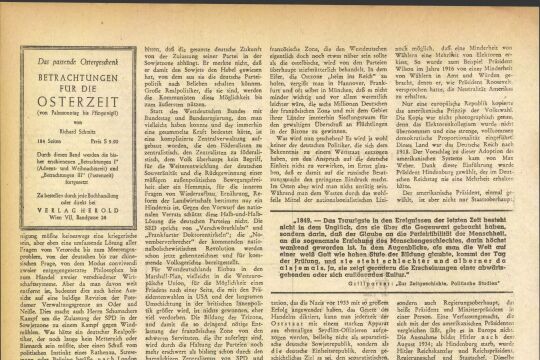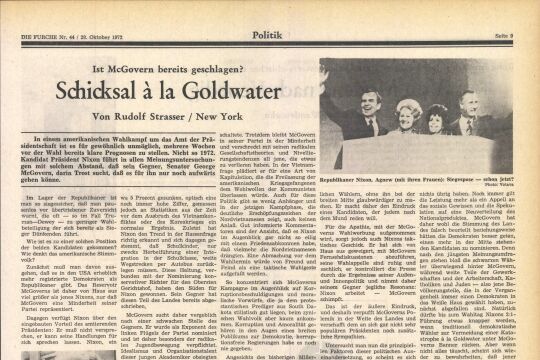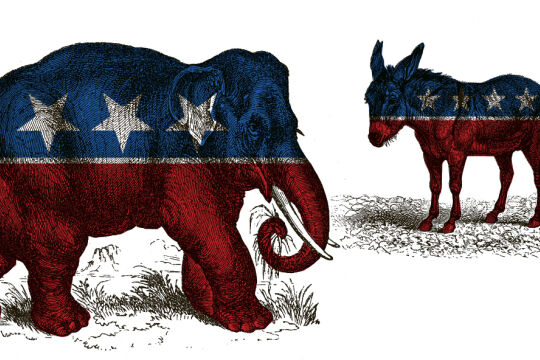Alte Gräben, neu vertieft
Die US-Demokraten geben im Vorwahlkampf ein Bild des Jammers ab. Schuld daran ist die Unfähigkeit, mit den Linken in der Partei umzugehen.
Die US-Demokraten geben im Vorwahlkampf ein Bild des Jammers ab. Schuld daran ist die Unfähigkeit, mit den Linken in der Partei umzugehen.
Die Politik in Zeiten der Choleriker bringt es mit sich, dass im US-Vorwahlkampf sehr ungewöhnliche Fragen gestellt werden. Was zum Beispiel, so eine davon, ist ein „verlogener, hundsgesichtiger Kavallerist“? Mit dieser Wortsalve wurde eine Studentin von Kandidat Joe Biden belegt, nachdem sie es gewagt hatte zu fragen, warum es bei ihm, Biden, so schlecht laufe bisher. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art, die der vermeintliche Favorit auf die Nominierung der Demokraten derzeit auf die Bühne bringt. Die Beschimpfungen beginnen bei „Lügner“ und enden bei „Idiot“.
Szenen wie jene aus New Hampshire zeigen aber nicht nur die Nervosität des ehemaligen Vizepräsidenten. Sie bringen vielmehr das Dilemma der Demokra-ten auf den Punkt. Man hat den Wählern eine andere Art der Politik versprochen und eine andere Art des Umgangs miteinander – als jene, die der regierende Präsident Donald Trump täglich vorführt. Aber dieses Versprechen wird von kaum einem Kandidaten gehalten, nicht einmal von einem ehemaligen Vizepräsidenten wie Joe Biden.
Unmöglicher Spagat
Für die Nervosität und die Aggression machen die Kommentatoren der US-Nachrichtensender gerne den inhaltlichen Spagat der Wahlwerber verantwortlich: Den Versuch also, traditionellen Stammwählern und konservativen republikanischen Wechselwählern genauso zu gefallen wie linken Reformbewegungen. Aber das allein würde noch keine bösartigen Grabenkämpfe auslösen, wie jenen zwischen dem Linksausleger Bernie Sanders (Sieger der Vorwahlen in New Hampshire) und
dem moderaten Pete Buttigieg.
Dass es so ist, liegt aber nicht so sehr an den Kandidaten selbst, als vielmehr an einer schlecht überdachten Demokratisierung der Partei, die Ruhe in die Reihen bringen sollte, aber das Gegenteil bewirkte. Doch der Reihe nach: Im Wahlkampf 2016 hatte das Parteiestablishment Hillary Clinton massiv unterstützt und ihren Konkurrenten Bernie Sanders mithilfe ihres Stimmgewichts als „Superdelegierte“ aus dem Rennen geworfen. Diese besonderen Delegierten (Kongressmitglieder, Senatoren und ehemalige Spitzen der Partei sowie Mitglieder des Nationalkomitees) werden traditionell nicht gewählt, sondern haben als aktuelle und ehemalige Parteigranden eine automatische Stimme auf dem entscheidenden Konvent. Es handelt sich dabei immerhin um etwa 800 Delegierte, also ein Fünftel aller Stimmen.
Auf der linken Seite war damals die Verbitterung groß. Statt Clinton gegen Trump zu unterstützen, ging der revolutionäre Flügel um Sanders auf Distanz – der Partei wurde Klüngelei und Korruption vorgeworfen, Clinton wurde als mögliche Kriegstreiberin gebrandmarkt und als Verbündete der Großkonzerne. Es war auch diese Entsolidarisierung, die letztlich die knappe Niederlage gegen Donald Trump verursachte.Die Reaktion des Parteivorsitzenden Tom Perez, ein ehemaliger Arbeitsminister unter Präsident Obama, war eine Reform, die den Superdelegierten ihren Status nahm. Künftig sollten alle Delegierten ausschließlich vom Parteivolk in den Vorwahlen bestimmt werden – eine Selbstentmachtung der Parteielite also.
Hoffnung auf Frieden
Die Sanders-Anhänger jubelten und Perez meinte, die internen Gräben damit zugeschüttet zu haben. David Bergstein, der Sprecher der Demokraten, ist immer noch stolz auf die Regelung: „Diese Regeln machen uns stärker und sichern, dass Nominier-te den vollen Rückhalt der Partei haben.“
Wie sich zeigt, passiert das aber nicht. Im Gegenteil: Am linken Rand kämpft Bernie Sanders umso erbitterter um jede Delegiertenstimme, da er sich tatsächlich Chancen ausrechnen darf, ohne Superdelegiertenregel gegen den Willen des Establishments der Partei gekürt zu werden. Die von ihm geforderte nochmalige (dritte) Stimmenauszählung gegen Pete Buttigieg in Iowa geht dementsprechend mit Untergriffen und Verdächtigungen der Manipulation gegen die Parteivorderen über die Bühne. Dabei steht der Vorwahlkampf erst am Beginn. Die alten Clinton-Gräben zwischen Links und Rechts bei den Demokraten wurden also nicht zugeschüttet, sie werden vielmehr wieder und mit Inbrunst aufgerissen. Nach innen also mögen sich die Demokraten demokratisiert haben, nach außen vermitteln sie den Eindruck einer führungslosen Partei, mäandernd im Auf und Ab der verfeindeten Lager.
Das haben nun offensichtlich einige aus dem Kreis der über 400 Deputierten zum Nationalkomitee der Partei verstanden. Etwa ein halbes Dutzend von ihnen, so der Vorwurf, arbeite nun daran, die Superdelegiertenregel wieder einzuführen und damit das Stimmgewicht eindeutig zugunsten der moderaten Wahlwerber zu verändern.
Wer gegen Trump
Tatsächlich geht es bei diesem scheinbar öden internen Gerangel um Parteistatuten um die Zukunft der USA. Denn nicht jeder Kandidat, den die Parteibasis der Demokraten liebt, hätte auch Chancen bei den Präsidenten-Wahlen im Herbst. Diese Einschränkung gilt vor allem für Bernie Sanders. Er liegt derzeit zwar in Umfragen gegen Trump knapp in Front. Aber viele Demokraten fürchten, dass diese Werte abrutschen, sobald aufgrund seiner Forderungen (Vermögensbesteuerung, staatliche Krankenversicherung, Tobin Tax etc.) die Antisozialismus-Kampagne Trumps richtig in Fahrt kommt. Zudem schließt sich Sanders nur in Wahlkampfzeiten den Demokraten an, ist sonst aber parteifrei.
Joe Biden wäre hingegen nicht nur ein treuer Parteigänger, er führt in den landesweiten Umfragen auch überlegen gegen Trump. Aber er scheint bei der Parteibasis nicht anzukommen und verschlechtert seine Position durch seine Verbalentgleisungen weiter. Elisabeth Warren, eine Harvard-Professorin, hat nach Umfragen schlechte Karten bei den Arbeitern und Angestellten der Mittelschicht und liegt auch parteiintern weit hinter Sanders. Michael Bloomberg ist derzeit noch der große Abwesende bei den Vorwahlen.
Bleibt Pete Buttigieg, der Sieger der Vorwahlen in Iowa. Der Bürgermeister könnte ein Kompromisskandidat zwischen Linken und Rechten sein. Er ist zwar keineswegs links, dafür aber jung, dynamisch und für viele Demokraten „obamisch“ genug. In den Umfragen schneidet er schlechter ab gegenüber Trump als Biden oder Sanders. Aber der Präsident hat ihn immerhin schon wahrgenommen: „Wer zur Hölle ist das? Bürgermeister Pete? Erklär mir das einer!“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!