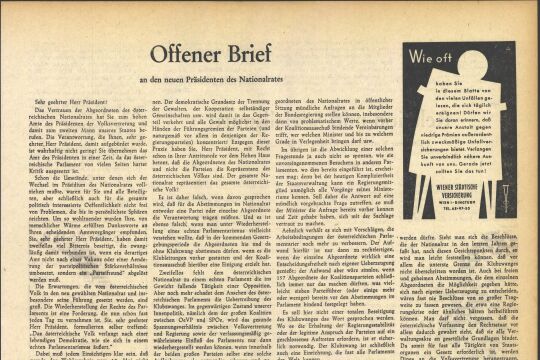Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
An den Rand geschrieben
GERECHTIGKEIT — ABER WIE! Viel war die Rede in diesen Wochen von „gerechtem” und „ungerechtem” Wahlrecht, und vermutlich nur wenige Staatsbürger konnten sich darüber ein Bild machen, daß erstens eine absolute „Gerechtigkeit” zur hoffnungslosen Zersplitterung der Mandate führen müßte, daß daduich im Parlament viele kleine Parteien miteinander in einen ständigen hoffnungslosen Nahkampf verwickelt wären und kaum eine tragfähige Regierung bilden könnten. Zweitens aber würde die Abkehr vom gegenwärtigen System, wonach die Zahl der Abgeordneten im Verhältnis der Bürgerzahl der Wahlkreise zu verteilen ist, erst recht nicht nur die klaren Bestimmungen der Bundesverfassung verletzen, sondern auch krasses Unrecht schatten. Drittens ist im Bundesstaat Österreich das föderalistische Prinzip auch im Wahlrecht unbedingt einzuhalfen. Besonders zu beachten ist dabei die Bestimmung, dalj für die Vertretung eines Wahlkreises die Zahl der dort ansässigen Bundesbürger maßgebend ist. Was bedeutet das? Jeweils 42.000 Bundesbürger haben im Parlament in Wien heute einen Repräsentanten, der dort für sie spricht und abstimmf. Darunter sind nicht nur die stimmberechtigten Erwachsenen, sondern auch die Minderjährigen zu verstehen. Das heißt also, daß nach dem Willen unserer Bundesverfassung die am Wahltag abgegebene Stimme eines, sagen wir, Vorarlberger Familienvaters mit fünf Kindern mehr wiegt als eines Wieners, der keine Kinder hat. Das soll also ungerecht sein. Haben aber nicht alle Bürger, nicht nur die stimmberechtigten, ein gleiches Recht auf Vertretung in der gesetzgebenden Körperschaft? Und hat nicht der Familienvater vor Gott, vor seinem Gewissen und vor dem Gesetz die volle Verantwortung für seine minderjährigen Kinder? Trägt er nicht die Last der Verantwortung in mannigfacher Art dafür, daß Österreich auch in den kommenden Jahrzehnten Wähler und Mandatare hat? Ist die Verfassung, die all das in Betracht zog, ungerecht?
i
PARTEI UND ÖFFENTLICHE MEINUNG. Ganz Österreich Ist Zeuge nicht zuletzt durch eine Fernsehveranstaltung am letzten Wochenende — der scharfen Kontroverse zwischen Parteipolitikern und Journalisten, die wegen der Volksbegehrenaktion der Zeitungen in der Frage einer Rundfunkreform entbrannt ist. Es wurde behauptet, daß die Journalisten unter dem schönen Namen eines Generalintendanten einen Rundfunkdiktator einsetzen wollen, ferner, daß sie eine Pseudopartei bilden wollen, die von der repräsentativen Demokratie wegführt und zum Poujadismus und Gaullismus hinführt. Es ist nicht schwer, zu erkennen, daß durch solche Beschuldigungen versucht wird, von den bisherigen Versäumnissen der Parteien abzulenken. Hätten diese zum Beispiel an der Rund- funikfront für normale Zustände gesorgt, wäre keiner Zeitung eingefallen, Unterschriftenaktionen zu starten. Es ist eine bittere Erkenntnis und sie mag die Gereiztheit der Politiker einigermaßen begründen —, wenn man wahrnehmen muß, daß Partei und öffentliche Meinung einander nicht ganz verstehen. Eine Schweizer Stimme sagte unlängst Beachtenswertes über die Rolle der Parteien in der Demokratie Schweizer Prägung: Sie tragen das Geschehen in der Gemeinde, sie sind die Rekrutierungsbasis für Zehntausende von Bürgern und Bürgerinnen in verschiedenen Ämtern. Sie tragen die Verantwortung für den Zusammenhang des Ganzen, sie sind die Wächter der Rangordnung der Werte. „Der Einfluß der Parteien und der Parlamentarier wird von ihnen selbst bestimmt; ob sie Macht haben oder ob sie nichts gelten, ist ihr ureigenstes Werk.” Wenn hier etwas nicht stimmt, wenn die öffentliche Meinung nicht mitzieht, dann ist es höchste Zeit für Gewissensforschung. Kampfszenen auf dem Ferrv- sehschirm machen die Vertrauenskrise nur deutlicher.
BESUCH AUS RUMÄNIEN. Der Wiener Besuch des Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten Rumäniens, Gheorghe Apostol, stand im Zeichen der Wirtschaftsbeziehungen, die für die Länder des ganzen Donau raumes naturgegeben sind und deren Wichtigkeit in Wien immer betont wurde, auch in einer Zeit, in der man im östlichen Teil des Donauraumes die Blickrichtung wechseln zu müssen glaubte. Heute blicken die Staatslenker Rumäniens nicht nur nach Peking, Moskau, Paris und Washington, sondern auch nach Wien. Für die Großzahl ihrer Staatsbürger hat der Name Wien seinen guten Klang nie verloren. Es wäre zu wünschen, daß die Beziehungen nicht nur auf die Spitze beschränkt blieben, sondern breiter und tiefer werden. Der Handel mag hier, nach einem guten alten Prinzip, nützliche Dienste leisten. Dies erkannt zu haben, ist ein Verdienst, das den Gästen gerne attestiert wird.
DER ZÖGERNDE NACHBAR. So lau- tete der Titel eines Buches, das Frankreichs Politik seit dem zweiten Weltkrieg behandelt und vor dem Wiedereintritt de Gaulles in die politische Arena erschienen ist. „Die schlimmen Nachzügler”, schalt „New York Times” um jene Zeit die Politiker der Vierten Republik; der Autor des erwähnten Buches, Alexander Werth, schrieb seine Frank- reichsludie im Auftrag der Universität Manchester… Das Blatt hat sich seither gewendet. De Gaulle hat sein weltpolitisches und europäisches Konzept, und er läßt sich bei deren Verwirklichung durch niemanden aufhalten. Der zögernde Nachbar ist heute, zumindest von Frankreich aus gesehen, die deutsche Bundesrepublik. Der soeben stattgefundena Bonner Besuch des Präsidenten Frankreichs hat in dortigen Regierungskreisen einige Verwirrung ausgelöst. Fast die gesamte Führungsspitze der CDU hat gegen die auf Gleichschritt mit allen übrigen europäischen Partnern, darunter vor allen mit England, gerichtete Haltung Erhards und seines Außenministers Schröder otfen Stellung bezogen; allen voran Altbundeskanzler Adenauer, der die Gelegenheit benützte, um in aller Offenheit für de Gaulles Programm einer politischen Union vorerst zwischen Frankreich und Deutschland einzufreten. De Gaulle selbst hat Adenauer als seinen eigentlichen Gesprächspartner betrachtet. Fürs erste kann man aus all dem einen noch mehr auf vorsichtiges Abwarfen bedachten künftigen außenpolitischen Kurs der Bonner Regierung herauslesen. Die Frage ist dabei, wie lange die Partei ihrem Regierungschef diese zögernde Hai- Jung abnimmt.
ABSCHIED VOM NJASSALAND. Das Konzert der afrikanischen Staaten wurde soeben durch eine neue Stimme bereichert: In Anwesenheit des Prinzen Philip und anderer Notablen des restlichen Empire wurde die bisherige Fahne des Njassalandes, der Union Jack, eingeholt und die neue Sfaatsfahne des unabhängigen Staates Malawi durch Ministerpräsidenten Hastings Kamuzu Banda höchstpersönlich gehißt. Dieser traf dabei auch einige bemerkenswerte Feststellungen: „Ich werde mich auf die Seite des Westens stellen, wenn ich glaube, daß es für Malawi gut ist, und auf jene des Ostens, wenn dies für uns von Vorteil sein sollte.” Diese Staatsräson zeigt natürlich keine Spur von einer politischen Moral außer der des weiland Machiavelli. Aber darüber zu räsonieren, hat wohl kleinen Zweck.
JOHNSONS STUNDE. Für viele Bürger der Vereinigten Staaten schien die Zeit plötzlich stillzustehen: in der Stunde nämlich, als Präsident Johnson die vielumstrittene Civil Rights Act, die den amerikanischen Negern ihre Rechte, die ihnen auf dem Papier der Verfassung seit fast 100 Jahren zustehen, auch in Wirklichkeit sichert. Johnson appellierte durch alle Fernseh- und Rundlunk- stafionen des Landes feierlich an alle Bürger, die Verfassung, die Moral und die freiheitlichen Ideale Amerikas nunmehr voll und ganz zu respektieren. Ein Kampf ging damit nach elfjähriger Dauer zu Ende — freilich noch nicht ganz. Denn der Abbau der Rassendiskriminierung, den das Gesetz dekretiert, wird sich noch auf Jahre erstrecken und wahrscheinlich erneut Widerstände her- vorrufen. Trotzdem zeigt das Gesetz den guten Willen der gewählten Repräsentanten Amerikas — in einem Wahljahr! — und damit wohl auch den der Mehrheit der Nation.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!