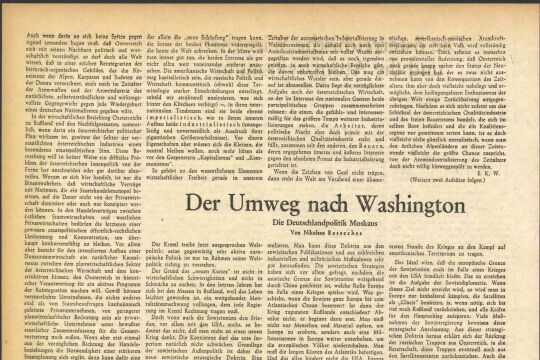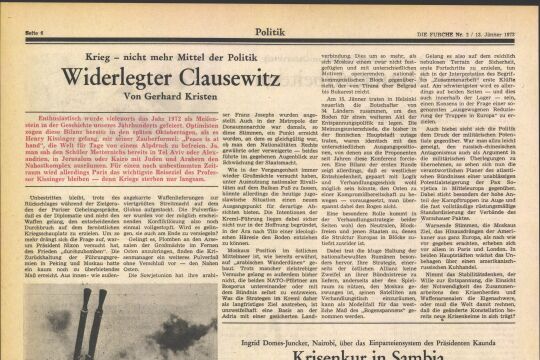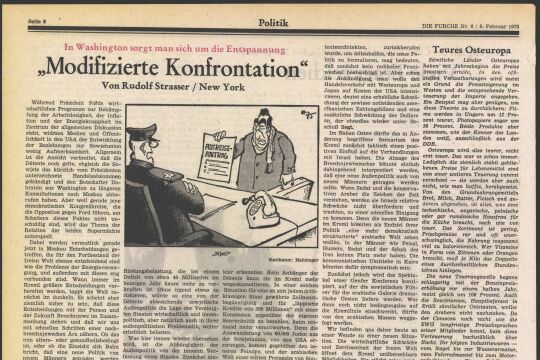Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
... bis zum Ural?
In Wien findet Im Juni ein Europagespräch unter dem Motto „Brücken zwischen Ost und West“ statt, zu dem die Russen namhafte Vertreter wie den „Iswestija“-Re-dakteur Poljanow und den Atomfachmann Professor Emeljanow entsenden.
Schon anläßlich einer solchen „privaten“ Diskussion, die im vergangenen Oktober in Moskau stattfand und an der unter anderen auch Leitartikler der „Prawda“ und der „Iswestija“ teilnahmen, ist uns aufgefallen, daß man auf sowjetischer Seite stark ein Europäertum betonte und die Gäste aus dem Westen mit einem „Wir sind alle Europäer“ begrüßte. Auch vom „Europa bis zum Ural“ wurde gesprochen.
„Europa bis zum Ural“ — das ist bekanntlich auch de Gaulies Zukunftsvision, und manches spricht dafür, daß die neue Annäherung zwischen Paris und Moskau an dem Erwachen eines russischen Europabewußtseins keineswegs unbeteiligt ist. Moskau hat den Wert von de Gaulies stolzer Politik der Unabhängigkeit gegenüber den USA für seine eigene Außenpolitik erkannt. Hier liegt zweifellos einer der Hauptgründe für das sowjetische Interesse an „Europa“.
Aber es gibt auch noch andere Gründe. Im Weltkommunismus ist eine Zentrifugalkraft am Werk, gegen die Moskau machtlos ist und die es ihm immer mehr erschwert, die Politik der Staaten mit kommunistischen Regimes — und vor allem auch die kommunistischen Parteien in nichtkommunistischen Staaten — von einer Moskauer Zentrale aus zu dirigieren oder jedenfalls entscheidend zu bestimmen. Die Zeiten der Komintern sind wohl endgültig vorbei. Die Ursachen dieser Entwicklung zum „Polyzentris-mus“ liegen wesentlich im wachsenden nationalen Selbstbewußtsein der auch wirtschaftlich erstarkenden kommunistischen Staaten, in denen langsam auch Kräfte der nationalen Tradition wieder mächtig werden, sowie in den Auswirkungen des Konflikts zwischen Moskau und Peking, der die Position Moskaus Interkommunistisch schwächt. Eine wesentliche Ursache ist aber auch ganz einfach die Tatsache, daß das Reich des Kommunismus sich seit 1945 vergrößert hat. Solange es nur den „Sozialismus in einem Lande“ — der Sowjetunion — gab, hatten alle kommunistischen Parteien außerhalb dieses Landes den Charakter von Sekten, die auf Gedeih und Verderb auf die enge Zusammenarbeit mit Moskau, dem „roten Rom“, angewiesen waren. Große Nationalstaaten aber haben einen unvergleichlich stärkeren Selbständigkeitsdrang als Sekten, ganz abgesehen davon, daß die früher von Moskau ausgehende Strahlungskraft infolge der Ent-stalinisierung stark an Intensität
eingebüßt hat. Wohl oder übel muß Moskau deshalb für seine Beziehungen zu den erstarkenden und mündiger werdenden sogenannten „Satellitenstaaten“ — die ja schon heute keine eigentlichen Satelliten mehr sind — eine neue Formel suchen.
De Gaulles Vision eines „Europa bis zum Ural“ bietet sich da um so mehr als eine solche Formel an, als der Präsidentengeneral, dem ein Hang zum Mystischen eigen ist, es bisher wohlweislich unterlassen hat, zu sagen, wie er sich das konkret vorstellt. Das für Moskau Bestechende an dieser Formel ist einerseits der antiamerikanische Akzent, mit dem de Gaulles Zukunftseuropa versehen ist, und anderseits der Umstand, daß die Sowjetunion — zumindest bis zum Ural — selbst einem solchen Europa angehören würde.
Aber hier beginnt auch die Problematik dieser Formel. Zunächst kann man das eigentliche „Rußland“ — bis etwa zum Ural — doch unmöglich von der Sowjetunion abtrennen. Ein Europa, dem die Sowjetunion nur bis zum Ural angehört, ist ein Phantasiegebilde, das nach menschlichem Ermessen keine Aussicht hat, je verwirklicht werden zu können.
Die Formel vom „Europa bis zum Ural“ ist deshalb eine politische Fata Morgana, die nur sinnverwirrend wirkt und die Aufmerksamkeit von der wirklichen europäischen Problematik ablenkt. Wenn von Europa als möglicher politischer Einheit die Rede ist, dann kann es sich nur um ein Europa handeln, dessen östliche Grenze die Grenze zwischen der Sowjetunion und den Staaten Osteuropas ist. Und das heißt um ein Europa ohne die Sowjetunion. Sollten die Russen nun, wie dies schon Ilja Ehrenburg in der erwähnten Moskauer Diskussion im Oktober getan hat, geltend machen, daß Rußland doch auf eine europäische Tradition zurückblicke und außerdem immer wieder in den von Europa angezettelten Kriegen seinen Blutzoll entrichtet habe, so daß man es doch unmöglich von Europa ausschließen könne, dann müßte man darauf antworten, daß ähnliches auch für die USA gilt.
Moskau muß deshalb, wenn es sich wirklich ernsthaft Gedanken über „Europa“ macht, sich von Anfang an dessen bewußt sein, daß es für jede echte europäische Lösung einen Preis zu bezahlen haben würde: den Preis, selbst außerhalb Europas zu bleiben. Und erst dann wird man sich in Westeuropa davon überzeugen lassen, daß Moskau ernsthaft eine Lösung der Europafrage anstrebt, wenn man den Eindruck gewinnt, daß es bereit ist, diesen Preis zu bezahlen.
An die Möglichkeit eines Umsturzes in Osteuropa zu glauben oder gar die Zustimmung zur „Konterrevolution“ als Preis von Moskau zu fordern wäre jedenfalls völlig irreal. Auch Warschaupakt und Comecon müßten unangetastet bleiben. Wenn überhaupt in absehbarer Zeit eine gesamteuropäische Zusammenarbeit möglich ist, dann gewiß nur — oder jedenfalls anfangs nur — in sehr lockerer Form. Der Preis, den Moskau bezahlen müßte, bestünde lediglich darin, den osteuropäischen Staaten im Rahmen der bestehenden Militärpakte, Wirtschaftsverträge usw. auf dem Gebiete der innereuropäischen Zusammenarbeit das Recht auf eine selbständige Politik zu gewähren. Im übrigen bahnt sich eine solche Entwicklung bereits an. Es gibt Kontakte zwischen dem Straßburger Europanat und gewissen osteuro-
päischen Staaten — ähnliches gilt für die EWG —, und falls der unselige Vietnamkonflikt den kalten Krieg nicht wieder aufleben läßt, dürfte die Frage einer Zusammenarbeit zwischen Osteuropa und Straßburg in absehbarer Zeit an Bedeutung gewinnen. Eine vorausblickende Politik Moskaus müßte einsehen, daß es klüger wäre, einer ohnehin sich anbahnenden Entwicklung den Weg zu ebnen, anstatt hinterdreinzuihinken. Und müßte einsehen, daß jede Europapolitik der Sowjetunion im Ansatz verfehlt wäre, würde man sie nur unter dem Aspekt des Machtkampfes gegen die oder des Wettbewerbs mit den USA sehen. Wenn Europapolitik einen Sinn hat, dann nur den, aus Europa einen im Rahmen des Möglichen selbständigen politischen Faktor zu machen, dessen Hauptaufgabe es wäre, weltpolitisch ein Stabilisie-rungs- und Friedensfaktor zu sein. Daß dabei noch lange Westeuropa wesentlich auf die USA und Osteuropa wesentlich auf die Sowjetunion ausgerichtet blieben, ist eine Selbstverständlichkeit, die man akzeptieren muß, ob es einem paßt oder nicht.
Genau dasselbe gilt aber auch für die amerikanische Politik. Es werden heute Stimmen laut, wie diejenige etwa des amerikanischen Politologen Brzezinski von der Columbia-Universität, die von den Amerikanern eine positivere Einstellung zu Osteuropa, vermehrte Wirtschaftshilfe, ja sogar eine Art Marshall-Plan für Osteuropa fordern, mit dem erklärten Ziel, Osteuropa langsam von der Sowjetunion zu lösen. Gewiß kann es keine gesamteuropäische Zusammenarbeit ohne eine Lockerung der Beziehungen zwischen Osteuropa und der Sowjetunion geben. Aber solange die westliche Europapolitik einen betont antisowjetischen Akzent trägt und ihrerseits nur im Dienste des Machtkampfes zwischen Ost und West steht, solange ist auch sie im Ansatz verfehlt. Eine solche Europapolitik ist zweifellos nicht geeignet,
in Moskau die Bereitschaft zu fördern, um einer neuen europäischen Ordnung willen einen Preis bezahlen zu müssen. Das Ziel jeder wahren Europapolitik kann nur sein, Europa langsam aus dem Spannungsfeld des Ost-West-Kon-flikts herauszunehmen. Das erscheint einer realistischen Betrachtungsweise auch als die einzige Möglichkeit, in der deutschen Frage einen Schritt weiterzukommen. Bei alledem darf auch nicht übersehen werden, daß sich sowohl der Osten wie auch der Westen in einem Wandlungsprozeß befinden. Der Gedanke an die Möglichkeit einer gewissen gesamteuropäischen Zusammenarbeit erscheint heute, dank dieser Wandlungen, weit weniger utopisch als noch vor einigen Jahren. Umgekehrt könnte eine solche Zusammenarbeit, so locker sie im Anfang auch wäre, auch diesen inneren Wandlungsprozeß positiv beeinflussen. Im Westen etwa im Sinne der Umstellung von einem vorwiegend von militärpolitischen Überlegungen bestimmten außenpolitischen Denken auf eine Konzeption, die Sicherheit mehr in Maßnahmen der Rüstungsbeschränkung und der „Institutionalisierung des Friedens“ sucht. Im Osten etwa im Sinne der Schaffung einer liberalen Atmosphäre, der Erleichterung der Ausreisemöglichkeiten usw.
Weder Kommunismus noch Kapitalismus sind heute noch, was sie bis vor kurzem waren. Der Berliner Politologe Professor Ossip K. Flechtheim hat in seinem jüngsten Buch über „Weltkommunismus im Wandel“ sogar die kühne Prophezeiung gewagt: „Welthistorisch gesehen stellen westlicher Kapitalismus und östlicher Bolschewismus bereits heute antiquierte Übergangsstrukturen dar, die unser Jahrhundert kaum überdauern werden.“ Der Grad an Wahrheitsgehalt dieser Prophezeiung wird sich unter anderem daran messen lassen, ob es nun gelingt, uns im eigenen europäischen Haus wieder über eine einigermaßen vernünftige Hausordnung zu einigen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!