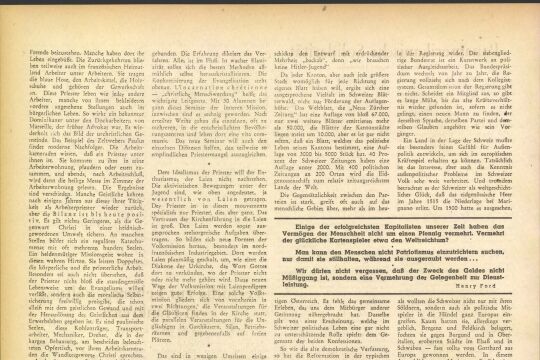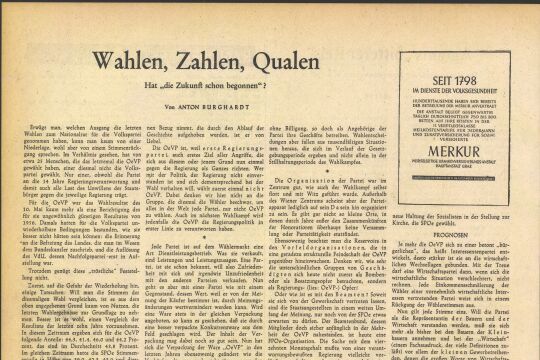Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Föhn und der Neid
Der geistvolle, allzu früh verstorbene Bundesrat Dr. Markus Feldmann hat mit Blick auf das Persönlich-Allzupersönliche in der schweizerischen Politik einmal gesagt: „Zwei Dinge setzen dem Schweizer besonders zu: der Föhn und der Neid.“ Der Neid hat in der Parteipolitik eine typisch schweizerische Entsprechung, die man als „ZTeid- Motiv“ bezeichnen kann. Der englische Journalist R. A. Langford, Verfasser eines erfrischenden Büchleins über Schweizer Eigen- und Unarten, hat das so formuliert: „ ,Z'leid' ist das Leitmotiv der schweizerischen Parteipolitik. Ein großer Unterschied besteht jedoch in dieser Hinsicht zwischen der Schweiz und
den meisten anderen Staaten: Hier wird der eigentliche Parteikampf ausgefochten auf den niedrigen Ebenen, dort, wo er auch hingehört; er klingt immer mehr ab, je näher er der Spitze der eidgenössischen Pyramide kommt. Ganz oben herrscht, wenigstens nach außen, eine wunderbare, geheimnisvolle Stille.“
Lieber schöner leben als kämpfen
Die parteipolitischen Aufmachungen der letzten Zeit in dem Land, das der Wiener Schriftsteller Hans Weigel einmal das „unfreiwillige Paradies“ genannt hat, scheinen Langford recht zu geben: auf je höherer Ebene die Wahlkämpfe ausgefochten werden, desto zahmer geht es dabei zu und her. Allerdings weniger deswegen, weil die Parteisekretäre keine Freude am Kampf und keine Lust zum Angriff verspüren würden, sondern ganz einfach deswegen, weil ihre Anhänger selber den parteipolitischen Fehden und den homerischen Redeschlach-
ten keinen Geschmack mehr abgewinnen. Konjunktur und Wohlfahrtsstaat haben den Eidgenossen viel von ihrer politischen Robustheit und Streitbarkeit genommen. Der von der Duttweiler-Partei für den Wahlkampf von 1959 geprägte Werbeslogan „Schöner leben“ entspricht der seelischen Lage des Wohlstandsbürgers von heute besser als der Appell an die weltanschaulichen Grund- und Gegensätze, die auch in Helvetien im Zeitalter der Ökumene sich abzuschleifen scheinen — wiewohl gerade Auseinandersetzungen wie die gegenwärtige über Hoch- huths „Stellvertreter“ selbst den ironischesten Gemütern bewußt machen, daß die Antagonismen unter
der friedlich-flauen Oberfläche doch noch wirksam und real sind. Trotzdem ist nicht zu bestreiten, daß die Sozialdemokratie mit zunehmender Ausbreitung des Wohlstandes in der Arbeiterschaft verbürgerlicht, daß der Liberalismus mindestens aus taktischen Motiven nun immer ungenierter ebenfalls für „christliche Grundsätze in der Politik“ eintritt und daß in den Reihen der Konservativen und Christlich-Sozialen das konfessionelle Element in dem Maß an Bedeutung verliert, als die anderen den Katholiken jene Toleranz endlich zugestehen, die in den katholischen Kantonen den Protestanten schon seit vielen Jahrzehnten gewährt wird. Es ist irgendwie kennzeichnend für die veränderte Situation, daß heute praktisch alle Parteien mindestens offiziell für die Aufhebung jener antikatholischen Ausnahmeartikel der Bundesverfassung eintreten, deren Bekämpfung bis in die allerjüngste Vergangenheit das Vorrecht der Konservativen war.
Nur keine Grundsatzdebatten
Alles das und manches andere ist dazu angetan, den Sinn und Zweck homerischer politischer Kämpfe in Frage zu stellen. Der Durchschnittsbürger stellt fest, daß die Toleranz in allen Lagern in dem gleichen Maß wächst wie die Gegensätze sich zu bloßen Unterschieden abschwächen. Gleichzeitig macht er die Beobachtung, daß es ihm materiell recht gut geht unter dem Regime des von allen großen Parteien verantworteten Wohlfahrtsstaates. Un
ter solchen Bedingungen ist es nur verständlich, daß er für grundsätzliche Auseinandersetzungen weniger ansprechbar ist als für die Versprechen jener, die ihm ein noch etwas größeres und süßeres Stück am Konjunkturkuchen in Aussicht stellen, wenn er ihnen die Stimme gibt.
Flau, flauer, am flauesten — Stabil, stabiler, am stabilsten
In den letzten drei Wahlgängen für die Bestellung des eidgenössi
schen Parlaments ist die Anteilnahme des Durchschnittsbürgers von Fall zu Fall geringer, die Wahlwerbung der Parteien von einem Male zum anderen manierlicher, die Wahlbeteiligung kleiner und die Verschiebung in den parteipolitischen Kräfteverhältnissen geringer geworden. Was wir in unserer Vorschau auf die National- und Ständeratswahlen vom letzten Oktobersonntag in diesem Blatt ohne jede Gefahr, durch die Wahlresultate desavouiert zu werden, prophezeien konnten, ist eingetreten: Die Veränderungen im Kräfteverhältnis der Fraktionen sind fast bedeutungslos, und die von den großen Parteien erzielten Wählerstimmen sind praktisch gleichgeblieben wie 1959. Die Sozialdemokratie hat in den Wahlen zum Nationalrat einen bescheidenen Fortschritt an Stimmen und Mandaten (2) erzielt, die Konservativen buchen einen einzigen Mandatgewinn, die Freisinnigen bleiben bei
einem minimalen Stimmengewinn mandatsmäßig stationär, während alle kleineren Parteien einen leichten Rückgang ihres Anhanges feststellen müssen. Als nicht minder
widerstandsfähig gegen Umschichtungen erwies sich der Ständerat, in den jeder Kanton zwei Vertreter und jeder Halbkanton einen Mandatar abordnet. Dank Wahlallianzen der bürgerlichen Parteien in manchen Kantonen war in den letzten Jahren die sozialdemokratische Fraktion der zweiten Kammer auf ein Duumvirat reduziert worden. Nun hatten die Sozialisten zum Generalsturm in neun von den 14 Kantonen, in denen die Ständeratswahlen gleichzeitig mit den Nationalratswahlen stattfanden, geblasen. Das Resultat ist mager genug: dank eines einzigen Wahlerfolges kehren sie jetzt mit einem Triumvirat in die Ständekammer zurück. Summa summarum bestätigen also auch die Auseinandersetzungen um die Ständeratssitze die Feststellung, daß die Stabilität und parteipolitische Konstanz in der Schweiz in den eidgenössischen Wahlen 1963 bestätigt, ja bis zur parteipolitischen Erstarrung vorangetrieben worden ist
Gefahren der politischen Gleichgültigkeit
Von „Z'leidwercherei“ als Leitmotiv helvetischer Wahlen war da überhaupt kaum noch etwas zu spüren, aber kaum deswegen, weil die Schweizer Politiker einen an Heiligkeit grenzenden Grad der menschlichen Friedfertigkeit erreicht hätten, sondern ganz einfach deswegen, weil der Konjunkturbürger dafür keinen Sinn mehr hat und weil die Jagd nach dem Geld das Verantwortungsbewußtsein für Grundsätze nicht eben begünstigt. Die Wahlbeteiligung ist denn auch weiter zurückgegangen — eine Erscheinung, die auch dieses Mal wieder in allen Kommentaren zutiefst bedauert wurde, ohne daß jemand sich ernsthaft darum bemühen würde, nach wirksamer Abhilfe zu suchen. Politiker und Parteien gehen achselzuckend zur Tagesordnung über. Dabei werden die Gefahren der politischen Gleichgültigkeit noch akzentuiert durch eine Erscheinung, die in diesen Wahlen noch deutlicher in Erscheinung getreten ist als schon 1959; wir meinen eine aufdringliche Art von Gruppen- und persönlicher Wahlwerbung, die bei manchem „unpolitischen Bürger“ verfängt,
sofern sie es versteht, ihn auf seine materiellen Interessen anzusprechen.
Lobby statt Hobby
Man hat als hervorstechendes Merkmal der Oktoberwahlen die Tatsache genannt, daß nicht mehr die Propaganda für Ideale und Parteiprogramme und nicht mehr die Auseinandersetzung um Prinzipien dem Wahlkampf den Stempel aufgedrückt haben, sondern die innerparteilichen Kämpfe unter den rivalisierenden Interessengruppen und die Wahlwerbung für und mit einzelnen Kandidaten. Die Persönlichkeit sei, so heißt es jetzt etwa, im Begriff, den Parteien den Rang abzulaufen. Ja, es gibt sogar Leute, die darin einen Fortschritt, nämlich eine Neubelebung der Persönlichkeitswerte im Staat, eine Neuentdeckung der persönlichen Leistung, ja sogar ein antikollektivistisches Element erblicken wollen. Das ist nach der Meinung des Schreibenden eine falsche Behauptung, die das Negative der Erscheinung geflissentlich übersieht. In Tat und Wahrheit wurden nämlich gerade die Ausein
andersetzungen innerhalb der Parteien für und wider einzelne Kandidaten zum guten Teil mit dem Appell an Instinkte geführt; einerseits wurde versucht, profilierte Persön-
lichkeiten dadurch unmöglich zu machen, daß man ihnen mutige Stellungnahmen und unabhängige Urteile verübelte. Es wurden Hexenjagden gegen Kandidaten veranstaltet, die in ihren Entscheiden das Gesamtwohl vor Gruppeninteressen gestellt hatten. Anderseits rechnete man dem Bürger bei der Empfehlung von Gruppenexponenten vor, wie sehr diese sich für den sacro egoismo ihrer Wählergruppe immer wieder „aufgerieben“ haben.
Ein neuer Typus
Bei solchen Tendenzen der Manager und Wähler verwundert es nicht, wenn die eigenwilligen, unabhängigen Köpfe, welche die Politik als ein edles Hobby oder gar aus Leidenschaft für den Staat betreiben, seltener werden im Berner Parlament, und an ihre Stelle Parlamentarier treten, die statt dem Ganzen den Lobbyisten verpflichtet sind. Es gibt unter ihnen Managertypen, von denen die einzelnen aus Geltungssucht und hemmungslosem Erfolgsstreben, andere im Dienst ihrer Firma, einen Aufwand an persönlicher Propaganda betrieben haben, der nur zu deutlich ihre und ihrer Hintermänner Überzeugung dartut, daß mit einem entsprechenden Propaganda- und Finanzaufwand sich eine Wahl erzwingen lasse.
Im einen Fall war die Methode erfolgreich, in einem anderen Fall haben mutige Männer durch eine rechtzeitige Aufklärung der Bürgerschaft dafür gesorgt, daß nicht das Geld über den Geist triumphieren konnte. Zudem hat es sich tröstlicherweise erwiesen, daß derartige legale Mißbräuche der Demokratie sich auf die Dauer nicht bezahlt machen: ein 1959 durch eine schamlose Eigenpropaganda ins Parlament gelangter Auch-Politiker ist dieses Mal von den Wählern mit Glanz und Gloria wieder aus dem Nationalratssaal hinauskomplimentiert worden. Der Schweizer ist von Haus aus gutmütig. Es passiert ihm daher gelegentlich, daß er übertölpelt wird. Aber er hat ein gutes Gedächtnis. Darum läßt er sich jeweils kein zweites Mal übers Ohr hauen. Am allerwenigsten von Lobbyisten, welche als Volksfreunde daherkommen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!