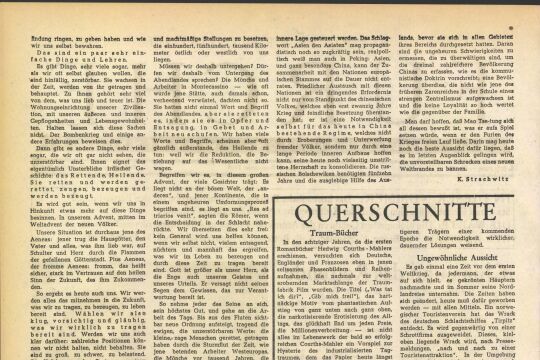Die Ära der humanitären Interventionen geht zu Ende. Den Preis zahlen die Bewohner von Konfliktgebieten, analysiert Eric Gujer in der NZZ.
Rette sich, wer kann, lautet inzwischen der heimliche Wahlspruch der westlichen Afghanistanpolitik. Präsident Obama hat mit der Ankündigung, der amerikanische Truppenabzug werde im Sommer nächsten Jahres beginnen, ein Datum genannt, das eine ganz eigene Sogkraft entwickelt. Ob Obama mehr im Sinn hat als einen symbolischen Einstieg in den Ausstieg, spielt da fast keine Rolle mehr. Eine internationale Geberkonferenz forderte bereits, die Regierung in Kabul müsse bis zum Jahr 2014 selbst für die Sicherheit des Landes sorgen. In Berlin und anderen europäischen Regierungen gilt der Feldzug am Hindukusch unterdessen als ein Abenteuer, das man besser nie begonnen hätte. Offiziell werden Durchhalteparolen verbreitet, doch zugleich heisst es, der Krieg sei nicht zu gewinnen. […] Ohnehin geht es längst nicht mehr nur um Afghanistan. Eine Zeitströmung, die nach dem Kalten Krieg ihren Ausgang nahm und sich wesentlich aus der Euphorie über den Untergang des Kommunismus speiste, neigt sich dem Ende entgegen. In den frühen neunziger Jahren begann die Ära der humanitären Interventionen, die nicht mehr machtpolitisch begründet wurden, sondern moralisch. […]
Die Verantwortung zu schützen degeneriert …
Immer mehr Stimmen verlangten Anfang des neuen Jahrtausends, die internationale Gemeinschaft müsse eingreifen, sobald ein Staat fundamentale Lebensrechte seiner Bürger verletze. Schützte das Völkerrecht einst staatliche Rechte wie die nationale Souveränität, gewannen im Zuge der Individualisierung in den Industriestaaten die Rechte des Einzelnen an Bedeutung. Man konstruierte eine „Verantwortung zu schützen“ (responsibility to protect) oder gar die ausdrückliche Pflicht hierzu. Uno und Nato galten als eine Art Weltpolizei, und solange dies einem guten Zweck diente, sah darin kaum jemand etwas Verwerfliches.
Die politische Linke, die in den Jahrzehnten zuvor jeden Eingriff in die Eigenständigkeit von Entwicklungsländern als Neokolonialismus gebrandmarkt hatte, trat besonders engagiert für die neuen Prinzipien ein. […] In diesem missionarischen Eifer war die europäische Mitte-Links-Öffentlichkeit ironischerweise ihrem Intimfeind George W. Bush recht ähnlich, der seinen Irakkrieg unter anderem mit der Notwendigkeit begründete, die arabische Welt zu demokratisieren.
… zum Recht wegzusehen und nicht zu helfen
Der Irakkrieg und der von einer überschaubaren Mission zum scheinbar endlosen Krieg mutierte Feldzug in Afghanistan haben die Stimmung kippen lassen. Nicht nur die Wähler, auch die politischen Eliten sind gegenüber militärischen Einsätzen im Ausland skeptisch geworden. […]
Man kann diese Entwicklung mit dem positiven Etikett „neuer Realismus“ versehen. Doch dieser Realismus hat einen Preis, den die Völker in den Konfliktgebieten Afrikas und Asiens zahlen. […] Neue Konflikte werden entstehen und nach Antworten verlangen. So wird sich im nächsten Jahr voraussichtlich der Südsudan vom Norden abspalten. Dies beschwört die Gefahr eines Sezessionskrieges herauf. Doch selbst wenn der Norden ein solches Referendumsergebnis akzeptiert, benötigt der junge Staat Hilfe, damit er nicht auf der Liste der gescheiterten Staaten landet und zur Brutstätte der Gewalt wird. In beiden Fällen ist ein Eingreifen der internationalen Gemeinschaft erforderlich. In den westlichen Hauptstädten hält sich aber die Bereitschaft hierzu in Grenzen. Die „responsibility to protect“ degeneriert zum Recht, wegzusehen und nicht zu helfen. Der neue Realismus ist auch ein neuer Egoismus.
* Neue Zürcher Zeitung, 24. Juli 2010
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!