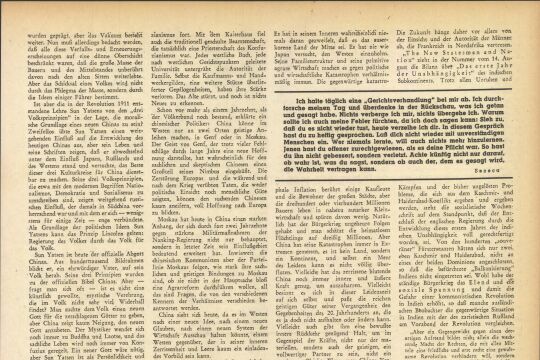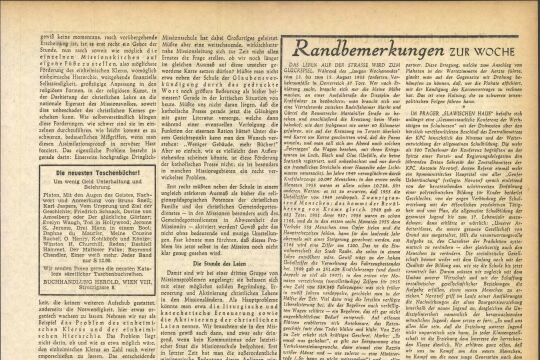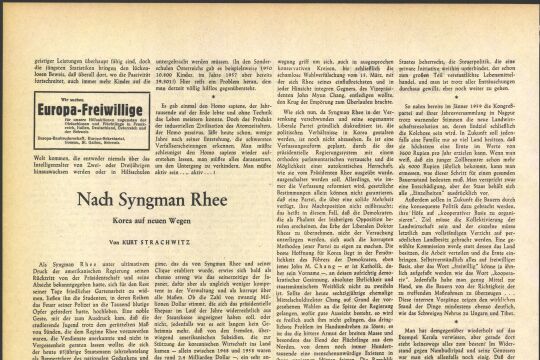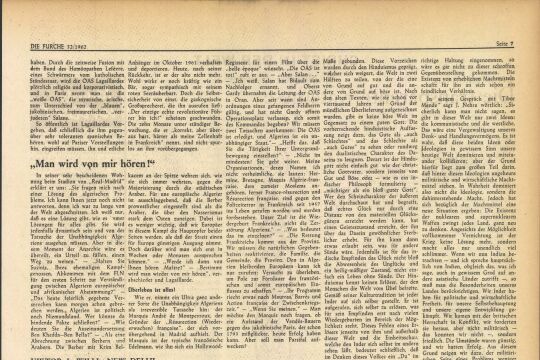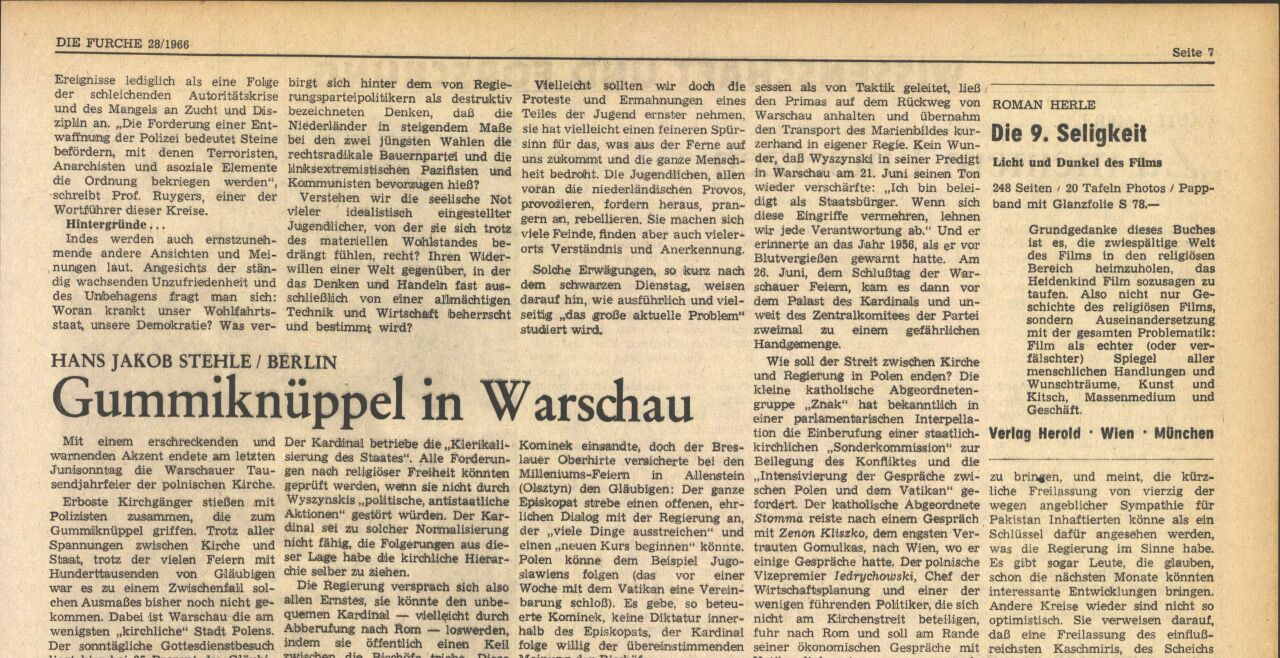
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Des Vaters Tochter
Sie ist sicher ihrem Vater viel ähnlicher als Shastri, besitzt einen starken Willen und hält als Ministerpräsidentin eine erhebliche Machtfülle in ihrer Hand. Ihr fehlt die politische und verwaltungstechnische Vergangenheit eines Shastri. Sie mag ihrer Aufgabe gewachsen sein, aber sie hat es noch zu beweisen. Für sich als Kapital hat sie, daß sie ihres Vaters Tochter ist. Nehrus Name bedeutet noch immer sehr viel in der indischen Öffentlichkeit. Sie ist ein religiös ungebundener Geist wie ihr Vater, was für das Vertrauen der 50 Millionen zählenden muselmanischen Minderheit ungemein wichtig ist. Sie steht nicht fanatisch für Hindi als Landessprache ein, was sie den Südindem sympathisch macht; sie teilt ihres Vaters Haßliebe für Großbritannien, besitzt eine Neigung für Moskau und wird ideologisch in die Linke eingestuft. Man sagt, Krishna Menon, der durch den chinesischen Angriff im Jahre 1962 gestürzte Verteidigungsminister, sei ihr einmal nahegestanden. Diese Umstände haben den Verdacht auf- kommen lassen, sie werde die ersten behutsamen Maßnahmen für eine Liberalisierung der Wirtschaftspolitik ihres Vorgängers wieder rückgängig machen. Ihre größten Schwierigkeiten, einmal abgesehen von denen, die heute jedem indischen Ministerpräsidenten vertraut sind, werden wahrscheinlich aus der Partei selbst auf sie zukommen. Ihr Gegner Desai erhielt bei der Wahl überraschend viele Stimmen und wird kaum bereit sein, den Wettlauf um die einfluß-
reichste Stellung im Staate aufzugeben. Die Glückwünsche und Versprechen uneingeschränkter Unterstützung nach der Wahl, die man in politischen Kreisen als einen Sieg der Parteimaschine bezeichnet, die der Präsident Kamaraj überaus geschickt handhabte, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Gegner Frau Gandhis, mit Desai an der Spitze, bei jeder sich bietenden Gelegenheit der Regierung eine harte Opposition entgegenstellen werden.
Die Linke draußen
Immerhin läßt die Zusammensetzung der Regierung Indira Gandhi deutlich erkennen, daß alles getan wurde, um heftige Auseinandersetzungen innerhalb der Kongreßpartei im Jahre vor den Wahlen zu vermeiden. Es kam nur zu wenigen Neubesetzungen, und der Präsident griff selbst ein, um die in heftigem Streit liegenden Gruppen und die von ihnen geltend gemachten Forderungen in Einklang zu bringen. Nun ist die Regierungsbildung in Indien stets ein schwieriges Geschäft gewesen; während aber Nehru stets darauf sah, ein ideologisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, bleibt jetzt die Link;e außerhalb der Regierung, und wie politische Beobachter glauben, gibt es kaum Anzeichen für ihre Rückkehr. Frau Gandhi selbst hat sich für den Augenblick gegenüber der Parteileitung als nachgiebig erwiesen. Aber es ist kaum anzunehmen, daß sich diese gescheite Frau für lange hin- und herschieben lassen wird, mag sie auch die allge meine Auffassung teilen, daß im Hinblick auf die Wahlen und die schwere Krise, die das Land durchmacht, innere Auseinandersetzungen vorläufig einmal vertagt werden sollen.
Das ist verständlich, denn trotz ihrer Mitgliederzahl — auf dem kürzlichen Parteitag in Jaipur wurde sie mit nicht weniger als 17,3 Millionen angegeben — steht die Kon- greßpantei nicht gerade auf starken Füßen. Ihre Organisation ist man gelhaft, viele ihrer Mitglieder sind kaum mehr als Mitläufer und Konjunkturritter, und böse Zungen behaupten sogar, das einzige, was in der Kongreßpartei wirklich gut funktioniere, sei die Wahlmaschine.
Die innenpolitische Lage ist reichlich gespannt. Das Übereinkommen mit Pakistan vom Anfang Februar, die militärischen Einheiten in Kaschmir auf die Zahlen von 1949 zurückzuführen, hat die Öffentlichkeit überrascht, und die Regierung war gezwungen, den heftigen Protest des Parlaments, das geltend machte, im Dunkeln gelassen worden zu sein, mit der simplen Erklärung zu beantworten, das Abkommen enthalte nichts Neues. Immerhin impliziert jedoch nach der Ansicht nicht weniger Politiker diese Verringerung eine indische Bereitschaft zu einer neuen Haltung gegenüber dem Kaschmir-Problem. Zweifellos stützte sich der Anspruch Indiens in den vergangenen Jahren mehr und mehr auf die in Kaschmir stehenden Divisionen. Man hält es nun für durchaus möglich, daß die indische Regierung versuchen wird, ein neues Gespräch auf einer anderen Grundlage mit den leitenden kaschmirischen Politikern in Gang zu bringen, und meint, die kürz- liche Freilassung von vierzig der wegen angeblicher Sympathie für Pakistan Inhaftierten könne als ein Schlüssel dafür angesehen werden, was die Regierung im Sinne habe. Es gibt sogar Leute, die glauben, schon die nächsten Monate könnten interessante Entwicklungen bringen. Andere Kreise wieder sind nicht so optimistisch. Sie verweisen darauf, daß eine Freilassung des einflußreichsten Kaschmiris, des Scheichs Abdullah, der bisher stets auf dem Selbstbestimmungsrecht bestanden hat, nur dann in Frage komme, wenn er sich mit dem Verbleib Kaschmirs im indischen Staatsverband einverstanden erklären würde. Erst dann könne die indische Regierung an die Neubildung eines Kaschmirstaates mit weitgehender innerer Autonomie ernstlich denken. Nach der Ansicht dieser Leute kann jedoch der Weg bis dahin noch ziemlich lang sein.
Hunger, Hunger!
Aber Kaschmir ist für die Regierung heute ebensowenig vordringlich wie das Abkommen von Taschkent, mag auch gerade dieses von der Bevölkerung ziemlich schlecht aufgenommen worden sein. Viel wichtiger ist die Lebensmittelnot, die langsam zu einem ernsten innenpolitischen Problem geworden ist. Die hungernden Manifestanten haben in Bengalen und in Kerala den militärischen Einsatz notwendig gemacht. Gerade in Kerala läßt sich feststellen, daß die Opposition versucht, politisches Kapital aus der Massennot im Jahre vor der Wahl herauszuschlagen. In Kerala hatten sich die Kommunisten als stark genug erwiesen, um die Kongreßpartei an der Regierungsbildung zu hindern. Ihr Vorwurf, die Kongreßpartei, was unter den gegenwärtigen Umständen nichts anderes bedeutet als die Zentralregierung und die Regierungen der einzelnen Staaten, trage allein die Schuld daran, daß der Nahrungsmittelmangel nicht überall in derselben Weise spürbar sei, hat inzwischen Schule gemacht und breite Zustimmung in allen Notstandsgebieten gefunden.
In Westbengalen, einem anderen Gebiet, das vor einem Monat durch ein Blutbad ging, mußte die Zentralregierung eingreifen, um einen prekären Frieden zwischen der lokalen Regierung und der Bevölkerung zu stiften. Hier Wie überall staut der Hunger den Ärger über die Regierung auf. Indira Gandhi eilte nach Kalkutta, um sich für eine Zusammenarbeit mit der Opposition bei dem bengalischen Chefminister einzusetzen, der sich jedoch widersetzte, bis die Lage so bedrohlich wurde, daß der Staat bewaffnete Hilfe in Delhi erbitten mußte.
Die Tochter Nehrus hat die Regie- rungsgeschäfte in einem Augenblick übernommen, in dem nicht die Erfolge, sondern die Folgen der Politik ihres Vaters schmerzlich spürbar geworden sind. Indien muß heute teuer bezahlen, daß die Industrialisierung auf Kosten der Landwirtschaft vorangetrieben wurde. Das Indien, das Nehru einmal vorschwebte, gibt es nicht mehr oder gibt es noch nicht. Die inneren Probleme lassen sich nicht mehr durch einen außenpolitischen Schein über- tünchen. Die Zeit, in der Indien glaubte, Vermittler zwischen Westen und Osten sein zu können, ist dahin. Das hindert indes nicht, daß dieses Land, das sich zu der Regierungsform der westlichen Demokratie als einziger asiatischer Staat außer Japan bekennt, Sympathie und Hilfe durchaus verdient.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!