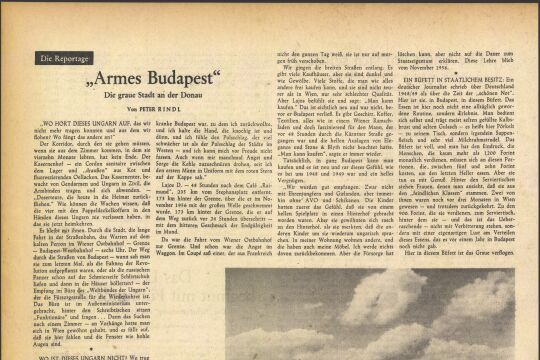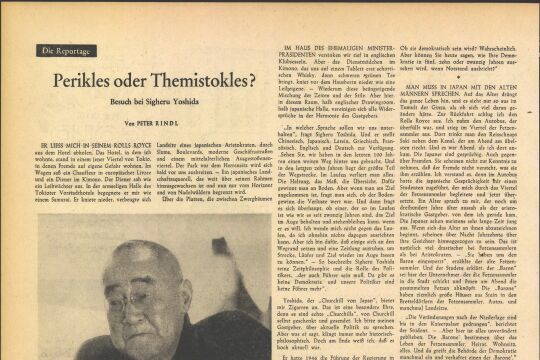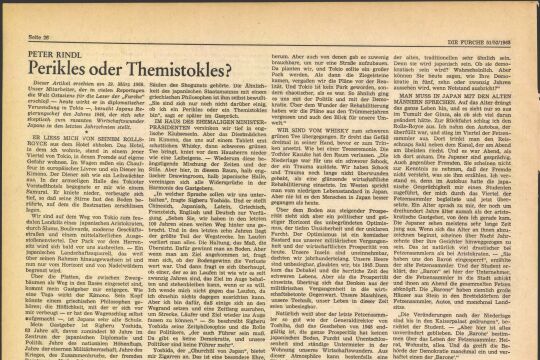Endstation Bahnhof Shinjuku
Japan sieht sich mit einem neuen Problem konfrontiert: Tausende Obdachlose bevölkern Bahnhöfe, U-Bahnstationen und Parks. Versorgt werden sie vorwiegend von der christlichen Minderheit des Landes.
Japan sieht sich mit einem neuen Problem konfrontiert: Tausende Obdachlose bevölkern Bahnhöfe, U-Bahnstationen und Parks. Versorgt werden sie vorwiegend von der christlichen Minderheit des Landes.
An einem Zeitungskiosk am Bahnhof Shinjuku beginnt die Verkäuferin ein Gespräch. "Merken Sie, wie es hier stinkt?", fragt sie und deutet auf einen unrasierten alten Mann mit Plastiksäcken in den Händen, der vorbeischlurft. "Was glauben Sie, wie es ist, wenn ich morgens hier aufsperre - überall liegen Leute auf dem Boden und schlafen!" Shinjuku ist der größte Bahnhof Japans.
Rund eine Million Menschen kommt täglich hier durch. Das Gewirr unterirdischer Gänge führt bis knapp vor das Rathaus der Stadt Tokyo von Stararchitekt Kenzo Tange. Gleich hinter einem der Luxushotels beginnt ein großer Park. Eine riesige Menschenmenge steht dort und scheint auf irgend etwas zu warten.
Wie jeden Samstag hält um halb neun ein unauffälliger, beige-farbener Kleinbus am Parkrand. Zwei Männer und zwei Frauen steigen aus, entladen Kartons und bauen in Windeseile im Park eine Suppenküche auf. Die mediale Aufmerksamkeit ist ihnen gar nicht angenehm - kommen sie doch von einem amerikanischen Militärstützpunkt. Daß Angehörige der in Japan stationierten amerikanischen Airforce - immerhin die Nachkommen der ehemaligen Sieger- und Besatzungsmacht - japanische Obdachlose mit Suppen aus der Armeeküche versorgen, entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie. "Wir müssen mit politischer Vorsicht agieren", meint denn auch eine der Helferinnen. Und fügt eilig hinzu, daß sie mit dem amerikanischen Militiär ohnehin nichts zu tun hätten. Vielmehr rekrutierten sich die Freiwilligen aus den diversen christlichen Kirchen, die es am Stützpunkt gebe.
In geordneten Dreierreihen haben sich die Männer mittlerweile zu einer langen Schlange formiert, deren Ende kaum zu sehen ist. "Vergangenen Samstag waren es 300", sagen die Helfer. Sie fassen einander zu einem kurzen Gebet an den Händen, ehe sie mit der Verteilung beginnen. Für jeden einen Teller Suppe, Brot, eine Banane, ein Säckchen Erdnüsse. Dazu ein fröhliches Ohayo gozaimasu, Good Morning - Guten Morgen. Zweimal im Jahr lassen die japanische Behörden die Zahl jener Menschen erheben, die in Parks, auf Bahnhöfen, entlang von Flüssen und Straßen leben. Die jüngste Zählung ergab 8.000 in Osaka, 4.300 im Stadtzentrum von Tokyo, und damit doppelt soviel wie noch vor zwei, drei Jahren. Zahlen, die der junge Amerikaner Charles Mc Jilton für stark unterschätzt hält. Der Katholik sieht es seit einigen Jahren als seine Mission, den Obdachlosen von Tokyo zu helfen. Er vermutet, daß in Tokyo längst mehr als 10.000 auf der Straße leben. Landeten vor ein paar Jahren noch vor allem Tagelöhner, die keine Arbeit am Bau mehr finden konnten, auf der Straße, so kommen nun zunehmend Fabriksarbeiter, aber auch Verkäufer oder Büroangestellte hinzu.Wie viele es wirklich sind, weiß wohl niemand.
Japan befindet sich in der Rezession. Weniger als Folge der Asienkrise, denn als Folge der "Bubble Economy", die Ende der achtziger Jahre auf der Basis von Grundstückspekulationen und leichtfertig vergebenen Krediten zu einer Überhitzung der Wirtschaft geführt hatte. Die Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent ist zwar ein Wert, von dem viele andere Länder nur träumen können, doch Japan versetzen drei Millionen Arbeitslose einen Schock. Dabei lassen sich die offiziellen Zahlen nicht international vergleichen. Ökonomen schätzen die tatsächliche Arbeitslosigkeit auf rund zehn Prozent.
Das hohe Maß an Gleichheit innerhalb der japanischen Gesellschaft ist ein Bild, an dem Ausländer und Japaner gleichermaßen festhalten. Keine breite Oberschicht, kein Heer von Armen. Eine breite Mittelklasse. Daran habe sich durch die Rezession noch nichts geändert, und die Verantwortlichen würden auch alles daransetzen, dieses harmonische Bild auch in Zukunft aufrechtzuerhalten, meinen Beobachter der Gesellschaft. Manche fallen dennoch schon jetzt heraus. Im Park von Shinjuku fällt ein junger Mann auf, der nicht so recht dorthin passen will. Viele Obdachlose seien genauso ordentlich gekleidet wie er, meint er. Man sehe ihnen nicht an, wo und wie sie lebten. Er ist 32 und lebt seit zwei Jahren auf der Straße. Reguläre Arbeit hatte er nie. Als ihn seine Eltern vor die Türe setzten, verlor er den Halt. Jetzt wünscht er sich nichts mehr, als Arbeit und eine Wohnung. So wie andere hat auch er kaum Erwartungen an eine soziale Unterstützung durch den Staates.
Abseits der Obdachlosenansammlungen, die man nicht sehen muß, wenn man sie nicht sehen will, präsentiert sich Tokyo wie eh und je: als boomende und pulsierende Stadt. Scharen von Einkaufswütigen in den Straßen, das übliche Gewühl in den Kaufhäusern. Nach wie vor wird Golf gespielt, werden teure Auslandsreisen unternommen. Und auch Wirtschaftswissenschafter Tadao Kiyonari beruhigt: "Natürlich gibt es mehr Obdachlose als früher, aber die Zahlen sind nicht sprunghaft gestiegen. Vor zwei, drei Jahren sah man in Shinjuku viele, jetzt sind sie eher am Ufer des Sumidaflusses zu finden." Dort und im Armenviertel Sanya im Norden von Tokyo sind 14 private Hilfsorganisationen tätig. Die Gegend ist seit Jahren auch das Einsatzgebiet von Charles Mc Jilton. Er wollte ein Obdachlosenheim errichten, aber niemand wollte ihn unterstützen. Anfang 1997 zog er selbst für 15 Monate in ein Pappkartonhaus ans Flußufer - um die Menschen dort besser kennenzulernen. Neben Handtuch und Seife ermöglichte ihm sein Handy, den Schein nach außen zu wahren. Jeden Morgen zog er Anzug und Krawatte an und ging zur Arbeit.
Das Schlimmste seien die allmonatlichen Evakuierungen der Schachtelhäuser gewesen, erzählt er. Drei, vier Tage vorher komme eine Regierungsabordnung zum Flußufer und klebe an jedes Haus einen Zettel mit einer Nummer, auf dem stehe, daß man bis zum Stichtag sein Haus abgerissen haben müsse. Am Tag der Evakuierung breche also jeder sein Haus ab und schleppe all sein Hab und Gut auf eine Böschung. Pünktlich um neun Uhr dreißig sei die Beamtendelegation dann da und mache Fotos davon, daß nichts mehr da sei. Kaum seien sie abgezogen, fingen die Obdachlosen an, ihre Häuser wieder aufzubauen. "Ich nenne es das bürokratische Ballett", sagt Charles und kann dieser Art der Problembewältigung trotz aller Absurdität recht menschliche Züge abgewinnen: "Würde die Regierung die Männer wirklich vom Flußufer weghaben wollen, könnte sie doch jederzeit ohne Vorankündigung kommen!"
Weniger glimpflich verlief die Evakuierung der Obdachlosensiedlung am Bahnhof Shinjuku. Im Februar 1998 brach dort nämlich ein Brand aus, bei dem vier oder auch fünf Obdachlose, so genau scheint das niemand zu wissen, ums Leben kamen. Die Brandursache wurde nie untersucht.
Für die Behörden war der Brand ein willkommener Anlaß, den Bahnhof wieder einmal zu räumen. Seither sind die Nischen, in denen früher die Pappkartonhäuschen standen, mit Trennwänden aus Metall verbarrikadiert. Ein Wiederaufbau der Siedlung ist unmöglich geworden. Und die ehemaligen Bewohner müssen in der Umgebung herumvagabundieren. Einige von ihnen sitzen bei schönem Wetter auf dem Platz direkt vor dem noblen Rathaus - mit Blick auf die Bürokratenburg, dankbar vielleicht für die sauberen Toiletten dort, in denen sie sich waschen und rasieren können.
Der heute 60jährige Juro Miura lebte bis kurz vor dem Brand selbst in einem der Pappkartonhäuser am Bahnhof Shinjuku. Rund ein Jahr lang, so genau weiß er das heute nicht mehr. Bei dem Brand verlor er seinen besten Freund, einen Nachbarn in der Schachtelstadt. Über 20 Jahre lang war Miura Hochseefischer gewesen. Bis sein Körper nicht mehr mitmachte. Eine andere Arbeit fand er nicht.
Glück im Unglück war für ihn seine Tuberkulose. Im Krankenhaus lernte er Pater Shigemi kennen. Der nahm ihn bei sich auf und half ihm, einen Job zu finden. Jetzt putzt er und hilft dem Pater bei seiner "Shinjuku Action for Homeless", die hauptsächlich von Pater Shigemis karitativem Engagement getragen wird. Nebenbei gewinnt er immer wieder Seelen für seine kleine evangelische Kirche.
Der Pater gehört zu einer Minderheit. Nur ein halbes Prozent der japanischen Bevölkerung sind Christen. Die Kirche besteht im wesentlichen aus ein paar Stühlen und einem Pult im Kellerraum eines Bürogebäudes nahe dem Bahnhof Shinjuku.
Zum Gottesdienst finden sich immer einige Schäflein ein, die dem Pater verbunden sind. Ihre Schicksale sind symptomatisch für den Weg in die persönliche Krise. Zu alt für Arbeit, zu jung für eine staatliche Pension. Arbeitslosigkeit, Scheidung, Verlust der Wohnung, Endstation Bahnhof Shinjuku. Ohne Adresse könne man keine Arbeit suchen, kennt Pater Shigemi den Teufelskreis. Also borgt er seine eigene her oder bürgt für sie.
"Wir haben Hunger, aber wir verhungern nicht." Das ist der Tenor der Obdachlosen von Tokyo. Hunger ist kaum das größte Problem in einer Stadt, in der täglich 6.000 Tonnen an Eßbarem weggeworfen werden. Unterkünfte, Arbeit, Integration, das sind die eigentlichen Probleme, denen die Öffentlichkeit jedoch eher hilflos gegenüberzustehen scheint.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!