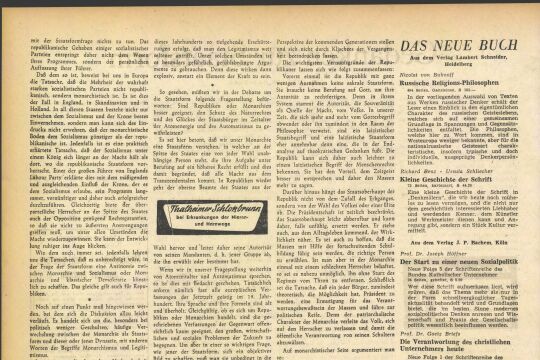Wer immer heute die Frage der Staatsform anschneidet, wird, zumindest in unserem deutschsprachigen Raum, sofort eine scharfe Kontroverse entfachen. Dies ist weitgehend eine Besonderheit Mitteleuropas. Denn weder in England noch in Amerika fällt es jemand ein, die dort herrschende monarchische oder republikanische Staatsform anzuzweifeln. In anderen Teilen Westeuropas wiederum ist es heute durchaus möglich, den ganzen Komplex zu besprechen, ohne sofort die Drohung mit der Polizei und maßlose Wutausbrüche gewärtigen zu müssen. In Frankreich kann jemand ruhig sich Monarchist und in Belgien Republikaner nennen, ohne darum sofort als Hochverräter gebrandmarkt zu werden.
Dieser merkwürdige Unterschied zwischen Mitteleuropa und anderen Teilen unseres Kontinents ist bezeichnend. Er ist leider ein Beweis dafür, daß bei uns gewissen Kreisen der Sinn für fair play und für sachliche politische Auseinandersetzung abgeht. In den angelsächsischen Ländern werden diese Eigenschaften als das
Wesentliche an dem wahren Demokraten bezeichnet.
In der Debatte um die Staatsform, wie sie nur zu oft bei uns in Presse und Parlament geführt wird, findet man selten eine vernünftige Beweisführung. Die Auseinandersetzung wird sozusagen ad hominem geführt. Man nimmt hierzu mit Vorliebe einige würdelose Gestalten auf Fürstenthronen, um mit ihnen alle Kronen zu identifizieren. Die Verteidiger der Monarchie übrigens sind nicht viel besser. Sie wiederum verweisen auf etliche korrupte Berufspolitiker, mit denen wir nur allzureichlich gesegnet sind, und behaupten, daß dies die zwangsläufige Folge der republikanischen Staatsform sei. Solche Argumente sind keineswegs schlüssig. Es hat gute und es hat schlechte Monarchen gegeben. Ebenso kennen wir, Republiken — wie die Schweiz —, in denen die schönsten Bürgertugenden gepflegt werden, während andere an dieses Vorbild nicht heranreichen.
Es ist eben so, daß jede Institution ihre Licht-und ihre Schattenseiten hat. Solange auf dieser Welt Menschen und nicht Engel leben, werden Fehler und Vergehen unausweichlich sein.
Neben allzu menschlichen Begleiterscheinungen der Staatsformen werden auch „historische“ Argumente angeführt, allerdings in einer Form, die, weil sie rein propagandistisch aufgezogen ist, die Tatsachen verfälscht und somit in einer wahrheitsuchenden Untersuchung keinen Platz hat.
Immer wieder betonen Republikaner, die
Monarchien seien ein Adelsregime. Es wird hierzu in der Regel das Beispiel mancher Reiche des vergangenen Jahrhunderts herangezogen und diese werden dann mit den Republiken des Jahres 1956 verglichen. Monarchisten wiederum weisen gerne auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Steuerlasten und die staatliche Einmischung in das Leben der Bürger in den Republiken der Gegenwart hin und loben die Freiheit und das wirtschaftliche Wohlergehen, welches in den Monarchien vor dem Jahr 1914 bestanden hat. Diese Argumente beider Seiten sind nicht überzeugend. Sie sind meist nichts als der alte propagandistische Kniff, Zustände ohne Hinweis auf vollkommen gewandelte Bedingungen zu vergleichen. Ernst und sachlich ist diese Art, eine Debatte zu führen, keineswegs. Denn eine ehrliche politische Studie kann bestenfalls Republiken der Gegenwart mit Monarchien von heute und vice versa einander gegenüberstellen. Diese Methode wird uns zeigen, daß es in den zeitgenössischen Monarchien ebensowenig Adelige von Geburt an führenden Stellen gibt wie in den Republiken und daß die schweren wirtschaftlichen Probleme der Gegenwart jeden Staat — welche immer seine Staatsform auch sein möge — in Mitleidenschaft ziehen.
Meist wird dann noch von Republikanern die Formel benützt, daß die Monarchien die Staatsform der Vergangenheit, die Republiken diejenige der Zukunft seien. Eine auch nur geringe Kenntnis der Geschichte widerlegt diese Behauptung. Seit urdenklichen Zeiten hat es stets beide Staatsformen gegeben. Allerdings haben in der zyklischen Bewegung der Geschichte die republikanischen Perioden meist wesentlich kürzer gedauert als jene, in denen Könige herrschten. Die beiden Staatsformen haben einander regelmäßig abgelöst. Es wäre jedenfalls falsch, von einer Staatsform als der allein gültigen für die Zukunft zu sprechen, wenn wir diese bereits im alten Griechenland, in Rom und Karthago finden.
Hier sei ein Umstand vermerkt, der allzuoft vergessen wird. Weder im politischen noch im sozialen und wirtschaftlichen Leben gibt es viele Neuerungen. Je mehr man die Geschichte studiert, um so eher kommt man zu dem Schluß, daß alles schon dagewesen ist. Wir beklagen uns heute z. B. über die allzu hohe Steuerlast und sind überzeugt, daß die Einkommensteuer, die Erbschaftssteuer, die Lohnsteuer und die vielen anderen Methoden, auf die unser Staat seine Bürger erleichtert, eine Erfindung der Neuzeit seien. Dem ist aber nicht so. Denn die übermäßige Besteuerung ist seit eh und je das untrügliche Zeichen der Dekadenz gewesen. Jedes absterbende Regime hat sie gekannt: angefangen mit den Aegyptern, über die Assyrer und Perser bis in unsere Zeit. Aehnlich ist es auch im Leben der Gesellschaft. Die Sozialgesetzgebung im alten Aegypten war mutatis mutandis nicht viel weniger ausgebildet als in unserer Zeit. Mehrere Gelehrte behaupten z. B., daß der Pyramidenbau entlang des Nils nichts anderes war als die damalige Form der
Arbeitsbeschaffung. Denn das dekadente Aegypten litt auch an der Geißel der Arbeitslosigkeit, die alle Jahrhunderte hindurch ein untrügliches Zeichen des Verfalles war.
Diese Tatsachen sollten uns lehren, in politischen Fragen bescheiden zu sein. Nicht wir haben die Probleme entdeckt, und die verschiedenen Wundermittel unserer Generation sind längst vor unserer Zeit erfunden worden. Wir sollten daher unsere Lage sachlicher und kühler betrachten. Es hat wenig Sinn, sich gegenseitig in Wut anzufallen. Und es ist lächerlich, gegenüber ewig gültigen politischen Erscheinungsformen aus der eigenen Froschperspektive heraus eine Intoleranz zu entwickeln, die die Geschichte selbst mit ihrer souveränen Ruhe verurteilt.
Eine objektive Betrachtung der Frage der Staatsform verlangt auch, diese in der Rangordnung der Werte richtig einzugliedern.
Wir sprechen von Staatsform. Das Wort hat Bedeutung. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Staatsform und Staatsinhalt. Dieser ist das Wesen, man könnte beinahe sagen, die Seele. Jene, die Form, entspricht dem Begriffe des Leibes. Gewiß kann der eine nicht ohne die andere existieren. Aber in der Ordnung der Werte steht die Seele über dem Körper.
Das Wesen des Staates — also der Staatsinhalt — ist im Naturrecht verankert. Der Staat ist nicht Selbstzweck. Er ist für seine Bürger da. Er ist daher keineswegs Quelle des Rechtes noch — wie heute allzuoft geglaubt wird — allmächtig. Seine Befugnisse sind durch die Rechte seiner Bürger beschränkt. Seine Aufgaben sind ihm durch das Subsidiaritätsprinzip angewiesen. Richtig verstanden, darf er nur auf jenen Gebieten wirken, die sich der freien Initiative seiner Bürger entziehen. Der Staat ist daher in allem der Diener des Naturrechtes. Seine Aufgabe ist es, diesem zum Durchbruch zu verhelfen. Darüber hinaus steht ihm nichts zu.
Ist somit die praktische Durchführung des Naturrechtes die Sendung des Staates, so ist die Staatsform das Mittel, durch welches die Gemeinschaft diesem Ziele zustrebt. Sie ist daher Mittel zum Zweck. Sie ist nicht Ziel, sondern Weg zum Ziel.
Damit erklärt sich auch die relativ untergeordnete Rolle der Staatsformfrage. Gewiß ist die Wahl des richtigen Mittels von weittragender Bedeutung. Von ihr wird es abhängen, ob das Ziel erreicht wird. Dauerhaft im öffentlichen Leben ist nur das Naturrecht. Der Weg zu diesem wird sich den praktischen Gegebenheiten anpassen müssen, die immer wieder wechseln. Von einer ewig gültigen Staatsform zu sprechen, die unter allen Umständen und immerwährend richtig ist, würde Unwissenheit und Vermessenheit zeigen.
Daraus wäre auch zu schließen, daß so lange kein ersprießliches Ergebnis erreicht werden wird, als man — meist mit falschen philosophischen Prämissen — die objektive Güte dieser oder jener Staatsform bestimmen will. Die.Diskussion wird erst dann fruchtbar sein, wenn wir uns darüber im klaren sind, daß sie nur unter Ausrichtung auf das Ziel — die Durchsetzung des Naturrechtes — von Nutzen sein wird. Es handelt sich also nicht darum, zu erforschen, wie Monarchie oder Republik in sich einzuschätzen sind. Dies zu beantworten ist ausgeschlossen, weil ja beide nur ein Mittel sind, welches wohl geeignet oder ungeeignet, nicht aber objektiv gut oder schlecht sein kann. Was wir uns jeweils fragen müssen, ist, ob — unter den heute gegebenen Umständen — diese oder jene Staatsform zur Sicherung des Naturrechtes besser geeignet erscheint.
Das Verständnis für das wahre Wesen der Staatsfcirmfrage wird uns auch erlauben, zwei weitere Probleme zu behandeln, die oft zu Unrecht in die Diskussion geworfen werden und sie zu vergiften drohen.
Immer wieder wird vom Verhältnis der Monarchien bzw. der Republiken zu dem Begriffe der Demokratie gesprochen.- Vielfach spiegelt sich hierbei das saloppe Denken wider, welches unser heutiges Zeitalter der Schlagworte und Propaganda kennzeichnet. Denn der Begriff „Demokratie“ ist unendlich dehnbar geworden. In Rußland heißt er Massenmord, Geheimpolizei und Arbeitslager. In Amerika wieder, aber auch manchmal in Europa, sind oft sogar politische Schriftsteller unfähig, die Begriffe Republik und Demokratie auseinanderzuhalten, und verwechseln daher beide in erschreckender Weise. Ueberdies werden als ..Demokratie“ und ..demokratisch“ Begriffe und Eigenschaften bezeichnet, die über den Rahmen der Politik hinausgehen und zur Wirtschafts- und Gesellschaftslehre gehören. Es ist daher notwendig, festzustellen, daß Demokratie im allgemeinen das Mitbestimmungsrecht des Volkes an der Gestaltung seiner Entwicklung und seiner Zukunft bedeutet.
So verstanden, ist keine der beiden klassischen Staatsformen von Natur aus mit der Demokratie verbunden. Wir finden diese vielmehr in beiden Staatsformen, ebenso wie es autoritäre Republiken und Monarchien gibt. Hier wird meist von Monarchisten behauptet, daß die Demokratie in Monarchien besser funktioniere als in Republiken. Wenn wir das heutige Bild Europas betrachten, hat das Argument zweifellos viel für sich. Es kann ihm eine gewisse — allerdings nur räumlich und zeitlich bedingte — Gültigkeit zuerkannt werden. Wir müssen fedoch demgegenüber darauf verweisen, daß in kleineren, stark traditionell verankerten Staaten, wie z. B. der Schweiz, Demokratie und Republik erfolgreich zusammenwirken können.
Viel schärfer noch wird bei uns die Frage Monarchie und Sozialismus, respektive Republik und Sozialismus, diskutiert. Dies hauptsächlich, weil im deutschsprachigen Raum die große Mehrheit der offiziellen sozialistischen Parteien republikanisch eingestellt ist. Daraus entsteht bei beschränkten und tineebildeten Geistern nur allzu leicht der Eindruck, daß Sozialismus und Monarchie unvereinbar seien.
Es liegt hier eine grundlegende Verwechslung vor. Die sozialistische Lehre - oder zumindest das, was heute als solche gilt — ist in ihrer Wesenheit ein wirtschaftliches und sozialpolitisches Programm. Dieses hat daher eigentlich“ mit der Staatsformfrage nichts zu tun. Das republikanische Gehaben einiger sozialistischer Parteien entspringt daher nicht dem Wesen ihres Programmes, sondern der persönlichen Auffassung ihrer Führer.
Daß dem so ist, beweist bei uns in Europa die Tatsache, daß die Mehrheit der wahrhaft starken sozialistischen Parteien nicht republikanisch, sondern monarchistisch ist. Es ist dies der Fall in England, in Skandinavien und in Holland. In all diesen Staaten besteht nicht nur zwischen dem Sozialismus und der Krone bestes Einvernehmen, sondern man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der monarchistische Boden dem Sozialismus günstiger als der republikanische ist. Jedenfalls ist es eine praktisch erhärtete Tatsache, daß der Sozialismus unter einem König sich länger an der Macht hält als dort, wo die republikanische Staatsform vorherrscht. Einer der großen Führer von Englands Labour Party'erklärte dies mit dem mäßigenden und ausgleichenden Einfluß der Krone, der es dem Sozialismus erlaube, sein Programm langsamer, vernünftiger und daher auch erfolgreicher durchzuführen. Gleichzeitig biete der überparteiliche Herrscher an der Spitze des Staates auch der Opposition genügend Rechtsgarantien, so daß sie nicht zu äußersten Anstrengungen greifen muß, um unter allen Umständen die Macht wiederzugewinnen. Sie kann der Entwicklung ruhiger ins Auge blicken.
Wie dem auch, immer sei, jedenfalls lehren uns die Tatsachen, daß es unberechtigt wäre, in der Frage der Staatsform eine Antinomie zwischen Monarchie und Sozialismus oder Monarchie und klassischer Demokratie künstlich zu schaffen. Das gleiche gilt auch für Republiken.
Noch auf einen Punkt muß hingewiesen werden, bei dem sich die Diskussion allzu leicht verläuft. Es handelt sich um die, besonders bei politisch weniger Geschulten, häufige Verwechslung zwischen der Monarchie als Staatsform und dieser oder jener Dynastie, mit anderen Worten der Begriffe Monarchismus und Legitimismus.
Legitimismus, die besondere Verbundenheit mit einer Person, einer Verfassungsform oder einer Dynastie, entzieht sich fast immer der vernunftmäßigen, sachlichen politischen Debatte. Er ist gefühlsbedingt und kann daher nur durch Argumente ad hominem verfochten oder bekämpft werden. Eine vernunftmäßiee Beurteilung der Fragen der Gegenwart muß daher auch klar zwischen Monarchie und dynastischem Legitimismus unterscheiden. Denn die Staatsform ist e|n, politisches Problem. Sje muß, daher unabhängig von derjeniger Person oder Familie diskutiert werden, die ihr augenblicklicher oder vergangener Träger ist oder war. Dies ist auch schon darum berechtigt, weil uns ja die Geschichte immer wieder Wechsel von Dynastien in den Monarchien gezeigt hat. Auf jeden Fall steht die Institution höher als ihr Träger, um so mehr, als dieser sterblich, jene hingegen, historisch gesehen, unsterblich ist.
Eine Staatsform nur im Lichte ihres augenblicklichen Repräsentanten zu beurteilen, würde zu Grotesken führen. Denn in diesem Falle müßten natürlich auch die Republiken nicht nach ihrer politischen Berechtigung, sondern nach ihren zufälligen Präsidenten beurteilt werden. Dies wäre besonders heute bei uns in Europa eine schreiende Ungerechtigkeit.
Uebrigens sei festgestellt, daß es unter den Verfechtern des monarchischen Gedankens in den Republiken Kontinentaleuropas relativ wenig Legitimisten gibt. König Alfons XIII. von Spanien hat einmal das Wort geprägt: „Der Legitimismus überlebt nicht eine Generation.“ Legitimismus ist dort eine wertvolle Kraft, wo es eine durch die Geschichte gefestigte, nur von wenigen angezweifelte dauerhafte Staatsform gibt. So gesehen, bezieht er sich ebensogut auf Republiken wie auf Monarchien. Man kann in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten ebenso von einem republikanischen Legitimismus sprechen wie etwa in England und Holland von einem monarchischen. In den meisten Staaten Kontinentaleuropas sind allerdings im Laufe dieses Jahrhunderts so tiefgehende Erschütterungen erfolgt, daß man den Legitimismus weit seltener antrifft. Unter solchen Umständen ist es besonders gefährlich, gefühlsbedingte Argumente zu gebrauchen. Denn diese wirken dann explosiv, anstatt ein Element der Kraft zu sein.
So gesehen, müßten wir in der Debatte um die Staatsform folgende Fragestellung befürworten: Sind Republiken oder Monarchien besser geeignet, den Schutz des Naturrechtes und des Glückes der Staatsbürger im Zeitalter der Atomenergie und des Automatismus zu gewährleisten?
Es sei hier betont, daß wir unter Monarchie eine Staatsform verstehen, in welcher an der Spitze des Staates eine von jeder Wahl unabhängige Person steht, die ihre Aufgabe unter Berufung auf ein höheres Recht erfüllt und dies damit begründet, daß alle Macht aus dem Transzendentalen kommt. In Republiken wieder geht der oberste Beamte des Staates aus der
Wahl hervor und leitet daher seine Autoritä von seinen Mandanten, d. h. jener Gruppe ab die ihn erwählt oder bestimmt hat.
Wenn wir in unserer Fragestellung weiterhii von Atomzeitalter und Automatismus sprechen so ist dies mit Bedacht geschehen. Tatsächlicl ankern nämlich fast alle europäischen Ver fassungen der Jetztzeit geistig im 19. Jahr hundert. Ihre Sprache und ihre Formeln sind al und überholt. Gleichgültig, ob es sich um Repu bliken oder Monarchien handelt, sind die ge' schriebenen Verfassungen der Gegenwart offen sichtlich kaum geeignet, den großen, Wirtschaft liehen und sozialen Problemen der Zukunft 21 begegnen. Um aber in einer so wichtigen Frage wie jener der Staatsform, sich ein objektive! Bild 2U schaffen, muß man sie unbedingt in di
Perspektive der kommenden Generationen stellen und sich nicht durch Klischees der Vergangenheit beeindrucken lassen.
Die wichtigsten Vernunftgründe der Republikaner lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Vorerst einmal ist die Republik mit ganz wenigen Ausnahmen keine sakrale Staatsform. Sie braucht keine Berufung auf Gott, um ihre Autorität zu rechtfertigen. Denn in ihrem System stammt die Autorität, die Souveränität als Quelle der Macht, vom Volke. In unserer Zeit, die sich mehr und mehr vom Gottesbegriff abwendet oder ihn zumindest in den Raum der Philosophie verweist, sind ein laizistischer Staatsbegriff und eine laizistische Staatsform eher annehmbar denn eine, die in der Endanalyse auf theokratischen Gedanken fußt. Die Republik kann sich daher auch leichter zu einem laizistischen Begriff der Menschenrechte bekennen. Sie hat den Vorteil, dem Zeitgeist besser zu entsprechen und daher den Massen mehr zu sagen.
Darüber hinaus hängt das Staatsoberhaupt der Republik nicht von dem Zufall des Erbganges, sondern von der Wahl des Volkes oder einer Elite ab. Die Präsidentschaft ist zeitlich beschränkt, das Staatsoberhaupt leicht abberufbar und kann daher, falls unfähig, ersetzt werden. Er stehe auch, aus dem Alltagsleben kommend, der Wirklichkeit näher. Es sei auch zu hoffen, daß die Massen mit Hilfe der fortschreitenden Schulbildung fähig sein werden, die richtige Person zu erwählen. Ist man aber in der Monarchie einmal mit einem schlechten Herrscher behaftet, so sei es nahezu unmöglich, ihn ohne Sturz des Regimes vom Thron zu entfernen. Schließlich sei die Tatsache, daß ein jeder Bürger, zumindest theoretisch, die Möglichkeit hat, Präsident zu werden, eine Ermutigung für das Verantwortungsbewußtsein der Massen und führe 2ur politischen Reife. Denn der patriarchalische Charakter der Monarchie verleite das Volk, sich auf den Herrscher zu verlassen und damit die öffentliche Verantwortung von seinen Schultern ab2uwälzen.
Auf monarchistischer Seite argumentiert man so: