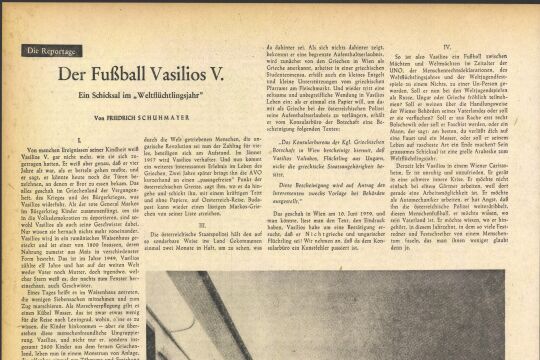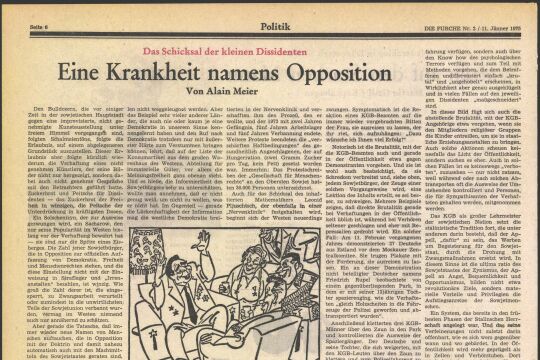Krimtataren: Leben in einer „Heimat auf Zeit“
Viele Krim-Tataren mussten nach der russischen Invasion ihre Heimat verlassen. Jetzt kämpfen sie in Kiew um ihre kulturelle Identität und träumen von einer Zukunft zuhause.
Viele Krim-Tataren mussten nach der russischen Invasion ihre Heimat verlassen. Jetzt kämpfen sie in Kiew um ihre kulturelle Identität und träumen von einer Zukunft zuhause.
Es ist kalt an diesem Dienstag Morgen. Der Wind pfeift über die Povitroflotsky-Straße. Vor der russischen Botschaft stehen ein paar Kleinbusse. In manchen wärmen sich Journalisten, in anderen Nationalgardisten. Ein Wagen fährt vor, Personen steigen aus, tauschen Dokumente mit den Polizisten vor der Botschaft aus, Hände werden geschüttelt, Transparente enthüllt, Poster am Zaun der Botschaft angebracht. Weitere Leute kommen, die Journalisten steigen aus, die Nationalgardisten ebenso. Dann geht es los. Ein eingespielter Ablauf.
Jedes Monat demonstrieren Krimtatarische Aktivisten vor der russischen Botschaft in Kiew. Am Asphalt vor der diplomatischen Vertretung finden sich die Spuren der vorangegangenen Kundgebungen: Reste von Farbbeuteln und auf die Straße gesprayte Botschaften hinter der Stacheldraht-umzäunten Vertretung. Diesmal geht alles ruhig über die Bühne. Gerade einmal 20 Personen sind gekommen, wenn es hoch kommt – allesamt Aktivisten.
Dazwischen Ismail Ramazanov, ein stämmiger Mann Anfang 30 mit tiefen Furchen im Gesicht. Er hat sich einen feinen Mantel angezogen. Er ist der Star heute. Er nimmt das Mikrofon, hält eine Rede darüber, dass die Krim zur Ukraine gehöre. Seine Stimme bricht, er weiß was passieren wird. Da kommen Männer in Gesichtsmasken und Zerren ihn in ein Auto – eine Aktion, alles nur gespielt. Diesmal.
Sondereinsatz-Erlebnisse
Später wird sich Ismail Ramazanow bei seinen Kidnappern lachend und seine Stirn reibend darüber beschweren, dass er sich den Kopf beim Einsteigens ins Auto angeschlagen habe. Der Kidnapper wird lachend erklären, dass er halt keine Übung darin habe, Leute festzunehmen, sich entschuldigen und Ismail Ramazanov dabei freundschaftlich auf die Schulter klopfen. Aufgekratzt wird Ismail Ramazanov in der Menge umherwuseln, er wird Interviews geben, laut, impulsiv, mit sich leicht überschlagender Stimme. Und irgendwann später in einer ruhigen Minute wird ihn eine Mitstreiterin fragen, wie es ihm denn gehe. Und Ismail Ramazanow wird mit traurigen Augen sagen: Eh alles gut.
Es war im Jänner 2018, als Ismail Ramazanow in seiner Wohnung nahe Simferopol auf der Krim von einem Sondereinsatzkommando festgenommen wurde. Da waren es keine Freunde in Sturmhauben, die ihn in ein Auto zerrten, sondern FSB-Leute. Extremismus warf man ihm vor. Es folgte ein sechsmonatiges Martyrium aus Verhören, Schlägen, Drohungen, Anhörungen vor Gericht und weiteren Verhören – und dann eine überraschende Freilassung aus Mangel an Beweisen. Schließlich schaffte er es vor knapp einem Jahr nach Kiew. Und da ist er jetzt. Arbeitet mal hier, mal da, der ehemalige Eisenbahner.
Die Annexion der Krim und das, was danach kam, haben Zehntausende Krimtataren dazu bewogen, die Krim zu verlassen. Und Kiew ist heute so etwas wie das Zentrum der Tataren im Exil. Restaurants, Cafes, Läden haben sie gegründet, aber auch die politische Vertretung der Tataren, der Mejlis, ist heute im ukrainischen Exil in Kiew angesiedelt. Den russischen Behörden, die auf der Krim die Kontrolle haben, gilt die politische Vertretung der Tataren als extremistische Organisation.
„Als Heimat auf Zeit“ bezeichnet Aider Kiew. Aider ist Manager einer Filiale einer tatarischen Restaurantkette im Zentrum Kiews. Tatarische Küche für ukrainische Massen. Hier einen Platz zu ergattern, ist spontan kaum möglich. Seit sechs Jahren ist Aider in Kiew. Erst dachte er, es werde nur einige Zeit dauern, dann heiratete er eine Ukrainerin, dann kam sein Sohn zur Welt. Und heute stellt sich ihm die Frage: Wird der denn ein Krimtatar sein? Ihm tatarische Traditionen zu vermitteln, ist Aider wichtig. Auch die Sprache. Zugleich aber ist ihm klar, dass sein Sohn eben in Kiew und nicht auf der Krim aufwächst – in der Festlandukraine, einem slawisch orthodox dominierten Umfeld. Er und sein Sohn werden nicht die selbe Heimat haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!