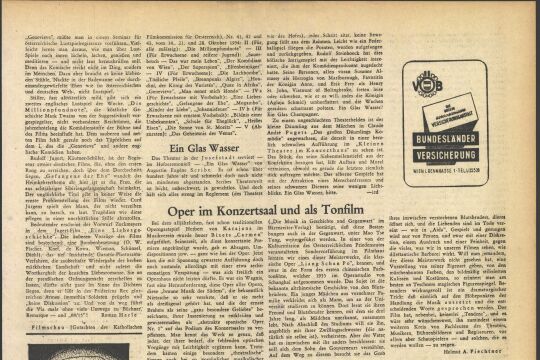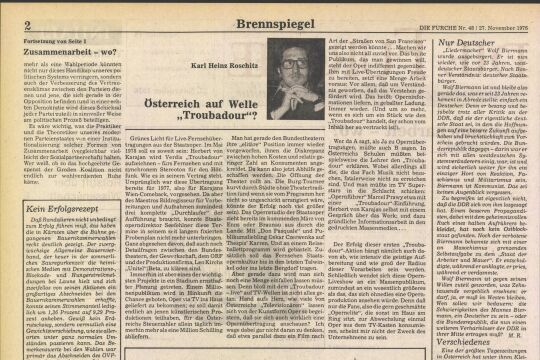Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kunstkommerz
Der Terminus im Titel bezeichnet eine Liaison, die es immer schon gegeben o^t. Bereit, 'in längst vergangenen Ä-?iter.*vardc ein Künstler, der einen Auftrag zur Zufriedenheit seines Fürsten oder Mäzens ausgeführt hatte, mit einer runden Summe entlohnt oder gar mit einem kleinen Lehen beschenkt. Aber erst seit der Erfindung und Perfektionierung der Massenmedien werden Beträge aufgewendet, die auch dem mit der Materie einigermaßen Vertrauten immer phantastischer erscheinen. Es gibt heute, nach den letzten Statistiken, etwa 400 Millionen Radioapparate und ungefähr 150 Millionen Fernsehgeräte (davon in Österreich rund eine halbe Million). Die Anzahl der Schallplatten kann nur geschätzt werden und entspricht einer zehn- bis zwölf stelligen Ziffer. Alle diese audiovisuellen Medien, durch die heute (natürlich nicht allein) „Kunst“ vermittelt wird, sind längst sozio-kul-turelle Institutionen geworden — Großunternehmen, die über ein Jahresbudget von vielen Millionen verfügen und denen man mit den Maßstäben von gestern und vorgestern nicht mehr gerecht wird.
Wenn wir uns bei dieser Betrachtung auf die Musik, speziell auf die Oper, beschränken, so hat das seinen besonderen Grund. Die Berieselung mit Musik erdulden wir bereits seit Jahrzehnten. Nun aber, seit kurzem, wird uns auch jene Kunstgattung immer häufiger ins Haus geliefert, die selbst den verwöhnten Großstädter in eine „Ausnahmesituation“ versetzte, markiert durch festliche, zumindest sorgfältige Kleidung und gekennzeichnet durch erwartungsvolle Stimmung oder Hochspannung. Von sehr ernstzunehmenden Kulturkritikern wird dieser stetige, durch die Bequemlichkeit häuslichen Kunstkonsums geförderte Nivellie-rungsprozeß nicht ohne Sorge beobachtet. Vielleicht denken sie an das benachbarte Gebiet der Schallplatte und erinnern sich, daß es in den USA bereits Longplays mit folgenden Titeln (und entsprechender Auswahl) gibt: „Musik zum Lesen“, „Musik zum Abwaschen“, „Musik für die werdende Mutter“ und — natürlich — „Musik zum Einschlafen“. Der erfolgreiche amerikanische TV-Komponist Gian-Carlo Menotti, der, was die Wahl seiner zeitnahen Sujets betrifft, keineswegs als Eklektiker bezeichnet werden kann, sagte zum Leiter der österreichischen Fernsehproduktion Oper und ernste Musik: „Ich mag nicht, daß Leute meine Musik anhören, während sie Reis essen, ihre Zehennägel schneiden oder sich rasieren.“ Aber er arbeitet trotzdem weiter für das Fernsehen, obwohl er „die Technik nicht liebt.“ Wohl aber das Geld, das man mit ihrer Hilfe verdienen kann. Und ein international bekannter Musikkritiker formuliert: „Eines der wichtigsten Folgesymptome des an Ausbreitung zunehmenden Fernsehens ist der Aufschwung der Hausschuhindustrie.“
Bei der Aufzeichnung beziehungsweise Produktion von Opern für das Fernsehen gibt es ganz besondere Schwierigkeiten. Ihnen wird eine unserer nächsten Kunstsonderseiten gewidmet sein. Künstler und Techniker sind dabei, ihrer soweit wie möglich Herr zu werden. Aber über einen Punkt werden sie wohl nie hinauskommen. Der deutsche Schriftsteller Alfred Andersch meint dazu: „Der TV-Bildschirm ist das atmosphäreloseste Medium, das seit Erschaffung der Welt jemals zur Darbietung von Kunst ersonnen wurde.“ Doch gerade die Atmosphäre des Opernhauses, das schwer definierbare Fluidum, der unmittelbare Kontakt zwischen Bühne und Zuschauern ist es, der den agierenden Sänger zu Höchstleistungen anspornt und jedem einzelnen im Publikum das festliche Erlebnis „Oper“ schenkt.
Immerhin mag man auch bedenken;“ daß etwa 80 Prozent der Fernseher (in Österreich dürfte der Prozentsatz um einiges geringer sein) mit der Kunstgattung Oper zum erstenmal in Kontakt kommen. Um so beherzigenswerter ist daher die Warnung eines verantwortungsbewußten Fachmannes (Professor W. Scheib): „Diesen Kreis von neu herangezogenen Musikinteressenten gilt es zu pflegen, ihn nicht zu überfordern, vor allem aber nicht zu überfüttern.“
Das österreichische Fernsehen produzierte während der letzten Jahre durchschnittlich drei Opern; hinzu kamen: zwei bis vier Direktübertragungen von österreichischen Festspielbühnen (hauptsächlich aus Salzburg) und etwa die doppelte Anzahl Übernahmen von ausländischen, vornehmlich deutschen Stationen. Es ist also, was der Dirigent Herbert von Karajan kürzlich ankündigte, nämlich die Eröffnung eine OpernTV-Zentrums in Genf, nichts grundsätzlich Neues. Auch der Plan eines Zusammenschlusses mehrerer Opernhäuser zum Zweck des Austausches von Gastspielen ist von ihm schon vor Jahren erwogen worden. Neu ist nur das Zentrum und der Radius dieses Ringes sowie die Verbindung dieser beiden Projekte. Neu — und einem Großmanager mehr angemessen als einem Künstler.
Vorgesehen ist also Genf als „neutrales“ Zentrum, eine Stadt, die zwar ein großes Opernhaus besitzt“, aber kein festes Repertoire und nur neunzig Spieltage im Jahr hat, also den internationalen Produktionsplan nicht behindert. Dort soll die „Scala“ zwei Ensemblegastspiele zeigen, während Karajans Genfer Inszenierungen nach Hamburg, Mailand, Berlin und New York „auf Reisen gehen“. Außerdem wird die „Deutsche Oper Berlin“ Karajans „Troubadour“ als Gastspiel nach Hamburg bringen, worauf dann eine noch nicht fixierte Hamburger Produktion Karajans in der New Yorker „Metropolitan Opera“ vorgeführt werden soll. Ferner hat sich Berlin bereit erklärt, Karajans Mailänder Inszenierung, als Gastspiel zu übernehmen. Schließlich soll eine in Paris einstudierte „Tosca“ an Ort und Stelle für das Fernsehen aufgezeichnet werden.
Das alles ist ein wenig verwirrend, wird aber etwas durchsichtiger, wenn man die Titel der vorgesehenen Werke liest: „Troubadour“, „Tosca“ und „Boheme“ sowie „Der Ring des Nibelungen“. (Hierzu Wieland Wagner: er glaube nicht, daß sich die Opern seines Großvaters mit ihrer vierstündigen Dauer fürs Fernsehen eignen.) Die amerikanische Theaterzeitschrift „Variety“ nennt noch „Rigoletto“, „Bajazzo“, „Cavalleria rusticana“ und „einige Mozart-Opern“. Karajan geht also, wie bisher, mit seinem Repertoire auf Nummer Sicher. Gleichzeitig sind Schallplattenaufnahmen dieser fürs Fernsehen produzierten Werke für die „Deutsche Grammophon-Gesellschaft“ vorgesehen.
Soweit der „künstlerische“ Teil dieses Projekts, das aber auch noch eine kommerzielle Kehrseite hat. Wer nämlich auch nur eine ungefähre Ahnung von den Summen hat, die bei solchen Großunternehmungen umgesetzt werden (und zum Beispiel weiß, daß sich Karajan für einen Abend am Pult 3000 Dollar zahlen läßt), der wird den Titel, unter dem eine österreichische Zeitung dieses Projekt angekündigt hat, begreiflich finden. Er lautet: „Seid umschlungen, Milliarden!“
Wien ist in das Projekt nicht einbezogen. Das große Haus am Ring befindet sich außerhalb dieses Ringes. Sollen wir darüber traurig sein? Wir meinen, daß dazu kein Anlaß besteht. Was wir von unserer Staatsoper erwarten und wünschen, ist etwas anderes. Wir möchten hier, an Ort und Stelle, mit unseren eigenen Künstlern als „Grundstock“ erarbeitete Aufführungen haben, die über Monate und Jahre im Repertoire bleiben sollen. Wir besitzen — das darf ohne Lokalpatriotismus gesagt werden — das beste Opernorchester der Welt und das schönste, wenn auch nicht das größte Opernhaus. Besonders gelungene Aufführungen werden auch den Weg auf den Bildschirm finden. Wir werden uns über ein bis zwei Gastspiele im Jahr freuen, und wir werden stolz darauf sein, wenn die Wiener Oper auch einmal mit einem Gesamtgastspiel ins Ausland geht. Dazu brauchen wir keinen Fernsehring und keinen internationalen Opernkonzern.
Was aber das Karajansche Großprojekt betrifft, so teilen wir die Meinung eines altersweisen deutschen Intendanten, der, als er davon las, zu einem Kollegen sagte: „Schauen wir uns das Ganze nach drei Jahren an!“ Was davon realisiert wurde. Oder: Was davon noch übriggeblieben ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!