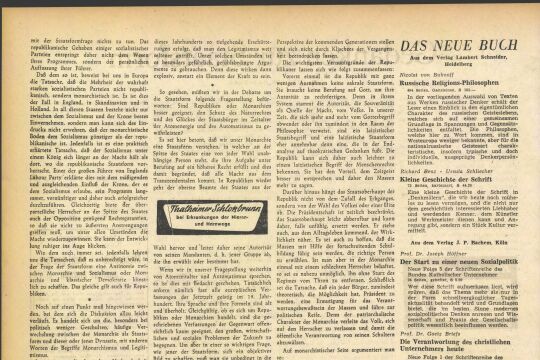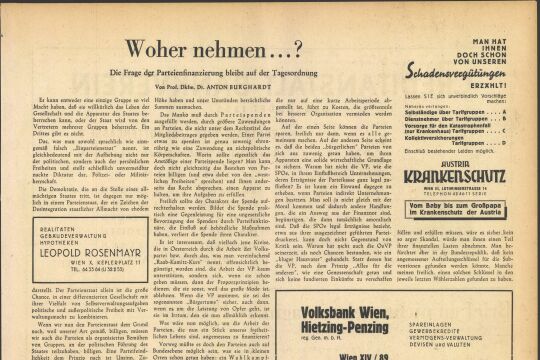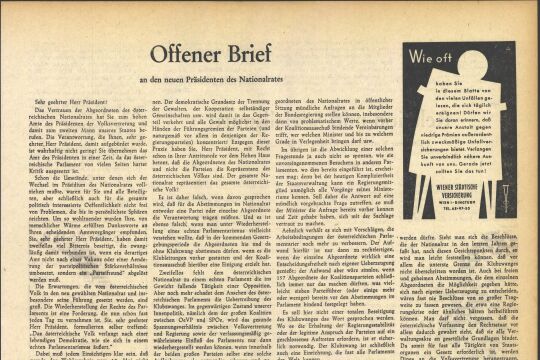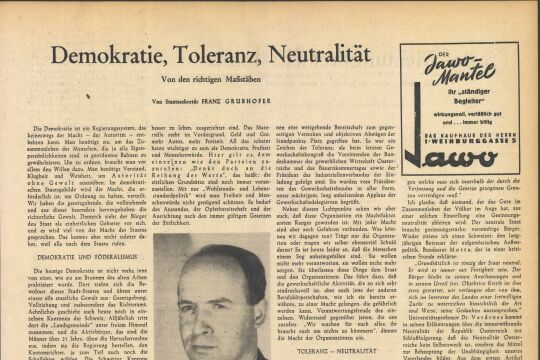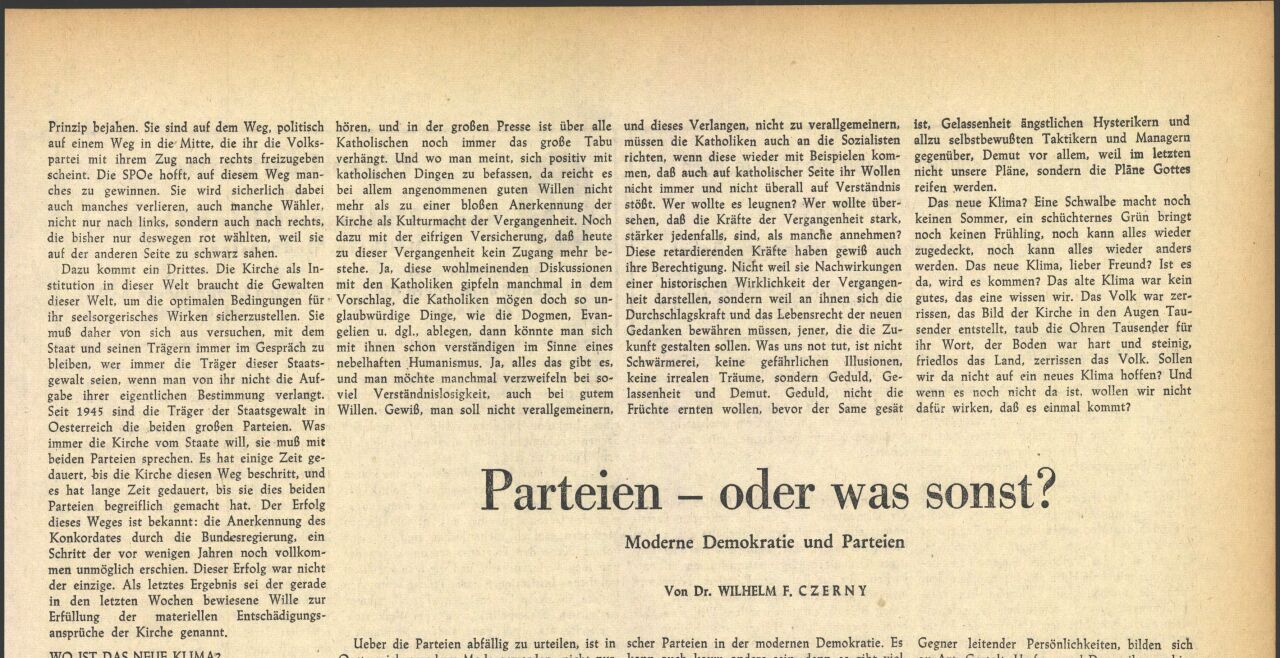
lieber die Parteien abfällig zu urteilen, ist in Oesterreich geradezu Mode geworden; nicht nur zum Schaden der Parteien, sondern — was viel bedauerlicher ist — mitunter auch zum Schaden der Demokratie.
Die Vorwürfe, die immer wieder gegen die Parteien erhoben werden, sind für jedermann verständlich und daher in höchstem Maße populär. Viel weniger verständlich hingegen ist die Einsicht in das Wesen und die Aufgaben politischer Parteien in der modernen Demokratie. Es kann auch kaum anders sein, denn es gibt viel zuwenig ernst gemeinte und gründliche Ueber-legungen darüber, wie ein moderner demokratischer Staat mit Hilfe eines modernen' Parteienwesens funktionieren kann. Die Geschichte ist wohl eine große Lehrmeisterin; aber sie zeigt zu diesem Thema vor allem die Fehlentwicklungen. Und eine sogenannte „Wissenschaft von der Politik“ ist im mitteleuropäischen Raum, sehr zum Unterschied von Westeuropa und Amerika, noch immer eine höchst umstrittene Wissensdisziplin, obwohl vielleicht gerade sie entscheidend beitragen oder zumindest versuchen könnte, das Unbehagen über die derzeitige Form der parteienstaatlichen Demokratie zu überwinden.
Die Bildung von Gruppen, die man als Parteien oder zumindest als Parteiungen bezeichnen kann, ist naturgemäß viel älter als die moderne Demokratie. In jeder Gemeinschaft entsteht nicht nur ein einfaches, sondern ein vielfaches Feind-Freund-Verhältnis, gibt es Anhänger und
Gegner leitender Persönlichkeiten, bilden sich an Art, Gestalt, Umfang und Dynamik verschiedene Vereinigungen, die nach irgendeiner Seite meist auch einen politischen Aspekt haben. Die Bildung dieser Gruppierungen erfolgt zunächst im rein gesellschaftlichen Bereich, und es ist wichtig, gerade in unserer Zeit das „gesellschaftliche“ Prinzip vom „politischen“ Prinzip zumindest gedanklich zu trennen.
In gesellschaftlichen Gebilden ist ein gewisses Maß von Autorität, Ueber- und Unterordnung unerläßliches Mittel zu ihrer Erhaltung. Grundlegend aber ist, daß in einer gesellschaftlichen Vereinigung sich Menschen durch ein Mitein-ander-verbunden-Sein gruppieren. Die Gesellschaft an sich hat keine Macht, die vielfach auseinander- und gegeneinander strebenden verschiedenartigen Gruppen zueinanderzufügen; sie kann das Gemeinsame entfalten, aber nicht erzwingen. Das kann allein der Staat. Die Mittel, mit denen er es tut, sind ihrem Wesen nach keine sozialen, sondern politische. Zutreffend sagt daher der amerikanische Soziologe M a c I v e r :
„Das Soziale mit dem Politischen gleichsetzen heißt, sich der gröbsten aller Verwechslungen schuldig machen, die jegliches Verständnis, sowohl der Gesellschaft wie des Staates, gänzlich verstellt.“ Auch die Idee der unbeschränkten Staatsmacht nimmt vor allem bei H o b b e s mit der Aufhebung des Unterschiedes zwischen Gesellschaft und Staat ihren Ausgang. Darnach würde der Staat seine Aufgabe dann am vollkommensten erfüllen, wenn er alle Tätigkeiten der Bürger regulierte, wenn nach seinem obersten Willen alles ausgerichtet wäre. Solange dies nicht verwirklieht ist, ist noch Gesellschaft im Staate. Nach H o b b e s und seinen Epigonen wird also der zu Vollkommenheit gelangte Staat auch den letzten Rest von Gesellschaft austilgen.
Der Unterschied zwischen gesellschaftlichen Gruppierungen und Parteiungen früherer Zeit und den politischen Parteien der modernen Demokratie besteht darin, daß diese politischen Parteien gesellschaftliche Kräfte mit einer bewußt in den politischen Bereich wirkenden Tendenz sind. Ihrer Herkunft nach sind die politischen Parteien also Ausdrucksformen gesellschaftlicher Kräfte, Organe der politischen Willens b i 1 d u n g, nicht aber der Willens-ausü bung, etwa der Regierung! Daß die politischen Parteien gesellschaftliche Kräfte sind, bedingt einen freien Raum für ihre Entwicklungsmöglichkeit und politische Dynamik, der durch eine gesetzliche Reglementierung nur schwer zu begrenzen ist, geschweige denn allzusehr eingeengt werden sollte. Darin liegt eine der grundsätzlichen Schwierigkeiten für ein sogenanntes „Parteiengesetz“, also ein Gesetz, das die Grundzüge des Parteiwesens eines Staates normieren würde.
Solange die politischen Parteien als gesellschaftliche Kräfte empfunden wurden, erhob niemand im Volke die Forderung nach einem solchen Parteiengesetz. Der Ursprung der modernen politischen Parteien — insbesondere auch bei uns in Oesterreich — liegt ja in der Zeit, da eine parteiunabhängige Staatsspitze, verkörpert durch den Monarchen und seine Regierung, den staatlichen Raum repräsentierte, während sich das Volk der Parteien bediente, um mit ihrer Hilfe und insbesondere dem durch sie ermöglichten Parlament ein Mitbestimmungsrecht in staatlichen Angelegenheiten auszuüben. Mit dem Umsturz des Jahres 1918 änderte sich aber das Parteiwesen in unserer Republik grundlegend. Die Wahl des Staatsoberhauptes durch das Volk, die Abhängigkeit der Regierung vom Parlament und andere Entwicklungen führten dazu, daß die politischen Parteien in Positionen gelangt sind, die ihnen früher verschlossen waren. Immer größer wurde und wird die persönliche Identität von Staats-führung und Parteiführung, die Verlagerung staatlicher Entscheidungen auf parteipolitisch zusammengesetzte Koalitions- oder Verhandlungsausschüsse usw. Ja selbst in der staatlichen Verwaltung, die nach klassischer Regel nur Gesetze zu vollziehen hat und deren sämtliche Maßnahmen eine Deckung in einem von der Volksvertretung beschlossenen Gesetz finden müßten, wird die Zahl der parteipolitisch zusammengesetzten Beiräte, Ausschüsse usw. immer größer.
Die politischen Parteien lösen sich damit mehr und mehr von ihrem gesellschaftlichen Nährboden; sie werden vom Volke nicht mehr als Repräsentanten gesellschaftlicher Kräfte, sondern als Organe der staatlichen Willensausübung empfunden, ja geradezu als Mittel, die der staatlichen Willensdurchsetzung im Volke dienen. Das ist im Grunde genommen die ungute Situation des „Parteienstaates“, in dem zumindest die Regierungsparteien Mitträger staatlicher Gewalt und alle Parteien zu Teilträgern der Volkssouveränität geworden sind.
Das Unbehagen mit dieser Form des Parteienstaates wird wahrscheinlich so lange anhalten, bis entweder die politischen Parteien den gehörigen Abstand vom Staate gefunden und ihre Rolle als gesellschaftliche Kräfte wiedererlangt haben oder aber das Parteiwesen völlig in den staatlichen Bereich gerückt und durch die Verfassung bzw. ein Parteiengesetz institutionalisiert sein wird, die Gesellschaft aber gleichzeitig andere Kräfte entwickelt hat, um auf den Staat einzuwirken. Der Dualismus zwischen Staat und Gesellschaft ist ja immer gegeben, und schon der berühmte deutsche Soziologe Lorenz von Stein sah „den Inhalt des Lebens der menschlichen Gemeinschaft in einem ständigen Kampf des Staates mit der Gesellschaft“.
Nicht unberechtigt erheben freilich Anhänger der Demokratie und des herrschenden Parteiwesens alle erdenklichen Vorbehalte gegen Versuche, auf ständischer, berufsmäßiger oder sonstiger Grundlage Organisationsformen zu entwickeln, die die Rolle der Parteien übernehmen und als gesellschaftliche Kräfte in den staatlichen Bereich einwirken sollen. Will man aber beim hergebrachten Parteiwesen bleiben, so stellt sich das Problem, Mittel und Wege zu finden, um den Parteien wieder die Ausübung ihrer gesellschaftlichen Funktion zu ermöglichen.
Die Ursprünge unserer Parteien liegen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, und von da stammen vor allem ihre Ideologien. Der Ausgangspunkt war, Weltanschauungen oder auch Klassen zu repräsentieren. Gerade die Geschichte der Republik Oesterreich zeigt aber, daß eine solche politische Gruppierung allergrößte Gefahren in sich birgt, zumal weltanschauliche Gegensätze nicht durch das klassisch-demokratische Mehrheitsprinzip lösbar sind. Die Zeit nach 1945 brachte denn auch eine Abkehr vom Prinzip der reinen Weltanschauungsparteien, eine Entideologisierung, die eigentlich von der Oesterreichischen Volkspartei begonnen und von der Sozialistischen Partei mit dem Streben fortgesetzt wurde, ebenfalls eine Volkspartei mit sozialer, nicht unbedingt marxistischer Zielsetzung zu werden. Verstärkt hat sich hingegen der Zug zur Vertretung von Interessen. Die Lösung der Interessenkonflikte erfolgt im allgemeinen durch ein Kompromiß der beiden Regierungsparteien. Zumeist ist aber ein solches Kompromiß in der Meinung der Bevölkerung — berechtigt oder unberechtigt — mit dem Odium beladen, das Ergebnis eines Gefeilsches bzw. eines Junktims zwischen völlig verschiedenen Sachentscheidungen, nicht aber einer „objektiven“ Politik zu sein.
Nun muß man sich wohl darüber im klaren sein, daß es eine „interessenlose“ Politik gar nicht gibt. Die Frage ist nur, wie man fundamentale Gegensätze, die mit demokratischen Methoden einfach nicht lösbar sind, in eine höhere Ebene der Toleranz, der objektiven Behandlung, verlegen kann, und wie man vor allem staatliche Institutionen der Pflicht entbinden könnte, in diesen Gegensätzen „Partei“ nehmen zu müssen. Staatspolitik wird vom Volk richtigerweise als etwas ganz anderes empfunden, als Programme durchzusetzen oder Interessen zu vertreten. Staatspolitik heißt Verantwortung tragen für alle, mögen sie auch verschiedener Ansicht sein, und einander widersprechende Interessen verfolgen. In einem Vortrag an der Deutschen Hochschule für Politik hat Dr. Otto Heinrich v. d. Gablentz einmal den beherzigenswerten Satz geprägt: „Gewalt wird zur Herrschaft nur, wenn sie sich legitimiert dyrch Leistung für die Unterworfenen. Nur dann bekommt Macht einen Sinn, wenn der Machthaber fähig ist, eine dauerhafte Friedensordnung zu gestalten.“
Es gilt also, im gesellschaftlichen Raum die einander überschneidenden Anschauungen und Interessen durch ein Parteiwesen zum Ausdruck zu bringen, ohne daß dieser Pluralismus allzusehr auf den Staat übergreift.
Unser gegenwärtiges Parteiwesen hat nun folgenden Widerspruch in sich: Es versucht, die Demokratie dadurch zu verwirklichen, daß am Wahltag eine Statistik nach parteipolitischen Programmen vorgenommen wird. Entsprechend dem Ergebnis dieser Statistik werden parteipolitische Sachwalter in das Parlament entsandt, womit — verschärft durch die Idee, daß es die Hauptaufgabe des Abgeordneten sei, die Bestrebungen seiner Partei zu repräsentieren, durch den Klubzwang usw. — die parteipolitische Auseinandersetzung in das Forum des Parlaments, also eines Staatsorgans, und von dort weiter in Regierung, Verwaltung usw. übertragen wird. Den Ausgang nimmt diese Fehlhaltung wahrscheinlich vom Verhältniswahlsystem. Dieses erweckt die Illusion, daß es „gerecht“ sei, bei der Zusammensetzung der Volksvertretung, aber darüber hinaus bei allen möglichen staatlichen Belangen das Stärkeverhältnis der Parteien, das am Wahltag festgestellt wurde, zur Anwendung zu bringen. So wird das öffentliche Leben zuerst verpolitisiert und dann proportionalisiert. Treffend hat darüber ein amerikanischer Professor der politischen Wissenschaften folgendes ausgeführt:
„Die Mannigfaltigkeit der Interessen und Meinungen, die in jeder Nation zu jedem Zeitpunkt ihrer Geschichte bestehen, ist in der Tat nicht abzusehen. Wenn wir die Funktion eines Parlaments einzig und allein darin erblicken, alle diese Differenzierungen ,in verkleinertem Maßstab' wiederzugeben, so vergessen wif, daß die Hauptaufgabe in einer Demokratie, wie in anderen Regierungsformen, darin besteht, ,e pluribus unum, das heißt aus Uneinheitlichkeit Einigkeit zu schaffen ... Das wahre Problem liegt nicht darin, die Interessen richtig zu vertreten, sondern vor allem darin, eine Autorität zu finden, welche das Schiedsrichteramt ausüben kann. Mit anderen Wor-. ten: die Vertretung der Interessen bleibt eine verlockende Illusion, wenn es nicht darüber hinaus eine unabhängige Macht gibt, die für-Voraussicht und Gerechtigkeit sorgen kann.“
Wahrscheinlich gibt es ein ideales Wahlsystem überhaupt nicht; so wie es auch keine vollkommene Demokratie gibt. Aber in einem bestimmten Zustand der Gesellschaft und des Staates kann es doch geboten sein, dem Mehrheitswahlsystem gegenüber dem Verhältniswahlsystem den Vorzug zu geben. Wer dagegen auf das Beispiel Frankreichs verweisen wollte, wo offensichtlich durch Einführung des Mehrheitswahlsystems gerade jüngst eine überwältigende rechtsradikale Mehrheit in der Volksvertretung geschaffen wurde, darf anderseits aufmerksam gemacht werden, daß sich dort, und zwar schon vorher, das Verhältniswahlsystem ad absurdum geführt hat. Wer weiß, ob nicht das Mehrheitswahlsystem auch in Frankreich schon viel früher hätte eingeführt werden sollen. Demokratie kann auch nicht darin bestehen, daß der Unterschied zwischen Herrscher und Beherrschten einfach ausgelöscht wird, sondern darin, daß die Herrscher sich vor den Beherrschten verantworten müssen und daß die Beherrschten durch Wahl der Herrscher, durch eine gewisse Teilnahme an der Vorbereitung von Entscheidungen, aber auch durch eine möglichst große gesellschaftliche Selbstverwaltung die Verantwortung mittragen. Die moderne Demokratie ist jene Staatsform, in der so viel gesellschaftliche Freiheit als nur möglich und so wenig staatlicher Zwang als unbedingt nötig entwickelt werden.
Die gesellschaftlichen Kräfte trachten, ihren Ausdruck durch „politische Parteien“ zu finden. Weltanschauungsgemeinschaften und Interessengruppen als solche dürften ja kaum imstande sein, in demokratischer Weise politischen Willen zu bilden. Da unsere gegenwärtige Gesellschaftsstruktur pluralistisch ist, kann nur der Staat ihre Geschlossenheit und Einheit garantieren. Für das Parteiwesen bedeutet dies zunächst die Forderung nach mehreren Parteien, die sich grundsätzlich an alle Wähler wenden; also nach solchen politischen Parteien, die einen großen Teil der geistigen und materiellen Interessenkonflikte schon in sich selbst zu bereinigen vermögen, oder dies anderen gesellschaftlichen Einrichtungen überlassen; das ist in der modernen Demokratie die fundamentale Aufgabe großer Parteien: Die stets vorhandenen Gegensätze möglichst schon im vor-staatlichen Bereich zu überwinden und nur die äußersten Fälle an den Staat heranzutragen. Für das, was durch den Staat im Wege der Herrschaft — und sei diese Herrschaft auch entsprechend unserer Kulturstufe nur ein gesetzlicher Zwang — zu regeln übrigbleibt, sollen die Parteien die geeigneten Persönlichkeiten hervorbringen und gegebenenfalls den Ersatz der schon bloßer Routine anheimgefallenen oder verbrauchten Politiker — den „friedlichen Wechsel“, wie es im Englischen heißt — ermöglichen.
Es ist dies das Problem der Elitenbildung, das ebenfalls zu den Grundproblemen der modernen Demokratie zählt. Die von den Parteien dem Staat zur Verfügung gestellten Eliten sind aber nicht mehr Parteien- oder Interessenvertreter! Nur unter solchem Aspekt können auch in der Demokratie dem Staat Ansehen und Autorität gewahrt werden und kann eine fruchtbringende Trennung des gesellschaftlichen und des staatlichen Raumes erfolgen.