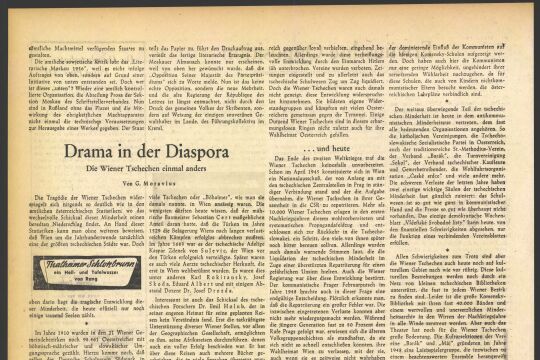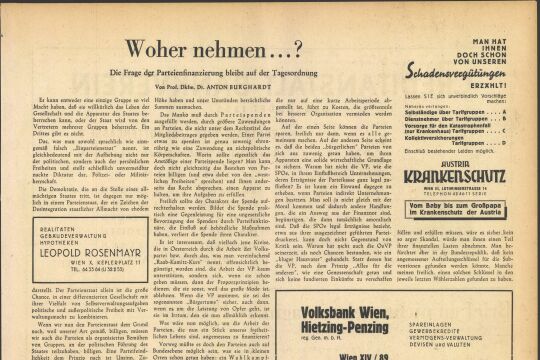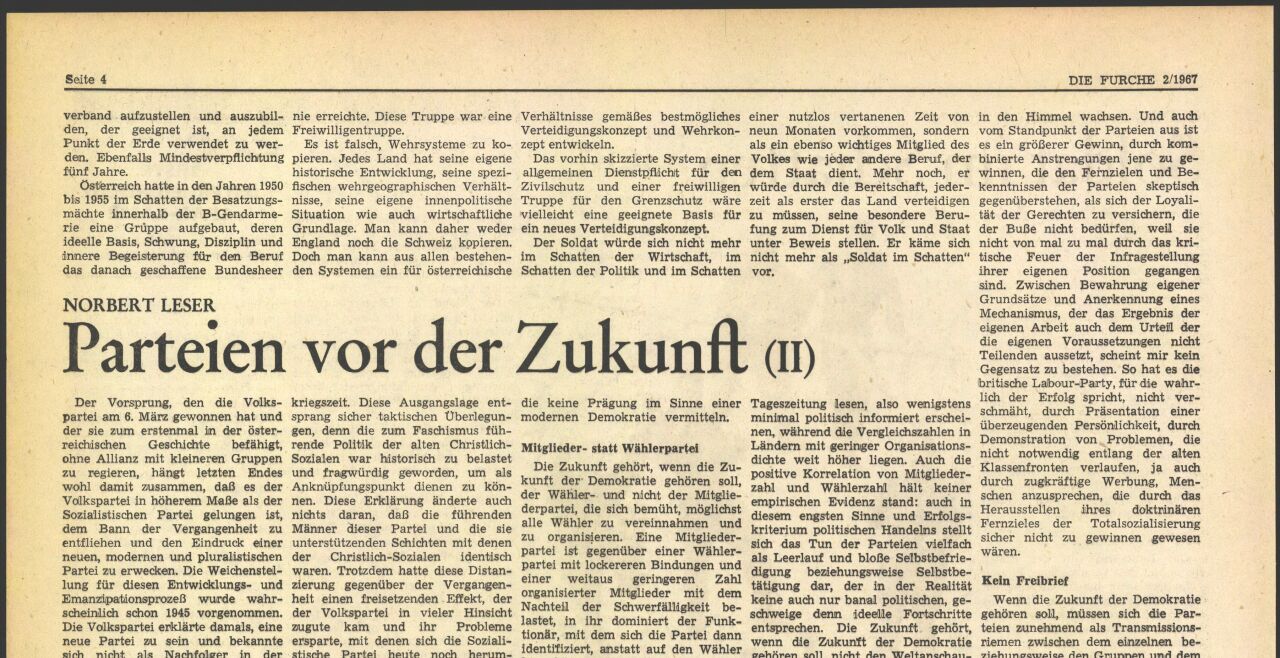
Der Vorsprung, den die Volkspartei am 6. März gewonnen hat und der sie zum erstenmal in der österreichischen Geschichte befähigt, ohne Allianz mit kleineren Gruppen zu regieren, hängt letzten Endes wohl damit zusammen, daß es der Volkspartei in höherem Maße als der Sozialistischen Partei gelungen ist, dem Bann der Vergangenheit zu entfliehen und den Eindruck einer neuen, modernen und pluralistischen Partei zu erwecken. Die Weichenstellung für diesen Entwicklungs- und Emanzipationsprozeß wurde wahrscheinlich schon 1945 vorgenommen. Die Volkspartei erklärte damals, eine neue Partei zu sein und bekannte sich nicht als Nachfolger in der Christlich-Sozialen Partei der Vorkriegszeit. Diese Ausgangslage entsprang sicher taktischen Überlegungen, denn die zum Faschismus führende Politik der alten Christlich-Sozialen war historisch zu belastet und fragwürdig geworden, um als Anknüpfungspunkt dienen zu können. Diese Erklärung änderte auch nichts daran, daß die führenden Männer dieser Partei und die sie unterstützenden Schichten mit denen der Christlich-Sozialen identisch waren. Trotzdem hatte diese Distanzierung gegenüber der Vergangenheit einen freisetzenden Effekt, der der Volkspartei in vieler Hinsicht zugute kam und ihr Probleme ersparte, mit denen sich die Sozialistische Partei heute noch herumschlägt.
Der Zauber der Vergangenheit
Die Soziaiiistische Partei hatte im Jahre 1945 zwar viel weniger Grund, sich von der Vergangenheit des Austromarxismus zu distanzieren, ja sie schien allen Anlaß zu haben, sich die Verdienste und die Größe dieser Vergangenheit zunutze zu machen und von dem moralischen Kapital des Kampfes gegen den Faschismus und für die Demokratie zu zehren. Trotzdem enthüllt die Tatsache, daß diese Vergangenheit reklamiert und doch gleichzeitig nicht voll übernommen wurde, ja übernommen werden konnte, was zum Beispiel in der Änderung des Parteinamens trotz behaupteter Kontinuität zum Ausdruck kam, eine ambivalente und problematische Sachlage, die bis heute nicht bereinigt scheint. Die Größe und der Zauber der Vergangenheit erwiesen sich nicht nur als Segen, sondern auch als nachwirkende Hemmung, als Moment der Fixierung, zu dem dann später das der Regression hinzutrat. So ist es zu erklären, daß es der Sozialistischen Partei trotz der Berufsent-wicklung der Bevölkerung im Sinne eines Zunehmens der unselbständig Erwerbstätigen und einer größeren Allgemeingültigkeit ihres politischen Wollens, ja einer echten und von mir voll bejahten gesellschaftspolitischen Überlegenheit ihrer Ziele nicht gelungen ist, die Mehrheit der Bevölkerung auf ihre Seite zu bringen.
Problem Finanzierung
Doch trotz dieser und anderer Verschiedenheiten zwischen den beiden grpßen Parteien ist es doch so, daß sie beide noch keine Parteien im Sinne der modernen Demokratie sind and daß man sich, solange dies nicht der Fall ist, bei dem Gedanken nicht recht wohlfühlen kann, die österreichische Demokratie ihnen allein anvertraut zu sehen. Die österreichischen Parteien leiden unter einer übersteigerten Selbsteinschätzung, die in der Organisationsdichte und in ihrer expansiven Werbepolitik zum Ausdruck kommt. Keine europäische Partei weist Mitgliederzahlen von der Größenordnung der beiden Hauptlager der österreichischen Innenpolitik auf. Die schädlichen Auswirkungen dieser Verpolitisierung auf die Verwaltung sind bekannt und schon zum Überdruß erörtert. Weniger bewußt ist vielen, daß diese aufgeblähten
Organisationen auch im staatspoliti-schen, ja selbst im engen parteipolitischen Sinn kein Fortschritt sind, sondern sich zu einem die Parteien tyrannisierenden Selbstzweck entwickelt haben. Das Hauptargument, das immer wieder für die Existenz derartig monströser Apparate ins Treffen geführt wird, ist die Notwendigkeit der Deckung der finanziellen Bedürfnisse. Dieses Argument, hinter dem sich die durch das materielle Motiv nur gestützten, aber nicht durch dieses Motiv erzeugten Machtansprüche der Parteien verbergen, könnte ein für allemal aus der Welt geschafft werden, wenn man sich im Zusammenhang mit der Erörterung und Verankerung der Rechtsstellung der politischen Parteien dazu entschließt, auch die Frage der Finanzierung der Parteien rücksichtslos zur Sprache zu bringen und zu einer staatlichen Parteienfinanzierung überzugehen. Eine solche staatliche Parteienfinanzierung, die den Parteien erst die wirkliche gesellschaftliche Anerkennung ihrer Tätigkeit geben und bescheinigen würde, hätte den Vorteil, daß man mit der mehr oder minder versteckten Korruption rund um die Finanzierung der Parteien, mit dem Beschreiten von Schleichwegen am Rande des Gesetzes Schluß machen und zur Sauberkeit des öffentlichen Lebens beitragen könnte. Außerdem aber würde es die Parteien der Notwendigkeit entheben, um des lieben Mitgliedbeitrages willen Organisationsformen aufrecht zu erhalten, die keine Prägung im Sinne einer modernen Demokratie vermitteln.
Mitglieder- statt Wählerpartei
Die Zukunft gehört, wenn die Zukunft der Demokratie gehören soll, der Wähler- und nacht der Mitgliederpartei, die sich bemüht, möglichst alle Wähler zu vereinnahmen und zu organisieren. Eine Mitgliederpartei ist gegenüber einer Wählerpartei mit lockereren Bindungen und einer weitaus geringeren Zahl organisierter Mitglieder mit dem Nachteil der Schwerfälligkeit belastet, in ihr dominiert der Funktionär, mit dem sich die Partei dann identifiziert, anstatt auf den Wähler hinzuhören und um ihn echt zu werben. Auch um das Ausleseprinzip ist es in einer Mitgliederpartei alten Stils nicht zum Besten bestellt: der hochgediente Funktionär ist in den seltensten Fällen der ideale Repräsentant und die wirksame Attraktion. Die Mitgliederpartei entspricht einer unterentwickelten Stufe der Demokratie, als Idee der Generalmobilisierung korrespondiert sie einer sozialen Situation, in der zum großen Sturm geblasen wird. Die Mitgliederpartei politisiert alle Lebensbereiche im schlechten Sinn, ohne sie mit positivem politischem Gehalt zu erfüllen, der politischen Bindung entspricht in den meisten Fällen kein politisches Bewußtsein, die Politik wird daher sich selbst entfremdet, sie wird zu einer erstarrten Fassade für soziologische Prozesse, die ihr über den Kopf wachsen, anstatt von ihr gesteuert zu werden. Die Mitgliederpartei führt zur schleichenden Korrumpierung und zur Aushöhlung des Politischen, sie ist ein Koloß auf tönernen Füßen, der trotz oder gerade wegen seiner Massivität ernsten Belastungsproben nicht standhält.
Der Nimbus der mit ihren Mitgliederzahlen prunkenden und wetteifernden Parteien löst sich in Nichts auf,. wenn man Kontrollkriterien einführt und überprüft, ob der Organisationsdichte vergleichbare politische Qualitäten entsprechen. Denn im nüchternen Kreuzfeuer empirischer Erhebungen stellt sich dann zum Beispiel heraus, daß Österreich zwar über mehr Parteimitglieder verfügt als die meisten entwik-kelten Demokratien, aber in Österreich zum Beispiel nur 49 Prozent der Bevölkerung regelmäßig eine
Tageszeitung lesen, also wenigstens minimal politisch informiert erscheinen, während die Vergleichszahlen in Ländern mit geringer Organisationsdichte weit höher liegen. Auch die positive Korrelation von Mitgliederzahl und Wählerzahl hält keiner empirischen Evidenz stand: auch in diesem engsten Sinne und Erfolgskriterium politischen Handelns stellt sich das Tun der Parteien vielfach als Leerlauf und bloße Selbstbefriedigung beziehungsweise Selbstbetätigung dar, der in der Realität keine auch nur banal politischen, geschweige denn ideelle Fortschritte entsprechen. Die Zukunft gehört, wenn die Zukunft der Demokratie gehören soll, nicht den Weltanschau-ungs- und Klassenparteien alten Stils, die mit Glaubensbekenntnissen, Appellen und Loyalitäten operieren und sich so um den eigentlichen Realitätstest der Leistung und Bewährung herumdrücken. Aus dem Denfcgut der Glaubenspartei alten Stils stammt auch die Vorstellung, daß der Wechselwähler, den man gerne abschätzig als „Flugsand“ charakterisiert, der schlechtere und dümmere Staatsbürger gegenüber dem festgelegten Wähler einer Partei ist, der nicht über ein konkretes Tun und Lassen befindet, sondern am Wahltag seine Treue dokumentiert. Mag sein, daß die empirische Evidenz in Österreich tatsächlich für diese mindere Einstufung der Wechselwähler spricht — doch auch das ist kein gutes Zeichen für die österreichische Demokratie. Denn der Wechselwähler ist geradezu das Salz der Demokratie, er sorgt dafür, daß die Bäume der Parteien nicht in den Himmel wachsen. Und auch vom Standpunkt der Parteien aus ist es ein größerer Gewinn, durch kombinierte Anstrengungen jene zu gewinnen, die den Fernzielen und Bekenntnissen der Parteien skeptisch gegenüberstehen, als sich der Loyalität der Gerechten zu versichern, die der Buße nicht bedürfen, weil sie nicht von mal zu mal durch das kritische Feuer der Infragestellung ihrer eigenen Position gegangen sind. Zwischen Bewahrung eigener Grundsätze und Anerkennung eines Mechanismus, der das Ergebnis der eigenen Arbeit auch dem Urteil der die eigenen Voraussetzungen nicht Teilenden aussetzt, scheint mir kein Gegensatz zu bestehen. So hat es die britische Labour-Party, für die wahrlich der Erfolg spricht, nicht verschmäht, durch Präsentation einer überzeugenden Persönlichkeit, durch Demonstration von Problemen, die nicht notwendig entlang der alten Klassenfronten verlaufen, ja auch durch zugkräftige Werbung, Menschen anzusprechen, die durch das Herausstellen ihres doktrinären Fernzieles der Totalsozialisierung sicher nicht zu gewinnen gewesen wären.
Kein Freibrief
Wenn die Zukunft der Demokratie gehören soll, müssen sich die Parteien zunehmend als Transmissionsriemen zwischen dem einzelnen beziehungsweise den Gruppen und dem Staat, als vermittelnde Größen, verstehen, die weder den einzelnen und das Gruppenleben aufsaugen, noch auch mit dem Staat identisch werden dürfen, wenn der Freiheitsraum für den einzelnen nicht verkürzt oder gar beseitigt werden soll. Die Parteien sollten nicht den Ehrgeiz haben, alle Lebensregungen zu autorisieren und in eigener Regie für die Befriedigung aller menschlichen und gruppendynamischen Bedürfnisse aufzukommen. Die Demokratie ist zwar nach einem berühmten und oft zitierten Wort Churchills die schlechteste Staatsform mit Ausnahme aller anderen uns bekannten — dieser Vorsprung und diese Überlegenheit sind jedoch nur relativ und mit der Auflage eines Minimums an Glaubwürdigkeit und Effektivität belastet, nicht jedoch als Freibrief und Garantie zu verstehen, daß der Demokratie aus diesem Grunde nie eine Konkurrenz erwachsen kann.
Am Puls der Zeit
Auch die Demokratie als ein System von Spielregeln ist ein dem historischen Wandel unterliegender Mechanismus, der nur dann überleben wird, wenn ihn die Parteien so geschickt und verantwortungsbewußt bedienen, daß die Werte, um derentwillen der demokratische Mechanismus betätigt wird, nicht zu Schaden kommen. Auch die Parteidemokratie als solche unterliegt einer potentiellen Konkurrenz, der sie sich ebensowenig zu entziehen vermag wie die Parteien innerhalb der Demokratie. Autoritäre und elttistische Kräfte aller Art sind in vorläufig noch abstrakter Bereitschaft vorhanden, um der Demokratie das Geschäft abzunehmen, wenn die Parteien es zur allgemeinen Unzufriedenheit besorgen. Ja, sie sind unter Umständen bereit, unter Wahrung der alten Formen neuen Impulsen Raum zu geben und sie so vollends unangreifbar zu machen. Sehen wir zu, daß in der zweiten Epoche der Bewährung der österreichischen Demokratie, die eben erst begonnen hat, die Demokraten am Puls der Zeit bleiben und Entwicklungen zuvorkommen und die Spitze abbrechen, anstatt sich von ihnen, wie schon einmal, aus Unaufmerksamkeit und Bequemlichkeit überraschen zu lassen*