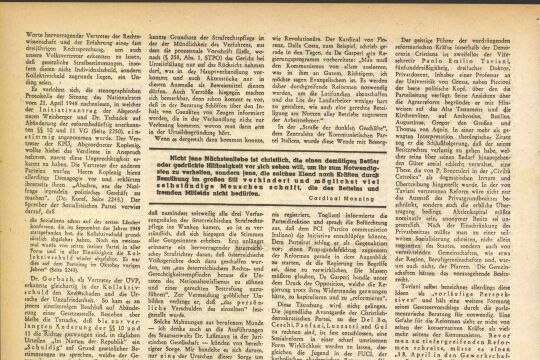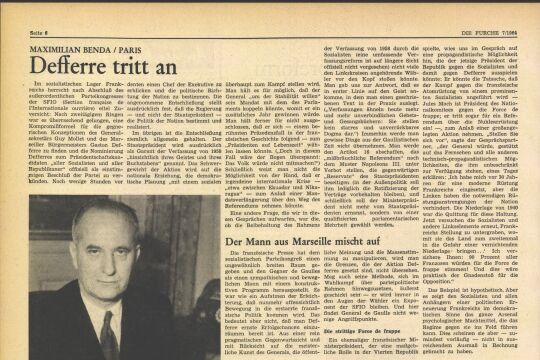Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Saragats Mißvergnügen
Der Ausgang der ersten Wahlen seit der Konstituierung der Regierung der linken Mitte hat' den sozialdemokratischen Außenminister Giuseppe Saragat sehr irritiert. Saragat hat zwar den Parteivorsitz beim Eintritt in das Kabinett Moro-Nenni abgegeben, bleibt aber weiterhin der wortführende Exponent der Sozialdemokratie in Italien. Bei den Wahlen handete es sich zwar nur um die in den Regionalrat der neugeschaffenen fünften und letzten Region mit Sonderstatut, Friaul und Julisch-Venetien mit Triest als Hauptort, doch sind die befragten 750.000 Wähler ausreichend, um die allgemeine Stimmung der Wählerschaft zu testen. Die Sozialdemokraten haben verhältnismäßig die größten Einbußen erlitten, sie sind im Vergleich zu den politischen Wahlen im April 1963 von 10,1 auf 9,3 Prozent der Gesamtwählerschaft zurückgefallen. Es ist für Saragat kein Trost, daß es den Republikanern und vor allem den Sozialisten Pietro Nennis kaum besser ergangen ist. Selbst wenn man zu diesen die abgefallenen „Sozialisten der proletarischen Einheit,f hinzu addiert, bleibt immer noch ein Abgang von 0,3 Prozent. Im Gegensatz dazu hat die Democrazia Cristiana noch etwas Fett anzusetzen vermocht, ihre Anhänger sind von 42,6 auf 43 Prozent angestiegen, und natürlich haben auch die Kommuni-
sten wieder ihren geringen, aber steten Zuwachs zu verzeichnen.
Prokommunistisches Fernsehen
Die demokratischen Linksparteien haben in dem Kurs, der eingeschlagen worden ist, um sie zu kräftigen, schlecht abgeschnitten. Das
Mißvergnügen darüber hat Saragat bewogen, in die politische Dialektik einzugreifen. Er führt den Wahlerfolg der DC und der KP darauf zurück, daß jene wieder die massive Unterstützung des Klerus hat — nach dessen politischer Enthaltsamkeit in der kurzen Periode Johannes'
XXIII. —, diese aber durch die un-eingestandene Willfährigkeit der Christlichdemokraten sich mit ihnen den Einfluß auf das mächtige Propagandamittel des Rundfunks und des Fernsehens teilen können: fünfzig Prozent der Fernsehsendungen seien für die Kommunisten günstig. Dazu komme der Einfluß auf fast das gesamte Filmschaffen und die Kontrolle über große Verlagshäuser, so daß die politische Durchdringungskraft der KP in Italien sogar noch größer sei als der in Polen, obwohl es ein kommunistisches Regime habe. Der Wählerschaft bliebe auf diese Weise nur die Alternative DC oder KP, „deren Tragik ich nicht weiter unterstreichen muß“. Nur ein neues Faktum könne den Ausweg aus der Situation weisen und dieses Faktum könne wieder nur die Schaffung einer großen demokratischen sozialistischen Partei sein.
Dem Problem der sozialistischen Wiedervereinigung ordnet Saragat die Zukunft der linken Mitte unter. Er beobachtet den raschen Verfall der Ideen, die zur „Linksöffnung“ geführt haben, zu einer metaphysischen Betrachtungsweise des gegenwärtigen Kurses, daß sich der Regierungschef Aldo Moro zu dem Ausruf hinreißen ließ: „Die linke Mitte ist ein nicht mehr rückgängig zu machender Prozeß.“ Aber die zerbröckelnde Konjunktur, die sich verflüchtigenden Gold- und Devisenreserven, die um sich greifende Inflation, das Gespenst der Arbeitslosigkeit haben den Höhenflug der Koalition mit den Nenni-Sozialisten gehemmt, derart, daß das Experiment gerade von seinen eifrigsten Befürwortern in Frage gestellt wird. Amintore Fanfani, Hauptideologe der Linksöffnung, hat Moros unvorsichtigen Ausspruch flugs aufgegriffen und mit unbestreitbarer Logik erklärt, daß in der Politik alles rückgängig zu machen sei, auch das Bündnis mit den Linkssozialisten. Der ausgebootete Exministerpräsi-dent verlangt jetzt, was alle Christlichdemokraten gerne hätten, „eine starke DC“, und bereitet seine Rückkehr vor. Verantwortungsvollere Politiker der DC, wie der erklärte Gegner der „Linksöffnung“, Flami-nio Piccoli, spüren jedoch, daß „ein politisches Zurückweichen jetzt leicht. iZU. einer Niederlage für alle demokratischen- Kräfte werden kann“, und warnen davor, die gegenwärtige Formel zu ändern.
Sozialistische Wiedervereinigung?
Saragat beobachet, wie das Bündnis der demokratischen Parteien der linken Mitte in Frage gestellt wird, und will seine Partei nicht mit in den Strudel ziehen lassen. Ihm schwebt für kommende Wahlen ein föderatives Zusammengehen mit den Sozialisten vor, doch ist ihm klar, daß dazu eine gemeinsame ideologische Basis notwendig ist. Er wünscht, daß die Sozialisten in die sozialistische Internationale eintreten, daß sie ihre geistigen Vorbehalte gegenüber den demokratischen Systemen der freien Länder des Westens aufgeben, daß sie auf die überholten Lehrsätze der marxistischen Dogmatik verzichten und schließlich die Politik der linken Mitte in einer realistischen und nicht in utopischer Weise auffassen und nicht geradezu an einen Bruch des Systems denken. Für die Sozialisten ist jedoch das Thema der Vereinigung und schon gar auf der von Saragat gewünschten Basis völlig unaktuell. Es würde das die „Sozialdemokratisierung“ bedeuten, ein ständiger höhnischer Vorwurf der Kommunisten, ein Wort, das die Sozialisten in Furcht und Schrecken versetzt oder sie mit Abscheu erfüllt. Es würde sie den Angriffen der Dissidentenpartei von links her aussetzen. Die kommunistisch-linkssozialistische Gewerkschaft würde auseinanderbrechen. Wahrscheinlich würde man die mit den Kommunisten gemeinsam geführten Kooperativen aufgeben müssen und große Verluste erleiden. Kurz, es kommt gar nicht in Frage.
Nenni trägt das größere Risiko
Es hat sich bewahrheitet, daß die Sozialisten Nennis in dem Unternehmen Linksöffnung das größere Risiko eingegangen sind. Nicht nur haben sie bereits den Preis einer Spaltung erlegen müssen, sie sehen die Möglichkeit vor sich, daß ihnen die Gegenleistung, die geforderten „Strukturreformen“, vorenthalten wird. Auf sie hat Saragat angespielt, als er mahnte, die linke Mitte „realistisch“ zu betrachten. Die auf dem
Seebohms Extratouren
Es blieb Erhard nicht lange Zeit, über die von Strauß herrührenden Schwierigkeiten innerhalb seiner Partei nachzudenken. Kaum war die Schlappe Strauß überwunden, sorgte diesmal ein noch aktiver Bundesminister für eine zweite „außenpolitische Sensation“. Der wegen seiner Sonntagsreden besonders gefürchtete Bundesverkehrsminister Christoph Seebohm forderte in seiner Eigenschaft als Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft die Anerkennung des Münchner Abkommens von 1938, durch das seinerzeit das Sudetenland in Hitlers Großdeutsches Reich eingegliedert worden war. Nun ging er zwar nicht so weit, für die Bundesrepublik territorialen Gewinn zu fordern. Seebohms Äußerungen entbehrten hier etwas der Klarheit. Er forderte „die Rückgabe der geraubten sudetendeutschen Heimatgebiete an das sudetendeutsche Heimatvolk“, lehnte aber sowohl eine Verschiebung der Staatsgrenzen wie eine Rückkehr der Sudetendeutschen in einen tschechischen Nationalstaat ab. Trotzdem erregten seine Worte in Prag unangenehmes Aufsehen und erschwerten die Bemühungen des amtierenden westdeutschen Außenministers, mit der Tschechoslowakei ins Gespräch zu kommen. Nach anfänglichem Schweigen sah sich schließlich der Sprecher der Bundesregierung gezwungen, von Seebohm abzurücken. Seebohm wurde auch zum Kanzler zitiert, aber die einzig mögliche Konsequenz, der Rücktritt des Ministers, erfolgte nicht. So bleibt es der Zukunft überlassen, wer als
nächstes in die deutsche Außenpolitik eingreifen darf.
„Neogaullist“ Willy Brandt?
Der Reigen der „außenpolitischen Sensationen“ wurde schließlich durch den SPD-Vorsitzenden Willy Brandt fortgesetzt. War dieser bisher als Gegner frankophiler Politik aufgetreten, so entdeckte er plötzlich auf seiner Reise durch Amerika sein Herz für de Gaulle. Er hat damit seine eigenen Parteifreunde in einige Verlegenheit gebracht und sie gehindert, in das Chaos außenpolitischer Bestrebungen innerhalb der CDU/CSU einzugreifen. Anderseits war auch die CDU gehindert, die Brandtsche Erklärung auszunutzen. So scheint die sommerliche Hitze bei den deutschen Politikern schon vor ihrem Ausbruch einige Verwirrung angestiftet zu haben.
Einen Erfolg allerdings konnte Willy Brandt verbuchen: Wenn es ihm auch nicht gelungen ist, Präsident Johnson auf seine Politik in der Berliner Passierscheinfrage festzulegen, so konnte er sich doch in aller Öffentlichkeit als Freund des amerikanischen Präsidenten, bezeichnen. Er hat damit mit Ludwig Erhard gleichgezogen. In diesen Tagen erwies sich, daß solche Auszeichnungen nicht jedem Reisenden aus der Bundesrepublik zuteil wird: Der Präsident der Vereinigten Staaten hat sich geweigert, durch einen auch noch so kurz bemessenen Empfang das politische Ansehen des CSU-Vorsitzenden Franz Joseph Strauß zu erhöhen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!