
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Sowjetunion im Dilemma
Niemand kann heute Friedenspolitik treiben, ohne zugleich die Folgen der Koexistenz, auch die ideologischen, in Kauf zu nehmen. Diese Einsicht schafft sich, schwer genug, bei uns im Westen Raum; für den kommunistischen Osten, besonders für die Sowjetuniion, die das 50. Lebensjahr erreicht, enthält diese Erkenntnis jedoch einen Zwiespalt, der in der Nahostkrise, zuletzt in der New Yorker UN-Debatte besonders zum Vorschein kam: Moskau will als Vorkämpfer und Schützer einer weltrevolutionären Bewegung gelten, doch zugleich muß es dem sehr konservativen Gesetz der Supermächte gehorchen, dem Gebot der Selbst-erhaltumg durch Bewahrung des Status quo in der Welt. Zwar verlangt die Ideologie, „nationale Befreiungskriege“ zu fördern, aber die Staatsraison gebietet der Sowjetunion nicht anders als einer westlichen Macht, jeder gewaltsamen Änderung territorialer, militärischer oder politischer Verhältnisse energisch zu widerstreben — nicht nur weil überall lokale Kriege, gleich wer sie beginnt, die Gefahr des Weltkrieges heraufbeschwören, auch weil die ideologischen Fronttinien in der Weflt lange nicht so klar gezogen sind, wie das marxistische Lehrbuch sie wünscht.
Khaled Shundi, einer der starken Männer von Damaskus, der seinen Bart nach Castro-Vorbild trägt und auf dem Schreibtisch ein Bild des kubanischen Partisanenidols Che Guevara stehen hat, breitete dieser Tage vor einem Berichterstatter von „Le Monde“ einige Thesen aus, die erklären, warum er seine bewaffneten Volksmilizen Gewehr bei Fuß stehen ließ und erst nach dem Waffenstillstand durch Kanonaden auf Grenzdörfer einen israelischen Gegenschlag — und so eine Verschärfung der sowjetischen Haltung gegen Israel provozierte: Man könne gegen Israel keinen klassischen Krieg führen, sondern nur einen Volkskrieg; auch dürfe man sich nicht mit Jordanien und anderen „Reaktionären“ verbünden, sagte Shundi. Die syrischen Linksradikalen, in deren Köpfen chinesische und kubanische Ideen spuken, wollen eine Vietnamisierung Palästinas. Und ihre Logik ist dabei eisern: „Selbst wenn es sozialistisch wäre, würde es unannehmbar sein, daß Israel als Staat existiert“, sagte Shundi.
Das aber ist genau der Punkt, an welchem die Sowjetunion und ihre Verbündeten nicht mehr mitgehen. Ihre Status-quo-Politik erlaubt ihnen weder Israels völkerrechtliches Existenzrecht zu bestreiten noch gewaltsame Grenzänderungen durch die Israelis hinzunehmen. Müssen sie doch von Glück sagen, daß ihnen der israelische Präventivschlag wenigstens die Peinlichkeit erspart halt, die angriffslustigen Araber allzu offen bremsen zu müssen und so noch mehr ins ideologische Zwielicht zu geraten, als dies ohnehin geschah.
Andere Verlegenheiten sind geblieben und bestimmen die vielseitige sowjetische Aktivität in der Nahostkrise. In Moskau weiß man inzwischen, daß die arabische Einheitsfront zumindest ideologisch nicht mehr existiert, wenn es sie überhaupt je gab. Und selbst in der ost-westlichen Rivalität, die diese Krise überlagert, verschwimmen die Linien. Man reist und redet: Kos-sygin konnte sich offenkundig in Paris leichter verständigen als bei seinem Besuch in Kuba, Podgorny hatte es in Kairo leichter als in Damaskus und Bagdad, wo jedoch die „progressiven“ Regimes fester im Sattel sitzen als das ägyptische. Zu all dem kommen für Moskau die Rückwirkungen der Krise im eigenen Lager. Sie hat nicht etwa die Evolution in Osteuropa gebremst, sondern gefördert.
Nicht nur, weil im Osten wie im Westen den kleineren Ländern wieder einmal zum Bewußtsein gebracht wurde, wo die Grenzen der Hilfs- und Einsatzbereitschaft der Supermächte liegen; darüber gab es schon vorher wehig Illusionen, aber die Krise hat in den osteuropäischen Ländern vielerlei Emotionen und Überlegungen geweckt, die weiterwirken werden. Auch Titos Jugoslawien macht da keine Ausnahme; man weiß inzwischen, daß der jugoslawische Staatschef seinen Nahostkurs einer bedingungslosen Unterstützung der Araber eigenwillig und ganz allein bestimmte, ohne die zuständigen Gremien in Jugoslawien zu befragen. Vor dem Plenum seines Zentralkomitees hat sich Tito jetzt dafür gerechtfertigt, indem er es schlicht als Unsinn erklärte, wenn jemand glaube, Jugoslawien habe sich in den Warschauer Pakt eingereiht. Tito räumt jetzt sogar ein, daß in den arabischen Ländern, „von denen viele noch feudalistisch seien“, manche Erklärungen abgeben worden seien, die der arabischen Sache gar nicht gedient hätten — und er meinte damit gewiß die Parole von der „Vernichtung Israels“. Tito verteidigte seine heftige Parteinahme für die Araber damit, daß die Blockfreien, also Jugoslawien und Ägypten, im Falle eines Angriffs zusammenhalten müßten. Nun ist aber gerade die Frage der Blockfreiheit bei einem Lande zweifelhaft, das wie Nassers Ägypten in fast totale wirtschaftliche Abhängigkeit von der Sowjetunion geraten ist, während etwa ein anderes arabisches Land wie Jordanien durch viele Interessen mit dem Westen verbunden ist.
Solche Ungereimtheiten bilden zweifellos eines der Motive dafür, daß Rumänien sich nach wie vor in der Nahostkrise zurückhält, obwohl es Mitglied des sowjetischen Bündnissystems ist. Ministerpräsident Maurer sagte vor den Vereinten Nationen in New York: „Wir sind der Ansicht, daß Bemühungen von außen das eigenständige Vorgehen der Länder eines Raumes, ihre gemeinsamen Probleme zu regeln, nicht ersetzen können.“ Das heißt: Rumänien ist gegen die Einmischung der Großmächte in den Nahostkonflikt überhaupt — nicht etwa, weil es besondere Sympathien für Israel hegt, sondern aus eigenem nationalen Interesse wünscht es regionale Selbständigkeit der Länder — im Nahen Osten nicht anders als auf dem Balkan. Mit einer kritischen Anspielung auf diese rumänische Haltung sagte der ungarische Parteichef Käddr: „Heutzutage tauchen bei einzelnen sozialistischen Ländern Elemente der nationalen Absonderung auf... wir sind gegen nationale Isoliertheit und für brüderliche Einheit. Aber das Verhältnis der sozialistischen Länder untereinander ist gegenwärtig nicht störungsfrei. Wir hielten es für notwendig, in der Frage der israelischen Aggression Stellung zu nehmen. Wer damit einverstanden war in Moskau, unterschrieb, wer nicht, der unterschrieb eben nicht...“ Kädär meint die Rumänen; aber er gab in der gleichen Rede zu, daß auch in Ungarn die Stimmung nicht einheitlich war und ist. Tausende von ungarischen Juden seien nach Israel übersiedelt und — so sagte Kadar — „die verwandtschaftlichen und gefühlsmäßigen Bande können die klare Sicht stören“. Kädär beteuerte—und daran spürte man, wie peinlich ihm die Sache ist —, daß die ungarischen Kommunisten stets ohne Vorbehalt gegen Judenverfolgung und Rassendiskriminierung gekämpft hätten und weiter kämpfen würden. Aber dies sei nur die eine Seite der Sache, in der Außenpolitik müsse man prinzipiell urteilen und könne nicht aus Sympathie für die Juden die Aggression Israels billigen. Doch Kädär selbst unterließ es in seiner Rede plötzlich, die Verurteilung Israels als Aggressor zu fordern — wahrscheinlich, weil er die Stimmung im Lande berücksichtigen muß.' In Ungarn, aber auch in Polen und der Tschechoslowakei, sind — ähnlich wie in Österreich und Deutschland — durch die Nahostkrise alte, tiefsitzende Wunden und Komplexe berührt worden. Die regierenden Kommunisten sahen sich mit zwei Tendenzen konfrontiert. Entweder schlug antijüdischer in antiarabischen Antisemitismus um, oder aber trat latente Judenfeindlichkeit plötzlich an die Oberfläche, weil sie im offiziellen Verhalten, der Regierungen ihr politisches Alibi witterte. So wurde nach einem Bericht. von Radio Kossuth (Budapest) zum Beispiel bei Beginn des Krieges ein Privattelegramm an die ägyptische Botschaft gesandt mit der Bemerkung, man hoffe, daß „die Araber nun vollendeten, was Hitler begonnen habe“. Der ungarische Parlamentspräsident Kotlai hatte sich in einer Rede über „innere antisemitische Hetzerei“ zu beklagen, die von antikommunistischen, reaktionären Elementen ausgegangen sei. Nicht minder groß war die Verlegenheit .für die polnischen Kommunisten. Gomulka, der stets fürchtet, die Sowjetunion zu verstimmen, und außerdem schon aus polnischem Eigeninteresse nicht zustimmen kann, daß Grenzen gewaltsam verändert werden, warnte in sehr scharfer Form sogenannte „zionistische Kreise“ polnischer Juden, die sogar „Festgelage“ zum israelischen Sieg abgehalten hätten. In der gedruckten Fassung dieser Gomulka-Rede wurde das dann gestrichen und die Warnung wurde nun an Israel-freunde, „gleich welcher Nationalität“, adressiert, außerdem fügte Gomulka nachträglich einen Satz ein, den er gar nicht gesagt hatte: daß „die überwältigende Mehrheit der polnischen Bürger jüdischer Nationalität loyal dem Lande dient“. Eine unwürdige, von Antisemiten organisierte Demonstration gegen den israelischen Botschafter bei dessen Abreise aus Warschau verschwieg die polnische Presse ebenso wie eine Rede des katholischen Znak-Abge-ordneten Lubienski gegen den Abbruch der Beziehungen zu Israel.
Peinlichkeit über Peinlichkeit also. Die größte aber besteht für die Sowjetunion und ihre Verbündeten in ihrem Dilemma zwischen Ideologie und politischem Realismus, zwischen Revolutions- und Friedenspolitik. Es macht den Weg so dornenreich, den die Kommunisten gehen müssen, wenn sie die Araber befriedigen und zugleich den Nahen Osten befrieden wollen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































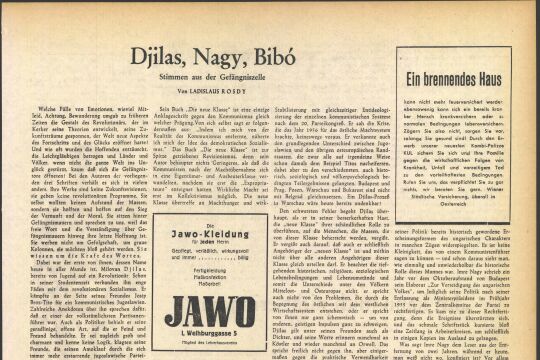






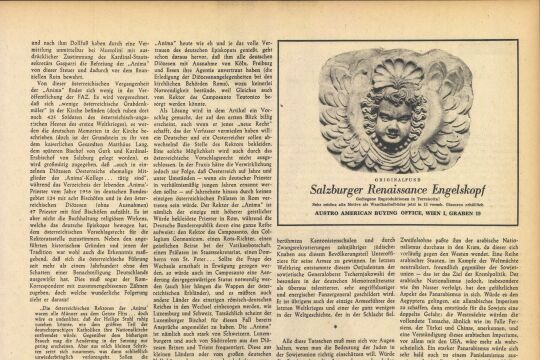




































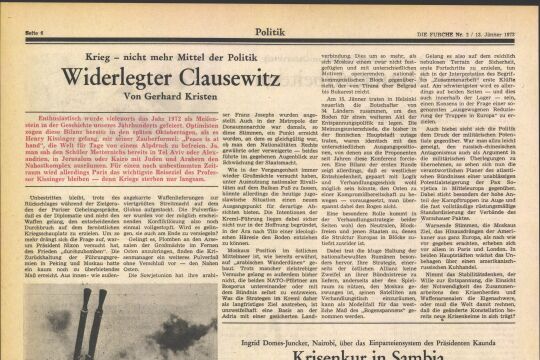



.jpg)















