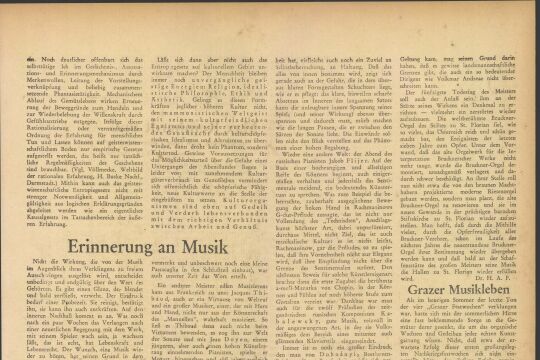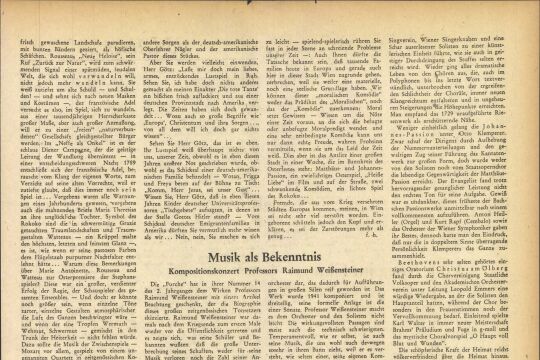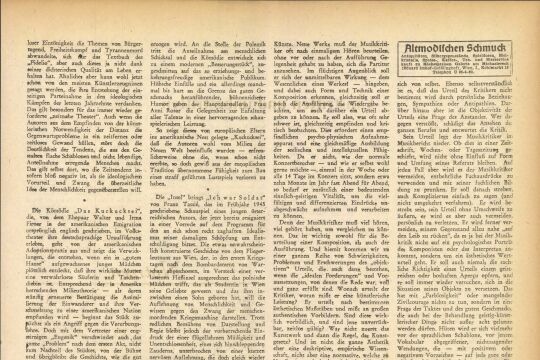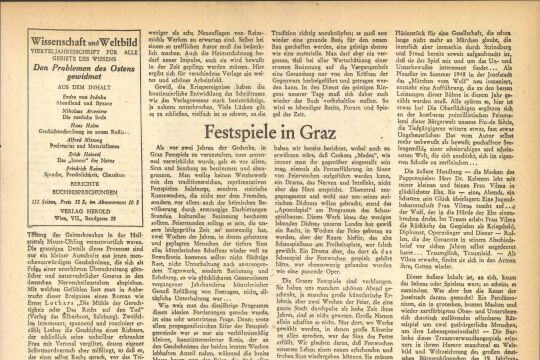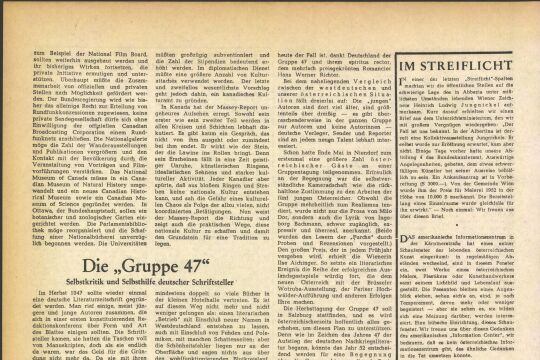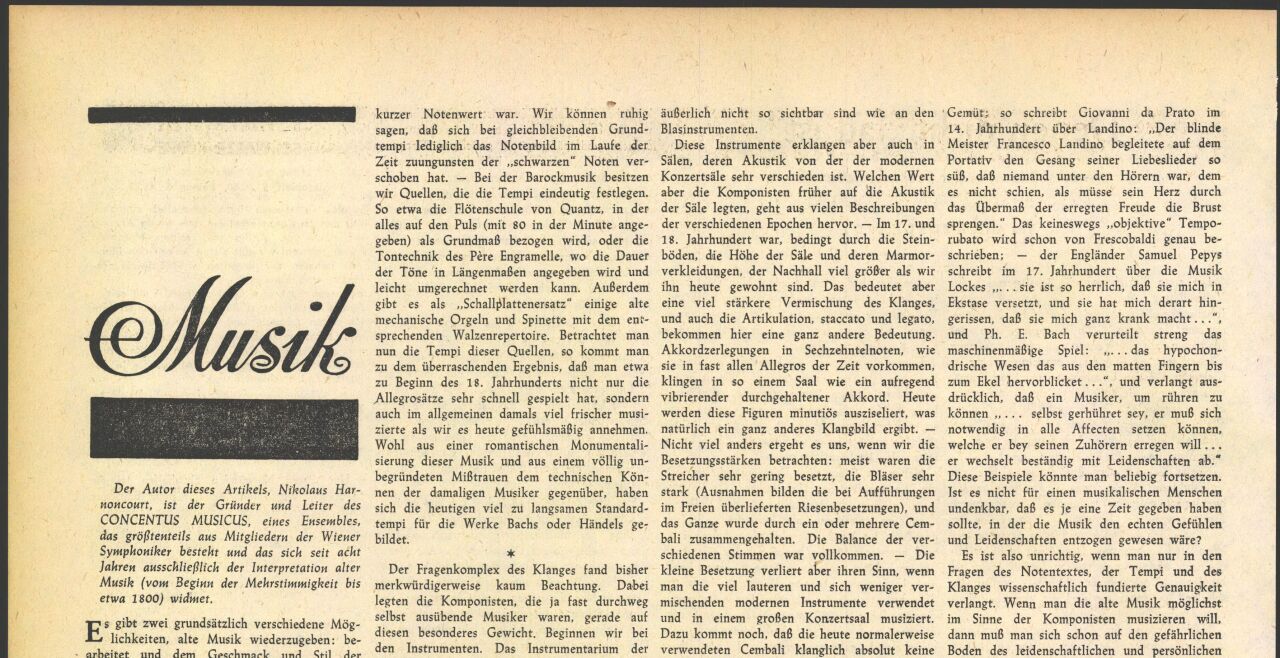
UMGANG MIT ALTER MUSIK
Der Autor dieses Artikels, Nikolaus Har-noncourt, ist der Gründer und Leiter des CONCENTUS MUSICUS, eines Ensembles, das größtenteils aus Mitgliedern der Wiener Symphoniker besteht und das sich seit acht Jahren ausschließlich der Interpretation alter Musik (vom Beginn der Mehrstimmigkeit bis etwa 1S00) widmet.
Der Autor dieses Artikels, Nikolaus Har-noncourt, ist der Gründer und Leiter des CONCENTUS MUSICUS, eines Ensembles, das größtenteils aus Mitgliedern der Wiener Symphoniker besteht und das sich seit acht Jahren ausschließlich der Interpretation alter Musik (vom Beginn der Mehrstimmigkeit bis etwa 1S00) widmet.
Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, alte Musik wiederzugeben: bearbeitet und dem Geschmack und Stil der Gegenwart angepaßt oder aber möglichst genau den Intentionen des Komponisten entsprechend. Die erste Art kennt natürlich keine Regeln der Aufführungspraxis. Wir wollen uns hier, ohne die Frage nach dem Wert dieser beiden Prinzipien zu berühren, der zweiten Art, deren vielzitiertes Schlagwort „Werktreue“ heißt, zuwenden.
Jedem Menschen leuchtet es ein, daß man sich bei einer stilistisch einwandfreien Aufführung genau an den niedergeschriebenen Notentext zu halten hat. Nur wenigen aber ist es bekannt, daß dieser Notentext bei Werken vor 1800 nicht mit den normalen Kenntnissen eines heutigen Musikers lesbar ist. Die heutige Notenschrift entspricht wohl optisch annähernd der des 17. Jahrhunderts — während aber die Komponisten seit dem vorigen Jahrhundert bemüht sind, die rhythmische und melodische Form ihrer Werke eindeutig und mathematisch genau niederzuschreiben, war dies früher keineswegs so. Gleichmäßige Achtelnoten zum Anspiel müssen oft ungleichmäßig gespielt werden, wobei das Verhältnis der längeren zur kürzeren zwischen 3:2 und 4:1 schwankt, also in vielen Fällen gar nicht genau in moderner Notenschrift wiedergegeben werden könnte. Damit wollen wir sagen, daß zu einer Verwertung des „Urtextes“ unbedingt die Kenntnis der Notierungsgewohnheiten der entsprechenden Zeit gehört, um die Noten so lesen zu können wie sie gemeint waren und von den damaligen Musikern auch verstanden wurden. Leider wird heute gerade bei Aufführungen, die besonders korrekt sein wollen, von den Musikern meist verlangt, die Noten akademisch exakt zu spielen, als ob es sich um moderne Musik handelte.
*
Das Verhältnis Komponist — Interpret war früher ein ganz anderes als heute. Die Trennung war nicht so scharf, die meisten Musiker komponierten selbst. Das Musikleben war von einer heute nicht gekannten Lebendigkeit, war doch das Repertoire ausschließlich auf zeitgenössischer Musik aufgebaut. So war dem Improvisatorischen weiter Spielraum gegeben. Es gab eine Unzahl von ungeschriebenen Gesetzen, die den Musikern die Möglichkeit gaben, ja sie dazu verpflichteten, ihr Können und ihre Erfindungsgabe in Variationen und Verzierungen zu zeigen. — Auch der Generalbaß war keineswegs ein starres Begleitungsschema, dem Spieler waren viele Möglichkeiten gegeben, sich dem Raum, der Besetzung und den Zuhörern anzupassen und seine Phantasie und sein Können zu entfalten. Alle diese Voraussetzungen sind den heutigen Musikern, die zu einer ganz anderen Einstellung gegenüber dem Komponisten und ihren Werken erzogen sind, gänzlich fremd. So hört man viele Adagios der Barockzeit heute meist nur in einer kahlen unverzierten Form, und es wäre wohl besser, wenn man wenigstens vorbereitete Diminutionen und Verzierungen spielen würde.
Eine weitere Frage ist die nach den Tempi. Die vorklassische Musik wird heute fast immer relativ langsam gespielt. Der Grund dafür ist bei den Werken des 16. und 17. Jahrhunderts die Notation in für heutige Begriffe langen Notenwerten. Man übersieht leicht, daß die „ganze Note“ urspünglich als „Brevis“ ein kurzer Notenwert war. Wir können ruhig' sagen, daß sich bei gleichbleibenden Grundtempi lediglich das Notenbild im Laufe der Zeit zuungunsten der „schwarzen“ Noten verschoben hat. — Bei der Barockmusik besitzen wir Quellen, die die Tempi eindeutig festlegen. So etwa die Flötenschule von Quantz, in der alles auf den Puls (mit 80 in der Minute angegeben) als Grundmaß bezogen wird, oder die Tontechnik des Pere Engramelle, wo die Dauer der Töne in Längenmaßen angegeben wird und leicht umgerechnet werden kann. Außerdem gibt es als „Schallrilattenersatz“ einige alte mechanische Orgeln und Spinette mit dem entsprechenden Walzenrepertoire. Betrachtet man nun die Tempi dieser Quellen, so kommt man zu dem überraschenden Ergebnis, daß man etwa zu Beginn des 18. Jahrhunderts nicht nur die AHegrosätze sehr schnell gespielt hat, sondern auch im allgemeinen damals viel frischer musizierte als wir es heute gefühlsmäßig annehmen. Wohl aus einer romantischen Monumentali-sierung dieser Musik und aus einem völlig unbegründeten Mißtrauen dem technischen Können der damaligen Musiker gegenüber, haben sich die heutigen viel zu langsamen Standardtempi für die Werke Bachs oder Händeis gebildet.
*
Der Fragenkomplex des Klanges fand bisher merkwürdigerweise kaum Beachtung. Dabei legten die Komponisten, die ja fast durchweg selbst ausübende Musiker waren, gerade auf diesen besonderes Gewicht. Beginnen wir bei den Instrumenten. Das Instrumentarium der verschiedenen Epochen vom 14. bis ins 18. Jahrhundert war einem stetigen Wandel unterworfen. Die Instrumente wurden immer wieder verändert, gänzlich umgebaut, ganze Instrumentenfamilien kamen außer Gebrauch, wurden völlig vergessen und machten wieder anderen, moderneren Platz. Dieser stetige Wechsel wird meist als Aufwärtsentwicklung dargestellt, in der das Schlechtere durch das Bessere verdrängt wurde. — In der Kunstgeschichte ist diese Einstellung längst überholt, man stellt nicht mehr die Kunstwerke verschiedener Epochen wertend einander gegenüber; man sieht nicht mehr, wie es in früheren Epochen üblich war, den Höhepunkt, zu dem alle Verbesserungen führen, in der Gegenwart. Auch bei den Musikinstrumenten erwiesen gründliche Studien und seit Jahren durchgeführte Versuche mit historischen und modernen Instrumenten die Unnahbarkeit dieses Standpunktes. Es zeigt sich, daß jede Verbesserung an einem Instrument mit einer Verschlechterung bezahlt werden mußte. So könnte man, statt von Verbesserungen, eher von Veränderungen sprechen, durch die, dem stetigen Wandel des Geschmacks und den Forderungen der Komponisten entsprechend, immer wieder das klanglich am besten entsprechende Instrumentarium bereitgestellt wurde. Diese Veränderungen betreffen alle Musikinstrumente, auch die Streichinstrumente, an denen sie
äußerlich nicht so sichtbar sind wie an den Blasinstrumenten.
Diese Instrumente erklangen aber auch in Sälen, deren Akustik von der der modernen Konzertsäle sehr verschieden ist. Welchen Wert aber die Komponisten früher auf die Akustik der Säle legten, geht aus vielen Beschreibungen der verschiedenen Epochen hervor. — Im 17. und 18. Jahrhundert war, bedingt durch die Steinböden, die Höhe der Säle und deren Marmorverkleidungen, der Nachhall viel größer als wir ihn heute gewohnt sind. Das bedeutet aber eine viel stärkere Vermischung des Klanges, und auch die Artikulation, staccato und legato, bekommen hier eine ganz andere Bedeutung. Akkordzerlegungen in Sechzehntelnoten, wie sie in fast allen Allegros der Zeit vorkommen, klingen in so einem Saal wie ein aufregend vibrierender durchgehaltener Akkord. Heute werden diese Figuren minutiös ausziseliert, was natürlich ein ganz anderes Klangbild ergibt. — Nicht viel anders ergeht es uns, wenn wir die Besetzungsstärken betrachten: meist waren die Streicher sehr gering besetzt, die Bläser sehr stark (Ausnahmen bilden die bei Aufführungen im Freien überlieferten Riesenbesetzungen), und das Ganze wurde durch ein oder mehrere Cembali zusammengehalten. Die Balance der verschiedenen Stimmen war vollkommen. — Die kleine Besetzung verliert aher ihren Sinn, wenn man die viel lauteren und sich weniger vermischenden modernen Instrumente verwendet und in einem großen Konzertsaal musiziert. Dazu kommt noch, daß die heute normalerweise verwendeten Cembali klanglich absolut keine Ähnlichkeit mit den alten haben. Die modernen sind viel leiser, und man hört meist nur ein metallisches Geräusch, während ein altes Cembalo sehr wohl imstande war, durch seinen glänzenden und intensiven Klang Mittelpunkt eines Ensembles zu sein. Diese Balanceverschiebung dürfte, neben der Saalakustik, wohl die einschneidendste Veränderung des originalen Klangbildes sein.
- iigräepi lab iiti
Wie hat man nun in früheren Jahrhunderten musiziert? Sicherlich nicht so, wie die eingefleischten Antiromantiker, die meinen, daß die Musik des 15. bis 18. Jahrhunderts noch keine Leidenschaft, kein lebendiges Gefühl enthalte, und daß das Wesentliche dieser Musik der kunstvoll konstruierte meist polyphone Satz sei, dem man mit ausdrucksvoller Interpretation nur schaden könne. So entstand für die vorklassische Musik der „objektive“ Aufführungsstil, der heute fast unangefochten als der wahrhaft richtige gilt. Diese Tatsache mag die Hauptschuld daran haben, daß sich ein großer Teil des Publikums (mit Recht) gelangweilt von der so trockenen alten Musik abwandte. Wenn doch alle diese Musiker die vielen Berichte über musikalische Darbietungen läsen, die sich in den Quellen des 14. bis 18. Jahrhunderts in großer Zahl finden! Wo ist hier Objektivität, wo nüchterner Formalismus? — Immer wieder liest man von der Macht der Musik auf das
Gemüt; so schreibt Giovanni da Prato im 14. Jahrhundert über Landino: „Der blinde Meister Francesco Landino begleitete auf dem Portativ den Gesang seiner Liebeslieder so süß, daß niemand unter den Hörern war, dem es nicht schien, als müsse sein Herz durch das Übermaß der erregten Freude die Brust sprengen.“ Das keineswegs „objektive“ Tempo-rubato wird schon von Frescobaldi genau beschrieben; — der Engländer Samuel Pepys schreibt im 17. Jahrhundert über die Musik Lockes „... sie ist so herrlich, daß sie mich in Ekstase versetzt, und sie hat mich derart hingerissen, daß sie mich ganz krank macht...“, und Ph. E. Bach verurteilt streng das maschinenmäßige Spiel: „...das hypochondrische Wesen das aus den matten Fingern bis zum Ekel hervorblicket...“, und verlangt ausdrücklich, daß ein Musiker, um rühren zu können „.. . selbst gerhühret sey, er muß sich notwendig in alle Affecten setzen können, welche er bey seinen Zuhörern erregen will... er wechselt beständig mit Leidenschaften ab.“ Diese Beispiele könnte man beliebig fortsetzen. Ist es nicht für einen musikalischen Menschen undenkbar, daß es je eine Zeit gegeben haben sollte, in der die Musik den echten Gefühlen und Leidenschaften entzogen gewesen wäre?
Es ist also unrichtig, wenn man nur in den Fragen des Notentextes, der Tempi und des Klanges wissenschaftlich fundierte Genauigkeit verlangt. Wenn man die alte Musik möglichst im Sinne der Komponisten musizieren will, dann muß man sich schon auf den gefährlichen Boden des leidenschaftlichen und persönlichen Musizierens wagen. Auch die „richtigste“ Wiedergabe alter Musik hat nur dann künstlerische Berechtigung, wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht für einen toten — „So-war-es-damals “-Demonstrationsstil mißbraucht, sondern als Basis für ein lebendiges und schönes Musizieren verwendet werden. Es ist natürlich auch für ein Publikum, das normalerweise an die Ausdrucksmittel moderner Interpretation gewöhnt ist, sehr schwer, in den ganz anderen Ausdrucksmöglichkeiten anderer Zeiten Befriedigung zu finden; ja es muß eigentlich dieselbe Umstellung vornehmen wie die Musiker, die die alten Instrumente lernen und sich in die stilistischen Gebräuche der verschiedenen Epochen einleben müssen, um ganz natürlich, selbstverständlich und lebendig musizieren zu können.
*
Betrachtet man nun die verschiedenen Forderungen, die an ein wirklich werkgetreues Musizieren gestellt werden müssen, so sieht man, daß- sich die einzelnen Fragen nicht! voneinander trennen lassen: Die alten Instrumente verlangen den entsprechenden Raum — verwendet man im modernen Saal ein Cembalo zu modernen Streichinstrumenten, so entsteht ein unausgeglichenes Klangbild — die Tempi wieder sind mit Akustik, Klang und Technik der Instrumente verknüpft usw. Im großen Konzertsaal lassen sich also schwerwiegende Kompromisse nicht vermeiden, und man kann nur dankbar sein, daß die musikalische Substanz der meisten Werke so stark ist, daß trotz der empfindlichen Verpflanzung in ein ihnen gar nicht gemäßes Klima, noch immer soviel übrigbleibt. Trotzdem müssen wir sagen: Alle Schönheiten eines Werkes, die ganze Atmosphäre der Zeit und die feinsten und tiefsten Intentionen des Komponisten wären nur in einer ganz den Bedingungen der Werktreue entsprechenden, aber nicht leer historisierenden, sondern blutvoll musizierten Ausführung realisierbar.