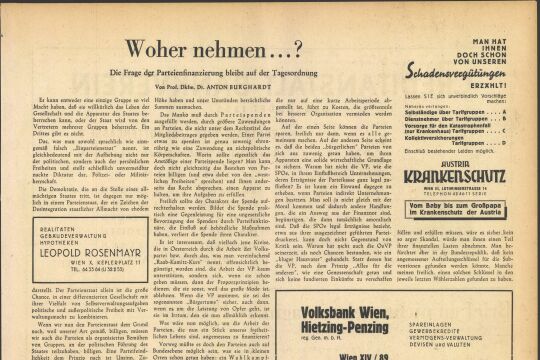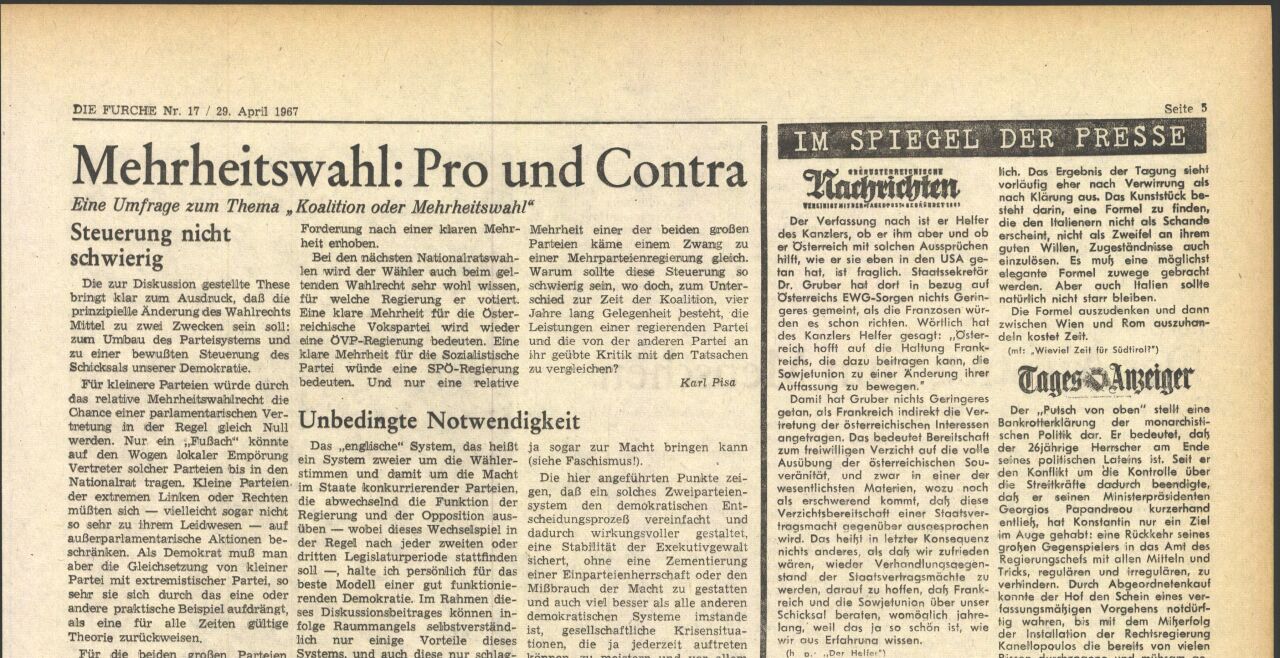
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Unbedingte Notwendigkeit
Das „englische“ System, das heißt ein System zweier um die Wählerstimmen und damit um die Macht im Staate konkurrierender Parteien, die abwechselnd die Funktion der Regierung und der Opposition ausüben — wobei dieses Wechselspiel in der Regel nach jeder zweiten oder dritten Legislaturperiode stattfinden soll —, halte ich persönlich für das beste Modell einer gut funktionierenden Demokratie. Im Rahmen dieses Diskussionsbeitrages können infolge Raummangels selbstverständlich nur einige Vorteile dieses Systems, und auch diese nur schlagwortartig, aufgezählt werden: • Erhöhte Entscheidungsbefugnis des Wählers. Er kennt bereits vor der Wahl den Chef und das Programm der zukünftigen Regierung (identisch mit dem Spitzenkandidaten und dem Wahlprogramm der siegreichen Partei). Er wählt nicht nur das Parlament, sondern gleichzeitig auch die Regierung. Es gibt demnach keine erhandelten, sondern gewählte Regierungen.
• Rasche Regierungsbildung. Bereits wenige Tage nach der Wahl, manchmal sogar schon einige Stunden nach Bekanntwerden des Wahlresultats, kann eine aktionsfähige Regierung gebildet werden. Der Regierungschef, die übrigen Regierungsmitglieder und das Regie-rungsprograrwm stehen ja bereits vor der Wahl fest.
• Stabile Regierungen. Da die Wahlen klare Mehrheitsverhältnisse schaffen, gibt es in der Regel auch keine Regierungskrisen, denn wenn im Parlament nur zwei Parteien vertreten sind, kann die Regierung ja nicht durch parlamentarische Zufallskoalitionen gestürzt werden. Sie kann praktisch erst nach Ablauf der Legislaturperiode bei der nächsten Wahl von den Wählern abberufen werden.
• Ausschaltung aller Splittergruppen und damit der Extremisten aller Schattierungen aus der Politik, da sie bei den Wahlen infolge des Systems der relativen Mehrheitswahl kaum Chancen haben, Mandate zu erobern.
• Entscheidender Einfluß der Wechselwähler auf die Mehrheitsbildung. Eine nicht unbeachtliche Zahl von Wählern, die abwechselnd den beiden Parteien ihre Stimme geben (Pelinka nennt sie die „demokratische Mitte“), sorgt damit auch für den Wechsel von Mehrheit und Minderheit. In ihrer Politik und in ihrer Agitation müssen die beiden Parteien — schon aus rein wahltaktischen Gründen — auf diese Wählerschicht Rücksicht nehmen und nicht auf extremistische Flügelgruppen.
• Krisenfestigkeit. Unzufriedenheit mit der Regierung — etwa in einer wirtschaftlichen Krisensituation — richtet sich gegen die regierende Partei und nicht gegen das demokratische System als solches. Sie kommt der Opposition zugute (die sich ja als die. Alternative anbietet), während sie in einem anderen parlamentarischen System antidemokratische Bewegungen erzeugen, verstärken, ja sogar zur Macht bringen kann (siehe Faschismus!).
Die hier angeführten Punkte zeigen, daß ein solches Zweiparteiensystem den demokratischen Ent-scheidungsprozeß vereinfacht und dadurch wirkungsvoller gestaltet, eine Stabilität der Exekutivgewalt sichert, ohne eine Zementierung einer Einparteienherrschaft oder den Mißbrauch der Macht zu gestatten und auch viel besser als alle anderen demokratischen Systeme imstande ist, gesellschaftliche Krisensituationen, die ja jederzeit auftreten können, zu meistern und vor allem zu überleben. Aus diesen Gründen bin ich auch dafür, dieses System in Österreich zu etablieren, wobei ich glaube, daß die objektiven Voraussetzungen für die Praktizierung desselben hierzulande bereits vorhanden sind, nämlich:
• eine in sprachlicher, kultureller und konfessioneller Hinsicht homogene Bevölkerung;
• ein seit vielen Jahren (alle Wahlen seit 1949 zeigen das) kontinuierlich anhaltender Trend zum Zweiparteiensystem, charakterisiert durch den Zerfall der kleinen Parteien (die FPÖ verdankt ihre parlamentarische und damit auch ihre politische Existenz ausschließlich dem Proporzwahlrecht) und durch die Tatsache, daß bereits mehr als 90 Prozent der Wähler für die beiden großen Parteien votieren;
• die Entwicklung dieser beiden Parteien zu Volksparteien (das heißt sozialer, konfessioneller, ideolo-logischer und regionaler Pluralismus ihrer Wählerschaft);
• die ständige Zunahme der Zahl der Wechselwähler, wofür vor allem die Untersuchungen anläßlich der letzten Wahl den Beweis geliefert haben;
• der stete, zum Teil sogar rapide Zerfall der sogenannten „Lager“, vor allem in bezug auf „Lagerdenken“ und „Lagermentalität“ (die bewußte Förderung dieses Zerfallprozesses sollte übrigens die gemeinsame Aufgabe aller Demokraten sein!), und
• eine zunehmende Stärkung des demokratischen Bewußtseins, sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Politikern der beiden Parteien, ja überhaupt die Herausbildung eines demokratischen Konsensus.
Neben diesen grundsätzlichen Erwägungen erhält das ganze Problem noch einen äußerst aktuellen Akzent, worauf ja bereits Pelinka in seinem Artikel einleitend hingewiesen hat, nämlich die nächsten Wahlen im Jahre 1970. Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß die ÖVP bei dieser Gelegenheit ihre absolute Mehrheit verliert und wir dann wieder vor dem Dilemma stehen: entweder Rückkehr zur großen Koalition unseligen Andenkens oder Bildung einer kleinen Koalition, was für die weitere Entwicklung der Demokratie in unserem Lande sicherlich genausowenig förderlich wäre. Daher halte ich die Einführung des relativen Mehrheitswahlrechtes nach englischem Muster nicht nur für „empfehlenswert“! — um damit auf Ihre spezielle Frage direkt einzugehen —, sondern für eine unbedingte Notwendigkeit. Ohne dieses Wahlrecht ist meiner Meinung nach das Wechselspiel von Regierung und Opposition kaum möglich, es stellt einen Wesensbestandteil des englischen Systems dar.
Ich plädiere außerdem für die unverfälschte Übernahme dieses Wahlrechtes, ohne irgendwelche Korrektureinrichtungen (z. B. eine Zusatzliste für die stimmenstärkste Partei, um ihr auch die Mandatsmehrheit zu sichern), weil ich es nämlich absolut für kein Unglück halte, wenn durch die Zufälle der Arithmetik einmal die stimmenschwächere Partei gleichzeitig zur, mandatsstärkeren wird, was übrigens auch beim VerhältnisWahlrecht passieren kann (<z. B. 1953 und 1959 dn Österreich). Viel wesentlicher erscheint mir, daß beim Mehrheitswahlrecht schon relativ kleine Stimmungsänderungen in der Wählerschaft eine beachtliche Umverteilung der Mandate zur Folge haben können. Auch auf diese Weise wird zweifellos dem Wählerwillen (und damit dem demokratischen Prinzip!) entsprochen, selbst wenn die Arithmetik dabei etwas zu kurz kommen sollte. Es kommt eben hier auf den Geist der Demokratie an und nicht auf die Mathematik!
Zusammenfassend kann gesagt werden: die objektiven Voraussetzungen (das „gesellschaftliche Sein“) zur Einführung eines Zweiparteiensystems nach englischem Vorbild wären vorhanden, die subjektiven (das „Bewußtsein“) müssen erst geschaffen werden. Aber selbst wenn man den Willen zum Umbau unseres politischen Systems hat, ist noch eine Menge sehr ernsthafter Detailarbeit zu leisten. Da hiefür auch eine Änderung unserer Verfassung notwendig ist, müssen beide großen Parteien für die Reform gewonnen werden. Es bleibt uns nicht mehr viel Zeit bis zum Jahre 1970, und deshalb sollte die Diskussion nicht mehr von der Tagesordnung abgesetzt werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!