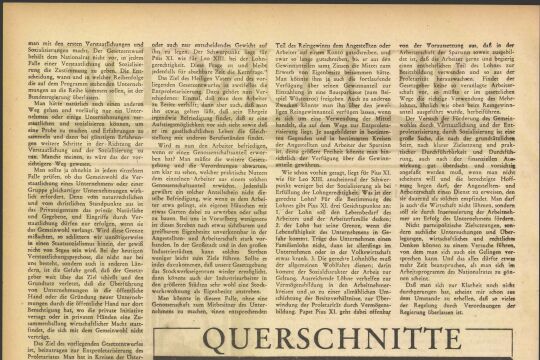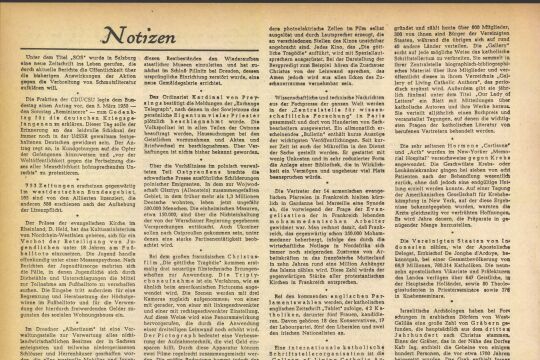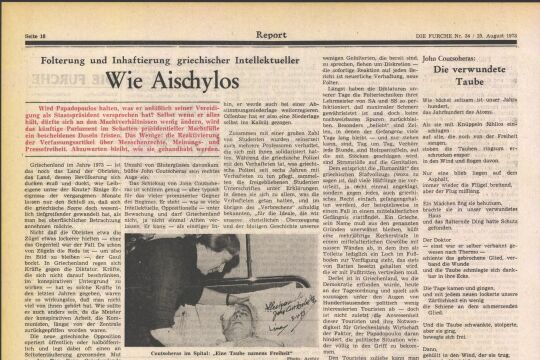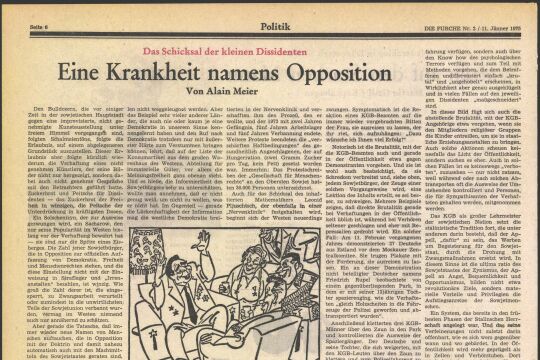Vom Völkermord zum Musterstaat
Vor 25 Jahren wurden in Ruanda knapp eine Million Menschen ermordet. Der Genozid prägt das Land noch immer, aber der Frieden scheint stabil. Lokalaugenschein im Land der tausend Hügel.
Vor 25 Jahren wurden in Ruanda knapp eine Million Menschen ermordet. Der Genozid prägt das Land noch immer, aber der Frieden scheint stabil. Lokalaugenschein im Land der tausend Hügel.
Säuberlich geschlichtet liegen sie da: Oberschenkelknochen auf Oberschenkelknochen, Elle auf Elle, Speiche auf Speiche, Beckenschaufel auf Beckenschaufel, Rückenwirbel auf Rückenwirbel, Schädel an Schädel. Es sind die schaurigen Zeugen des Völkermordes von 1994. In einer Art Gruft ruhen die Gebeine in etwa 70 geschlossenen Särgen und ein kleiner Teil geordnet in Vitrinen. Die Kleidungsstücke und Alltagsgegenstände, die daneben aufgehängt und ausgelegt sind, erinnern daran, dass es großteils einfache Menschen waren, die zwischen 7. April und 4. Juli des Schicksalsjahres hingeschlachtet wurden: Münzen, Kämme, Rosenkränze, Pfeifen, Scherben von Geschirr, Schuhe, Tragetücher für Kleinkinder … Das Völkermord-Memorial in der Stadt Karongi im Westen von Ruanda wurde erst am 1. Juli 2019 eröffnet. Im Gästebuch sind erst wenige Seiten gefüllt.
Milizen ausgebildet
Ein Führer erklärt die nur in ruandischer Landessprache verfassten Tafeln, die Genese und Hergang des Genozids im Bezirk Karongi schildern. Schon mehr als zwei Monate vor dem Massaker, am 1. Februar 1994, hat Bürgermeister Ignace Bagirishema die Ausbildung von Milizen angeordnet, die Polizei und Armee unterstützen sollten. Mit der Akribie von Menschen, die von ihrer Aufgabe überzeugt sind, haben die Strippenzieher jeden Schritt dokumentiert. Die Aussage eines Politikers, „Kein Tutsi darf überleben“, ist dokumentiert. In Karongi begann der Genozid am 13. April, als in anderen Landesteilen das Schlachten bereits eine Woche tobte und Angehörige der Tutsi-Ethnie alarmiert waren. Es wurde verlautbart, die Tutsi sollten sich im Gatwaro-Stadion sammeln, wo man sie vor allfälligen Übergriffen besser schützen könne. In Wahrheit wurden dort rund 15.000 Menschen konzentriert und ohne jede Versorgung gelassen. Geschwächt und verzweifelt waren die hungernden und durstenden Tutsis leichte Beute für die Milizen, die zwei Tage brauchten, um mit Macheten ihren Mordauftrag zu erledigen. Die Schautafeln erzählen auch vom Kinderarzt Leonidas Hitimana, der versuchte, acht Tutsi-Kinder in seiner Abteilung zu schützen, und noch vor den Kindern ermordet wurde. In der katholischen Pfarrkirche Saint Pierre wurden elf Menschen erschlagen, die gehofft hatten, dass der Blutdurst vor geweihten Räumen Halt machen würde. Mit einer gewissen Genugtuung bekommt der Besucher am Ende des Rundgangs die Fotos der Haupttäter zu sehen, von denen einige zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden und noch heute hinter Gittern sitzen.
Heute ist jenseits der zahlreichen Gedenkstätten vom Völkermord, der landesweit geschätzte 800.000 Menschen das Leben kostete, nichts mehr zu bemerken. Ruander, die darauf angesprochen werden, sprechen von einer „schrecklichen Zeit“, die gottlob hinter ihnen liege. Die ethnische Spaltung sei kein Thema mehr. Es sei unmöglich, Hutu und Tutsi an der Physiognomie, am Nachnamen oder dem Herkunftsort zu unterscheiden, sagt der Privatkonsulent Jean-Marie Irakabaho. Sie sprechen die gleiche Sprache und seien durch Generationen von Mischehen nicht auseinanderzuhalten. Wenn das belgische Kolonialregime 1934 nicht die ethnische Zuordnung in Verwaltungsregistern und Ausweispapieren verfügt hätte, wäre der systematische Völkermord kaum möglich gewesen. So schuf die neue Regierung unter Präsident Paul Kagame neue Dokumente, in denen nicht mehr von Tutsi, Hutu oder der winzigen Minderheit der Twa die Rede ist, sondern nur von Banyarwanda, Ruandern. Die rot-gelb-grüne Trikolore wurde 2002 durch eine neue Flagge ersetzt, eine neue, das Gemeinsame preisende Nationalhymne komponiert. Wer heute noch die ethnische Karte spielen will, findet sich schnell wegen „Divisionismus“, also der gezielten Spaltung der Bevölkerung, vor Gericht.
Ruanda wird schon lange als afrikanisches Musterland gesehen, das die innere Einstellung der Bevölkerung durch äußere Sauberkeit zu dokumentieren versucht. An den Straßenrändern findet man, anders als in anderen afrikanischen Staaten, keine Abfälle. Nicht zuletzt als Folge eines Plastiksackerlverbots, lange bevor das in Österreich auch nur diskutiert wurde. In den Städten gibt es nicht nur Gehsteige, deren Randsteine sind auch schwarzweiß bemalt. Verkehrspolizisten setzen ein Geschwindigkeitslimit von 80 km/h auf Landstraßen und 40 km/h in den Städten strikt durch. Und es sind keine Fälle von Verkehrssündern bekannt, die sich mittels Bestechungsgeld von der Strafe freikaufen konnten. Jean-Marie Irakabaho, der unzählige Anekdoten von grotesker Korruption auf dem Kontinent kennt, ist voll des Lobes für eine Polizei, die nach dem Völkermord völlig neu aufgestellt wurde und nicht mehr im Dienst der Mehrheitsethnie steht, sondern ethnisch durchmischt ist und im Dienste der Nation steht.
Ab 1999 hat Ruanda auch eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, die die Gleichstellung der Frau garantieren sollen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!