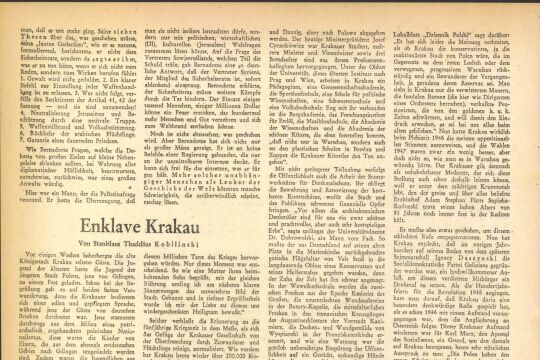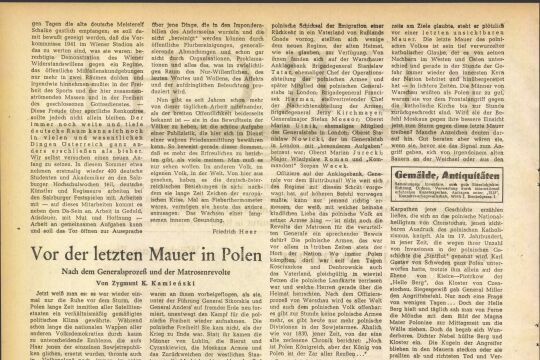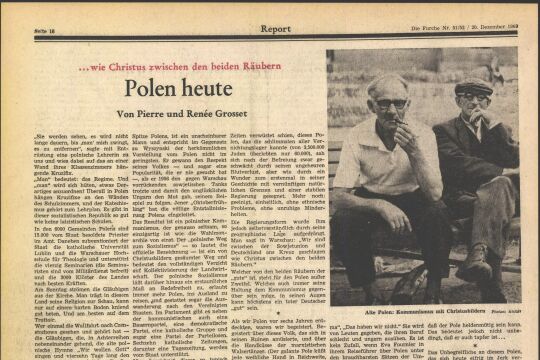In der „Stuttgarter Zeitung“ schildert der deutsch-polnische Autor Artur Becker seine Eindrücke von einer Reise zu einem Volk in Schockstarre.
Als Marschall Pilsudski, der umstrittene Staatschef aus der Zeit zwischen den Weltkriegen, in der Wawel-Kathedrale auf der Burg der polnischen Jagiellonen-Könige beigesetzt werden sollte, gab es in Polen heiße Diskussionen. Selbst im Falle des „Dichterfürsten“ Adam Mickiewicz war sich das Volk nicht einig. Der Präsident Lech Kaczynski und seine Frau Maria haben in Krakau ihre letzte Ruhe gefunden. Sie werden Nachbarn von Pilsudski.
Die beiden wichtigsten Zeitungen meines Landes, „Gazeta Wyborcza“ und „Rzeczpospolita“, haben fleißig die Stimmen der Kritiker und Befürworter der Beisetzung in der Wawel-Kathedrale gesammelt, und da ich in Polen nur Zaungast bin – als Schriftsteller, Emigrant und aufrichtiger Patriot (kein Nationalist!) –, staune ich nicht über die Dialektik, die in all den plausiblen Argumenten für oder gegen eine Wawel-Beisetzung steckt. Denn es geht nicht nur um den heiligen Ort, es geht auch um die Frage, ob man das Unbegreifliche, das Polen mit dem Flugzeugabsturz bei Smolensk widerfuhr, verstehen könne. Und es geht um neue Symbole, die alte nationale und historisch verstaubte Mythen wieder gegenwartstauglich machen sollen. Meine Landsleute diskutieren über die Wawel-Beisetzung, weil sie zwanzig Jahre nach der Wende (die auf Polnisch „Transformacja“ heißt) ihre polnische Identität prüfen müssen. Sie stellen im Grunde genommen zwei Fragen: „Wer sind wir?“ und „Wie konnte Gott nur das Böse, das uns widerfahren ist, zulassen?“ […]
Der Präsident fühlte sich oft nicht verstanden
Eigentlich stand es in den letzten Monaten politisch schlecht um Lech Kaczynski und seine Partei. Die Mehrheit des Volkes wollte einen neuen Präsidenten, das sagten die Umfragen vor der Flugzeugkatastrophe bei Smolensk. Dabei muss man sagen, dass Kaczynski schon seit längerer Zeit Konflikte mied und sich großer Sympathien bei seinen Partnern erfreute. Er wollte eine Versöhnung mit Russland, er hatte sich in der Ukraine und Georgien Freunde gemacht, und das Verhältnis zu Deutschland war wieder friedlich geworden. Man hatte plötzlich den Eindruck – zumindest nachdem Lech Kaczynski den Lissabon-Vertrag unterschrieben hatte, dass dieser Mann gar nicht so europafeindlich und in seinen Vorstellungen von einem Staat und seiner Nation gar nicht so rückständig und gar nicht so altbacken war, wie ihn die Medien überall am liebsten darstellten.
Im Ausland wissen nur wenige, dass er zusammen mit seinem Bruder Jaroslaw für die Solidarnosc-Bewegung und den zweiten Sieg Lech Walesas, der 1990 zum Präsidenten des wieder demokratischen Polens gewählt wurde, Großes geleistet hat. Es gab immer wieder viele Missverständnisse – im Ausland und in seiner Heimat. Der Präsident Lech Kaczynski fühlte sich oft nicht verstanden. […] Doch wie soll man bei all den Särgen, die jeden Tag neu begrüßt und beweint werden, ein rational denkender nüchterner Mensch bleiben? Wie sich jeden Tag sagen, jetzt sei die Zeit für einen Neuanfang da? Und dann kommt auch noch diese prophetische Vulkan-Aschewolke aus Island angeflogen; das zweite böse Zeichen ist da?! Was wird auf der Welt noch schon bald geschehen, fragen sich da die polnischen Katholiken. […]
Was soll nun aus Katyn werden? Eine doppelte Verwundung? Die Russen leiden nun mit den Polen mit. Sie schreiben Gedichte über Katyn, die in polnischen Zeitungen abgedruckt werden. Der Dichter Czeslaw Milosz hat sich oft gefragt, wozu die Poesie gut sein solle, wenn sie den Menschen nicht retten könne. Er hat trotzdem immer weitergeschrieben, in seiner Verzweiflung den Glauben an die Dichtung zum Schluss nie verloren. […] Lech Kaczynski wollte einen starken polnischen Staat. Das polnische Leiden sollte endlich aufhören. Friedlich aufhören. Und dann kam Katyn.
* Stuttgarter Zeitung, 20. April 2010
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!