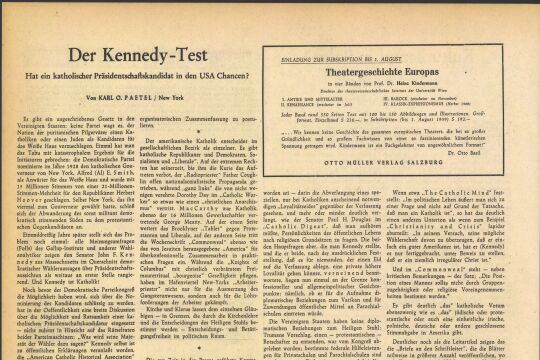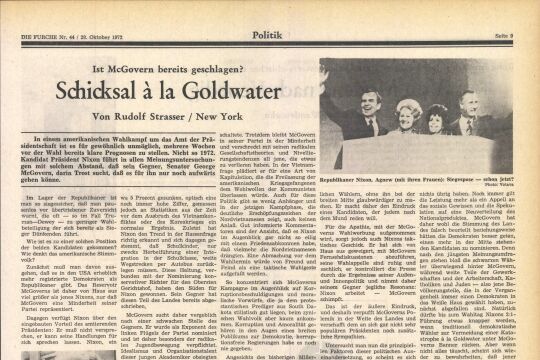Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Amerikas heißester Sommer
Vier Fuß und sechs Inches wird als Länge der Nase angegeben, die Taille mißt 35 Fuß, der Mund ist drei Fuß lang: Die Freiheitsstatue im Hafen von New York ist nicht nur ein verkitschtes, synthetisches Postkartenmotiv, sie wird von den Amerikanern noch immer als Symbol ihres gesellschaftspolitischen Programms angesehen. Jahrzehntelang kippten Überseesegler an einer bestimmten Stelle des New Yorker Hafens ihren aus Schutt und Erde bestehenden Ballast über Bord, bis eine Insel entstand. Auf dieser Insel errichtete Frankreich, das Land, das der Welt die Formel „liberte — egalite — fraternite“ geschenkt hatte, die Statue der Freiheit; als Geschenk für das Land, das der Welt die Menschenrechte formuliert hatte. Jahrzehntelang kippten die aus Europa kommenden Schiffe ihren Ballast ins Meer; bis aus dem Schutt Europas die Freiheit wuchs.
Glanz und Elend
Fährt man mit dem Boot von Bedloes Island, wo die Freiheitsstatue steht, zur Südspitze Manhattans, kommt man ins Herz der amerikanischen Finanzwelt. Die Wall Street liegt in diesem Teil New Yorks; eine Straße der Würde, des Understatements, des verhaltenen Prunks. Die gedämpfte, konzentrierte Atmosphäre, die Anhäufung von Banken und anderen Finanz-inistituiten erinnern an die City von London. Nur den Blick darf man nicht heben, denn dann' merkt man den Unterschied; er besteht aus etwa 30 bis 40 Stockwerken. Wie in London zwängen sich in die Reihen der Häuser, in denen die Giganten irdischer Macht residieren, Kirchen: Trinity Curch, St. Paul's Chapel und die älteste katholische Kirche der Stadt, St. Peter's. Ob diese Nachbarschaft von Geschäftigkeit, die den Weltmarkt diktiert, und Gotteshäusern von einem ausgeprägt guten oder vielleicht doch von einem ausgeprägt schlechten Gewissen derjenigen zeugt, die auf der Lichtseite der Freiheit leben1?
Zehn Minuten muß man nur gehen, um von der Wall Street zur Bowery zu gelangen: New Yorks be-rüchtigste Straße, die East Village durchläuft, das Viertel, das durch den Broadway von Greenwich Village getrennt ist. Zwischen jüdischen und chinesischen Restaurants, zwischen vernachlässigten und schmutzigen Geschäften mit russischen, italienischen und spanischen Aufschriften zeigt sich hier New York von seiner schiimimslten Seite: Mitten auf dem Gehsteig -liegen Menschen; sie schlafen hier ihren Rausch aus, oder sie haben ganz einfach keün besseres Nachtquartier. Zehn Minuten vom Zentrum der Wirtschaftsmacht des reichsten Landes der Erde trifft man eine trostlose, sich offen zur Schau stellende Armut, wie man sie in Europa vielleicht überhaupt nicht finden kann, auf der Schattenseite der Freiheit.
Theater des Protestes
In diesem Bezirk des Elends und der Verkommenheit, am unteren Ende 'der Second Avenue, hat der „La Mama Theater Club“ sein Domizil. Die „New York Times“ nennt diesen Theaterklub das „aktivste Theater Amerikas“. Für einen Dollar kann man im ersten Stock eines nur wenig einladenden Hauses lebendiges, durch keine Konzessionen an das Kommerzprinzip
korrumpiertes Theater erleben. Man spielt „Sarah B. Divine“, ein Stück, das sich höhnisch Musical nennt. Der Autor und die durchwegs hervorragend agierenden (Berufs-) Schauspieler rechnen in diesem Musical, das sieh absurdler Techniken ebenso bedient wie verschiedener Elemente Brechtscher Verfremdung, mit dem Tradiitions- und Kommerztheater ab. „Sarah Bernhard, du mußt göttlich seinl“
Auf der anderen Seite des Broad-ways kann man ein weiteres lebendiges Theater kennenlernen. In Greenwich Village, dem bereits arrivierten, vom Fremdenverkehr überfluteten Künstler- und Intellektuellenviertel, wird „MaoBird!“ gespielt: Die Geschichte vom jungen, strahlenden König John Ken O'Dunc, der auf Betreiben seines Stellvertreters (und Nachfolgers) MacBird ermordet wird. Lyndon B. Johnson als Shakespeares Macbeth — das ist der gegenwärtige literarische und politische Schlager in den USA. In Kürze soll das Stück der in Berkeley graduierten Barbora Carson auch in Washington gespielt werden; an der Kasse werden Masken für diejenigen bereitliegen, die in der Bundeshauptstadt nicht als Besucher eines gegen dien Präsidenten gerichteten literarischen Pamphlets erkannt werden wollen.
Das Wahljahr rückt näher
Lyndon B. Johnson muß sich. 1968 dem amerikanischen Volk zur Wiederwahl stellen — vorausgesetzt, daß er von seiner Partei als Kandidat nominiert wird; aber daran zweifelt eigentlich niemand. Im Gegensatz zu 1964, als Goldtoater gegen den auf dem Höhepunkt seines Ansehens stehenden Johnson keine echten Chancen besaß, rechnen sich die Republikaner für 1968 gewisse Erfolgsaussichten aus. Sie wissen nur nicht, mit welchem Kandidaten und mit welchem Konzept sich diese Aussichten verwirklichen lassen.
„Einen zweiten Goldwater müssen wir unbedingt vermeiden. Ein zweiter GoUdwater bedeutet ein zweites 1964; dieses Jahr brachte unserer Partei eine schwere Niederlage.“ Mr. Nicholson, mit dem wir ein
Gespräch über das amerikanische Parteiensystem führen, ist Vorsitzender der „Jungen Republikaner“ im Staate New York. Nicholson gibt deutlich zu verstehen, an welche Alternative zum Goldwater-Kurs er denkt: Während die „Jungen Republikaner“, einst Barry Goldwaters Hausmacht, auf Bundesebene den Gouverneur von Kalifornien, Ronald Reagan, zu ihrem Favoriten für 1968 gemacht haben, lehnen die New
Yorker Jungrepublikaner Reagan, der Goldwaters Nachfolge in mehr als einer Hinsicht angetreten hat, scharf ab. „Nixon ist immerhin besser als Reagan, aber Leute wie Rockefeiler, Romney oder die Senatoren Jarnts und Brooke sind uns noch viel lieber als Nixon. Jedenfalls hat nur ein liberaler Kandidat mit ,fresh appeal' gegen Johnson Chancen.“
Doch was der liberale Nicholson in New York erzählt, deckt sich keineswegs immer mit dem, was ich in mehreren1 Gesprächen in KaMfornien zu hören bekam. Demokraten oder Republikaner, contra oder pro Reagan (ich sprach unter anderem in Los Angeles mit einem Redlakteur des „Harald Examiner“, einem deklarierten Demokraten): An .der Westküste werden die Chancen des ehemaligen Falmstars, dessen Werbeslogans an die apolitischen Ressentiments der Wähler appellieren („Ronald Reagan — nicht ein glatter Politiker, sondern ein ehrenwerter Schauspieler“), wesentlich höher als im Osten eingeschätzt.
Die liberalen Republikaner haben gegen Reagan keinen zwingenden Kandidaten aufzuweisen. Romney, der Gouverneur von Michigan, hat seine Bewerbung offiziell angemeldet, aber Meinungsumfragen zeigen, daß er nicht sehr populär ist. Seine Haltung zum Vfetnainkrieg ist sehr unklar, und auch sonst haben die Wähler noch keine sehr deutlichen Vorstellungen von seinen Absichten. Außer dem liberalen Romney hat auch ein Konservativer seine Kandidatur vormerken lassen: Nixon, der ewige Verlierer. Reagan ziert sich noch, er weiß noch nicht, ob nicht 1972 für ihn ein besseres Jahr als 1968 ist Rocfcefeller aber, nach wie vor das Idol des liberalen Flügels, wird sich kaum bewerben. Er ist für alle Konservativen des Westens, des Mittelwestens und des Südens der Inbegriff all dessen, was sie am liberalen „dekadenten“ Osten ablehnen.
Die brennende Frage: Vietnam
In den Positionen, die die liberalen und die konservativen Republikaner zur Politik Johnsons einnehmen, erweist sich die Besonderheit des US-Parteiensystems. Wird Johnson von den Konservativen von einer rechten Position aus kritisiert (von Reagan mehr als von Nixon), so kritisieren ihn die Liberalen von links (Rockefeiler mehr als Romney). Die einen werfen Johnson vor, er verletze mit seinem „Feldzug gegen die Armut“ und mit der von ihm initiierten Bürgerrechtsgesetzgebung die verfassungsmäßig geschützten
Rechte der Einzelstaaten und die geheiligten Prinzipien des „american way of life“, so vermerken die anderen, Johneon hätte sein innenpolitisches Programm so lange verzögert, bis es steckenbleiben mußte. Meinen die einen, der amerikanische Einsatz in Vietnam müsse noch intensiviert werden (Reagan: „Die letzte Person in dar Welt, die wissen darf, daß wir keine Atomwaffen in Vietnam einsetzen werden, sollte unser Gegner sein. Er sollte jede Nacht mit der Furcht zu Bett gehen, wir könnten Atomwaffen verwenden“) und ziehen sie sogar einen Präventivkrieg gegen China in Erwägung, so wenden sich die anderen gegen die Eskalation in Vietnam, vor allem gegen die Bombardierung des Nordens.
„Jede amerikanische Eskalation hat bisher nur den Widerstand des Gegners verstärkt und die Zahl der Gefallenen vermehrt“ — mit diesen und ähnlichen kritischen Feststellungen wurde der neue Stern am liberalen Repuiblikanerhimmel bekannt:, Charles H. Percy, Junior-senator von Illinois, werden sogar gewisse Außenseiterchancen für die Präsidenitschaftskandidatur eingeräumt. Daß Percy auch mit den Demokraten Robert Kennedy und Ribicoff zu den Senatoren gehört, die entschiedene Maßnahmen gegen das Elend in den Slums fordern, zeigt,
wie zielbewußt Percy an seiner liberalen Profilierung arbeiltet
Fast 100.000 Amerikaner sind bisher in Vietnam gefallen oder verwundet worden, mehr als 25 Millionen Dollar kostete in den beiden letzten Jahren der Vietnamkrieg den USA (38.052 Dollar in der Minute, haben Ubereifrige ausgerechnet). Warum führen die USA diesen Krieg? Die Interpretation, daß die Situation des US-Kapitalismus ganz einfach nach einem Krieg verlanige, daß der Krieg Motor für die Wirtschaft sein muß (eine Interpretation, die man von links nicht selten zu hören bekommt), wird im allgemeinen auch von den Kritikern Johnsons zurückgewiesen. „Der Vietnamkrieg ist für unsere wirtschaftliche Entwicklung von Nachteil“, meint Tom Caylor vor der Handelskammer in San Francisco bei einem Gespräch. „Der Krieg kostet nicht nur Menschenleben, sondern auch wirtschaftliche Reserven, die — ohne Multiplikatoreffekt — in Vietnam vergeudet werden müssen. Das Geld könnten wir, auch von einem ökonomischen Standpunkt aus gesehen, viel besser in Spitälern, Schulen und Wohnhäusern anlegen.“ Und Henry C. Wallich argumentiert in „Newsweek“: „Ohne Vietnam hätten wir vielleicht eine Rezession. Es wäre die erste nach einer längeren Periode der Expansion, und es gibt keinen Grund für die Annaihme, daß diese Rezession schMimmer wäre als die bisherigen seit dem zweiten Weltkrieg.“ Warum führen aber die Amerikaner Krieg? Um die Freiheit zu verteidigen? Um eine Antwort zu finden,“ sprach ich mit Joseph Buttinger.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!