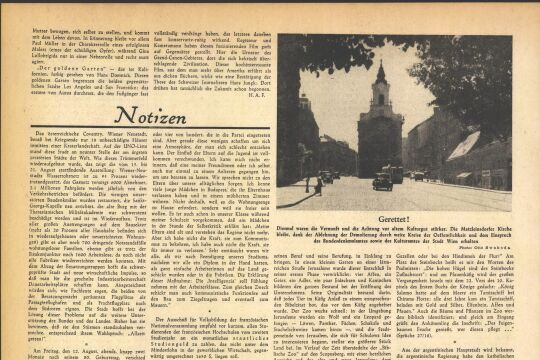Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Aus Deutschlands südwestlicher Ecke
Freiburg, Anfang Juni 1948
Wer „das schöne, milde, sonnbeglänzte, das gottgeliebte Freiburg”, wie Jakob Burck- hardt es nannte, von früher her gekannt hat und nun die Stadt, den bretterverschlagenen Bahnhof verlassend, wieder betritt, ist wahrhaft erschüttert. Denn von dem, was er sieht, konnten weder die Beschreibungen von Reisenden noch die deutschen Filme mit ihren Ruinenlandschaften eine Vorstellung vermitteln. Auch der Anblick der Zerstörungen in unserer eigenen Stadt kann auf diesen Anblick nicht vorbereiten: denn es ist doch ein gewaltiger Unterschied, ob man beim Gang durch eine Stadt einzelne zerstörte Gebäude und schwergetroffene Straßenteile sieht, oder ob man durch eine Ruinenlandschaft wandert und hie und da ein unzerstörtes Haus entdeckt und dann, irgendwo draußen und abseits, unversehrte Straßenzüge findet. Die Zerstörung Freiburgs war das Werk eines einzigen, etwa 20 Minuten dauernden Großangriffs, der von 11.000 Gebäuden über 4000 völlig vernichtete und einen materiellen Schaden von über einer Milliarde Reichsmark anrichtete. Doch was besagt diese Zahl neben den Verlusten an Menschenleben und Kulturwerten? Von der Altstadt mit ihrem reichen Denkmälerbestand aus dem Mittel- alter und der Barockzeit blieb kaum etwas übrig. Zwar ist, trotz schwerer Bombeneinschläge in nächster Nähe, das Münster wie durch ein Wunder unversehrt geblieben, aber die gotische Martinskirche und die barocke Universitätskirche, die hochmittelalterlichen Klostergebäude der Franziskaner und Dominikaner sind zerstört oder ausgebrannt, ebenso wie das spätgotische Kornhaus, die barocke alte Universitätsbibliothek, das Alte Rathaus, die Alte Universität, das erzbischöfliche und das großherzogliche Palais und die schönen alten Patrizier- und Bürgerhäuser. Unbenutzbar sind auch das große und das kleine Haus der städtischen Bühnen, die Festhalle und die drei Konzertsäle der Stadt. — Dies ist der „äußere Rahmen”, in dem sich das Kulturleben Freiburgs abspielt.
Trotzdem finden Abend für Abend Theater- und Opernaufführungen statt, trotzdem tritt etwa einmal im Monat das städtische Orchester mit einem neuen Konzertprogramm vor die Öffentlichkeit, trotzdem gibt es fast täglich eine Kammermusikveranstaltung oder einen wissenschaftlichen Vortrag in deutscher oder französischer Sprache: irgendwo, in einem mehr oder weniger geeigneten Saal. Die Städtische Oper ist in einen Kinosaal übersiedelt, das Theater („Kammerspiele”) in ein ehemaliges Kabarett mit Tanzdiele. Die großen Symphoniekonzerte finden in der Garage der städtischen Straßenbahnen statt, die etwa 2000 Zuhörern Raum bietet und übrigens eine ganz vorzügliche Akustik hat. Sämtliche Veranstaltungen der städtischen Bühnen sind fast Abend.für Abend ausverkauft, die Konzerte können drei- bis viermal wiederholt werden. Die Spielplan- und Konzertprogrammgestaltung ist also, von der finanziellen Seite her gesehen, die geringste Sorge der Freiburger Kunstinstitute. Das Städtische Orchester aber wurde zusätzlich besonders hart getroffen, da nicht nur seine Wirkungsstätten, sondern auch alle Musikinstrumente und das gesamte Notenmaterial in dem „bombensichern” Luftschutzkeller des Stadttheaters verbrannten, wo sie — gemäß einer Verfügung „von oben” — nach der letzten Probe deponiert werden mußten.
Der Spielplan der Bühnen zeigte während der ersten Juniwoche neben bewährten Repertoirestücken „Des Teufels General” von Carl Zuckmayer, Wilders „Wir sind noch einmal davongekommen” und Bernt von Heiselers Nachdichtung des „Philoktet” von Sophokles. Was auf dieser unvorstellbar kleinen Bühne von etwa 6X4 Metern unter der Leitung des Intendanten Franz Evert geleistet wird, verdient uneingeschränkte Anerkennung. Im Casinosaal, auf einer etwas größeren, aber äußerst dürftig ausgestatteten Bühne, sah ich eine sehr sorgfältig einstudierte Aufführung eines hochinteressanten, lebhaft umstrittenen modernen Opernwerkes: Boris Blachers „N achtschwalb e”, die in Leipzig ausgepfiffen worden war und zu der Musikdirektor Schleuning trotzdem den Mut gehabt hat. In diesem „dramatischen Nocturno” tut der Textdichter Friedrich Wolf einen mutigen Griff in die Problematik der Gegenwart. Die einfache Fabel: gelegentlich einer Razzia in einem Vorstadtlokal, das von tanzenden und schwarzhandelnden jungen Menschen bevölkert ist, entdeckt der Kriminalkommissär Schmoerl in der jungen Nelly seine Tochter, die er bisher nicht gekannt hatte und die eben, wie vor 18 Jahren ihre verlassene Mutter, im Begriffe ist, einer Nachtschwalbe gleich, ins versengende Licht zu flattern. Nach einer großen Erkennungsszene verlassen beide das fragwürdige Lokal, und das junge Mädchen hat nicht nur ihren Vater wiedergewonnen, sondern ist auch der Versuchung, der einst ihre Mutter erlag, entrückt. Dies ist der Kern der vom Textdichter ewas kunstlos, vom Komponisten aber äußerst kunst- und wirkungsvoll gestalteten „Moralität”, deren Ablehnung durch die Leipziger nur dadurch zu erklären ist, daß diese eben doch viel leichter aus dem „Gewand”-Häuschen geraten, als die aufgeschlossenen und kunstliebenden Freiburger. Am gleichen Abend wurde — neben dem realistischen Gegenwartsstück 1—1 der „Bajazzo” gegeben, Pseudorealismus des vergangenen Jahrhunderts, und diese Gegenüberstellung war nicht nur in künstlerischer Hinsicht lehrreich und gerechtfertigt.
Inmitten der Stadt, beschädigt, aber benutzbar und von jungem Leben erfüllt, die Freiburger Universität. Ihr Professorenkollegium weist glänzende Namen von europäischem Ruf auf. Schwere Arbeitsüberlastung und materielle Not spiegeln sich in den Gesichtern der akademischen Lehrer deutlicher als im Habitus der Studierenden. Etwas abseits: der Herder-Verlag. Auch hier, im schwerbeschädigten, nur notdürftig hergerichteten Haus, rege Tätigkeit und unverdrossener Kampf mit Schwierigkeiten, wie sie unsere österreichischen Verlage kaum jemals gekannt haben. Ein Rundgang durch die Buchhandlungen der Stadt vervollständigt das Bild: auf den Regalen sieht man kaum ein gutausgestattetes, größeres Buch. Dagegen sind die Auslagetische überchwemmt von zum Teil recht gehaltvollen Zeitschriften und Broschüren, unter denen religiöse, weltanschauliche und politische Traktate im Umfang von 30 bis 100 Seiten den breitesten Raum einnehmen. Und an einem anderen Ende der Stadt: die bfs an die Decke mit Büchern angefüllte Gelehrtenstube und das Krankenlager Reinhold Schneiders, des Verfassers zahlreicher religiöser und essayistischer Schriften, dichterischer Geschichtsdarstellungen und gehaltvoller Gedichtbände. Der Großteil seiner neueren Schriften ist im Herder-Verlag erschienen. Beide, Dichter und Verlag, trugen zur religiösen Neubesinnung unserer Zeit Wesentliches bei und spendeten den gequälten Menschen erste seelische Hilfe und Aufrichtung. Dem Dichter und Menschen aber hat seine Vaterstadt und engere Heimat auch die aufrechte Haltung während des Krieges nicht vergessen, und die Auszeichnung mit dem Droste-Preis, welche dieser Tage erfolgte, konnte kaum Würdigeren zuteil werden als Reinhold Schneider und Gertrud von Le Fort. „Ich freue mich iedesmal, wenn mich eine Nummer Ihres Blattes erreicht. Der ,F u r c h e’ haben wir im Augenblick keine gleichartige Wochenschrift an die Seite zu stellen.” Diese Worte, von diesem Manne gesprochen, der sich — auch in seiner Vaterstadt — größten Ansehens erfreut, nehmen wir nicht als Lob, sondern als Verpflichtung entgegen und als Bekräftigung dafür, daß es überall in der Welt Menschen und Kreise gibt, die mit uns eines Sinnes sind und deren Hauptanliegen das christlich-abendländische ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!