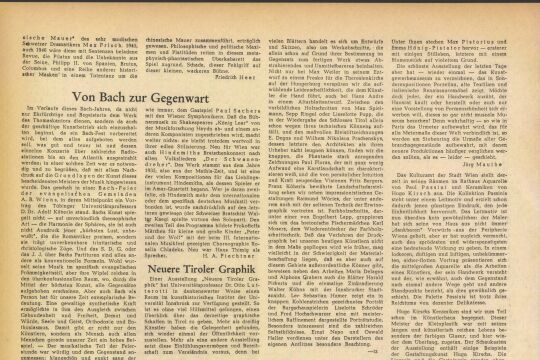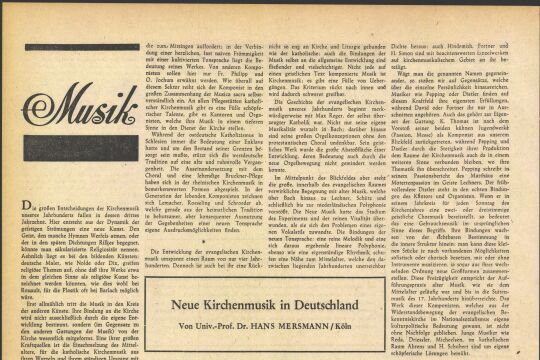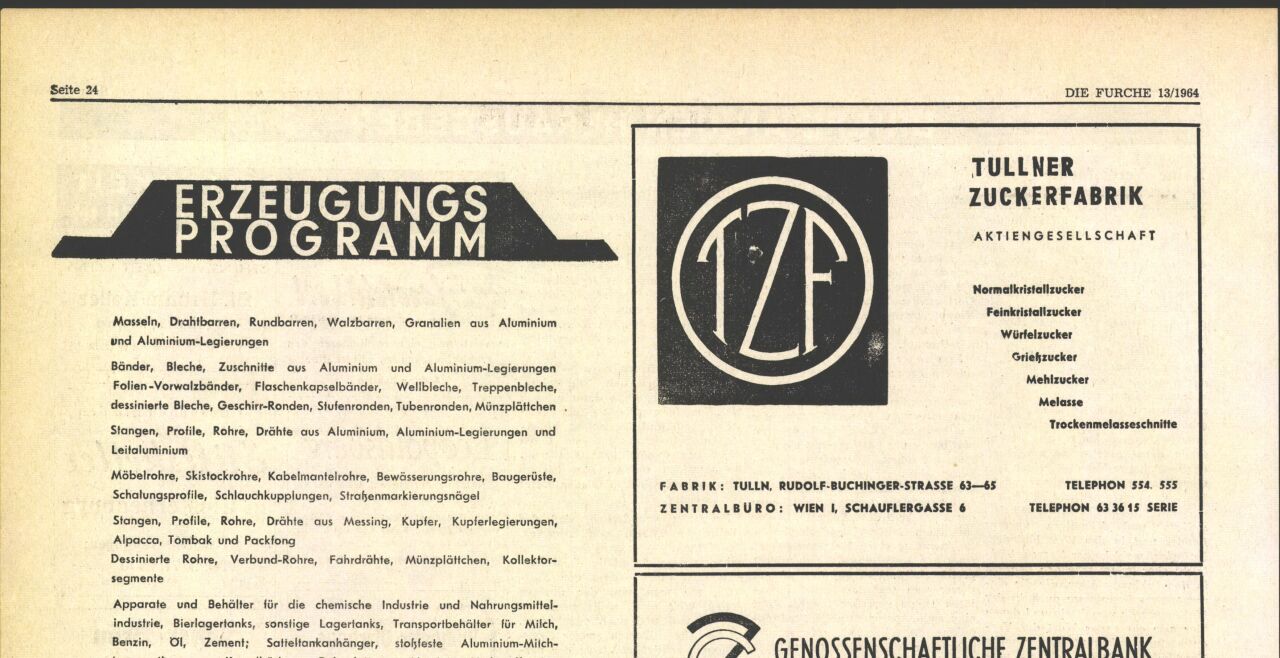
Es kommt bei historischen Betrachtungen stets darauf an, wo man anfängt, wo man die Geschichte beginnen läßt. Die der Orgelmusik müßten wir bis ins graue Altertum zurückverfolgen, das im Hinblick auf Dichtung und bildende Kunst keineswegs „grau“ war, wohl aber für den Musik-forscher infolge mangelhafter und fragwürdiger Quellen recht dunkel ist. Damals schon erklang Orgelmusik. Aber nicht beim Gottesdienst, sondern bei Gelagen und im Zirkus. Im Spätmittelalter drang Orgelmusik nur gegen Widerstände in die Kirche ein, und auf den Konzilien und Synoden mußte man sich immer wieder mit ihren Abarten und Ver-irrungen befassen. Das Tridentinische Konzil zum Beispiel verbot „canzoni lascivi e dehoneste“. Im Protestantismus waren die Meinungen geteilt, von Calvin war das Orgelspiel bis 1638 verboten, aber auch noch später, wurden von Schwärmern und Sektierern Orgeln zerstört. Die Lutheraner waren im allgemeinen duldsamer, der Orgelmusik geneigter, machten sich aber immer wieder über die schwierige Abgrenzung des „Genus“ Sorgen.
Wie nun sollte ein richtiges, auch von der Kirche akzeptiertes Orgelspiel klingen? Mattheson, 1731, wünscht „alles in einem andächtigen, eingezogenen, gründlichen und nachdrücklichen Styl, ohne clavicymbalisches Hacken und Dreschen“. Bald taucht auch der Begriff der „Gravität“ auf, dessen Hauptmerkmal das Pedalfundament ist. Hierüber schrieb Forkel: „Das Pedal ist ein wesentliches Stück der Orgel; durch dies allein wird .sie über alle anderen Instrumente erhoben, indem das Prachtvolle, Große und Majestätische derselben davon abhängt.“ Unter dem Einfluß romantischer Dichtung und Ästhetik wird der Orgel-klang Symbol und Ausdruck des Kirchlichen, ja des Religiösen überhaupt. Dieser „Einstufung“ des Orgelspiels, im consensus omnium, begegnen wir bis in die Zeit des Stummfilms, wo das Harmonium die jugendliche Heldin sanft, aber nachdrücklich zu Grabe geleitete, und wir finden sie auch heute noch in Filmstreifen verschiedenster Art und Provenienz: wenn die obere Sphäre gestreift oder Erhabenes dargestellt wird (sei es nun auf religiösem Gebiet oder dem des triumphalen menschlichen „Fortschritts“), erklingt Orgelmusik, die meist noch — das scheint eine Erfindung der Amerikaner zu sein — von jubelnden Chören überhöht wird.
Doch kehren wir zum eigentlichen Orgelspiel zurück, zu den ersten Meistern dieses Faches. Wir finden sie um 1400 in Florenz, der blühenden Mediceerstadt, wo nicht nur Dichtung und bildende Kunst, sondern auch das Geldwesen in hohem Ansehen stand. Francesco Landino und Antonio Squarcialupi sind die ersten uns bekannten Organistennamen, und ein halbes Jahrhundert später entstehen in Deutschland die ersten wichtigen Orgelbücher: das „Fundamentuni organisandi“ des Konrad Paumann aus Nürnberg und das Buxheimer Orgelbuch von 1470. Hier handelt es sich noch nicht um „kirchliche“ Orgelmusik, die Grenzen sind zunächst fließend: Orgelstücke werden gern als Tafelmusik verwendet, und weltliche Tanzformen (wie Passaoaglia, Ciacona, Gigue und andere) dringen in die Sphäre der Sakralmusik. Die aufgezählten Formen sind von bemerkenswerter Langlebigkeit, begegnen wir ihnen doch auch noch heutzutage in den Partituren der Modernsten. Ebenso zählebig — wenn auch weniger erfreulich — sind die in der Frühzeit der Orgel aufkommenden Transkriptionen von Opemairien, Ouvertüren und Ensembles. Doch über diese Auswüchse und Randerscheinungen später, wir wollen hier nur signalisieren, daß es sie schon vor der ersten Blütezeit der Orgelmusik gegeben hat.
Diese erste Blütezeit erlebt die Orgelmusik zwischen 1550 und 1600 in Venedig, wo die beiden Gabriel! und Merulo als Komponisten und Organisten wirkten. Die von ihnen gepflegten Formen (Toccata, Ricercare, die Fuge mit mehreren Themen, die monothematische Fantasia und die Orgelsonate) wirkten nicht nur auf die Meister in anderen italieni-
schen Städten, sondern auch bis nach Mittel- und Westeuropa — und herauf bis in die Gegenwart. Eine glänzende Erscheinung, als Organist und Komponist, war der Römer Gerolamo Frescobaldi (1583—1643), dessen Schüler der Wiener Hoforganist Johann Jakob Fr oberger und der Nürnberger Johann Pachelbel waren: Meister des Chorals, der Fuge und Partita, der Toccata und der Ciacona. Er selbst, Frescobaldi, war ein Schüler der Niederländer, konzertierte angeblich einmal vor 30.000 Zuhörern und brillierte vor allem in den Toccaten — ursprünglich Probestücken mit schnellen Läufen, um zu prüfen, ob die Technik eines Instruments in Ordnung ist, die Blasbälge genügend Luft geben usw.
Zu Amsterdem wirkte, etwa zwanzig Jahre älter als Frescobaldi, Jan Pieterszoon Sweelinck, der sich seinerseits von den englischen Virginalisten und von dem venezianischen Fugenmeister Gioseffe Zarlino herleitete. Sweelincks bedeutendster Schüler war Samuel Scheidt, der das für die nächste Zeit richtungweisende Werk über die Choralvariation schuf: die „Tabulatura nova“ von 1624. Individueller, beweglicher und genialischer war die Kunst Dietrich Buxtehudes (1637—1707), des Begründers der berühmten Lübecker Abendmusiken, zu denen auch Johann Sebastian Bach pilgerte, in dessen umfassendem und vielgestaltigem Werk sich alle diese Ströme treffen. Sehr verschieden vom norddeutsch-herben und dramatischen Geist Buxtehudes war die Kunst des zu Nürnberg geborenen und in den Städten Eisenach, Er'furth und Gotha wirkenden Johann Pachelbel, des Meisters feiner, meditativer Ohoralvorspiele. Bach kannte auch die französischen _ Orgelmeister Couperin den Älteren und Clerambault, deren Werke durch die Freude an der Farbe charakterisiert ist, die später im Impressionaismus • Triumphe feierte und bereits hier, bei den alten Orgelmeistern, in detaillierten und raffinierten Registriervorschriften zutage tritt.
Von ihnen allen hat J. S. Bach gelernt und wurde zum Vollender fast sämtlicher bis dahin bekannter Formen und Gattungen der Orgelmusik. Der kühne Neuerer, der Vater der nachfolgenden Musikergenerationen ist er nicht gewesen.
, Aber ein genialer Synthetiker — und ein Meister seines Handwerks, wie es ihn kaum je wieder gegeben hat. Seine künstlerische Persönlichkeit, die von tiefer, pietistischer Frömmigkeit geprägt war, manifestiert sich in den zart-besinnlichen Choralvorspielen ebenso stark wie in der gewaltigen Architektur der großen Präludien und Fugen, durch die erstmalig ein transzendentales Element in die Orgelkunst kommt. Von Bachs Universalität mögen die folgenden Werke und vornehmlich gepflegten Form typen. eine ungefähre Vorstellung geben: mehrere Sammlungen von Orgelchorälen, die Vorspiele für Katechismus- und andere Gesänge,' Choralbearbeitungen und Choralpairtiten,- die- Triasonaten, die Toccaten mit Fugen, die Fantasien, die Präludien und Fugen größeren und kleineren Formats, die gewaltige Passa-caglia und die Toccata d-Moll, die durch die Instrumentierung und die Schallplatte Stokowskis weltberühmt (und fast so etwas wie ein „Schlager“ der Orgelmusik) geworden ist, die Übertragung Vivaldischer Konzerte und vieles andere mehr. Die Deutung seines Werkes hat die Forschung (nennen wir nur Albert Schweitzer, der ja selbst Organist ist, und Arnold Schering) intensiv beschäftigt, und die bedeutendsten Komponisten der Gegenwart haben sich durch Orchesterbearbeitungen seiner Orgelwerke zu ihm bekannt: Arnold Schönberg instrumentierte Präludium und Fuge in Es-Dur (St. Anna), sowie die Choralpräludien „Schmücke dich,
• o liebe Seele“ und „Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist“, Webern hat das Ricercare aus dem „Musikalischen Opfer“ und Strawinsky die Ohoralvariationen über „Vom Himmel hoch“ instrumentiert, und in Alban Bergs letztem vollendeten Werk, dem Violinkonzert, erklingt der Bach-Choral „Es ist genug ...“
“Vfach dem gewaltigen Wellenberg — diais Wellental: Ob--L^l wohl Bachs Orgelkumst zunächst einige Fortsetzer fand (in Wilhelm Friedemann Bach, Johann Ludwig Krebs und Johann Christian Kittel) ist bald nach seinem Tod ein starkes Absinken festzustellen: infolge Überhandnehmen des weltlichen Musizierens, Eindringen des galanten und Vorherrschaft des homophonen Stils, wie er vor allem durch die Wiener Klassiker gepflegt wurde. Während der Blütezeit zunächst der klassischen, später der romantischen Symphonie trat die Orgel in den Schatten. Zwar beteuert Mozart in einem Brief aus dem Jahr 1777: „Die Orgl ist doch in meinen äugen und ohren der König aller Instrumenten“, aber das war ein „Lippenbekenntnis“. Weder von ihm noch von Haydn, Beethoven, Schubert oder Schumann gibt es nennenswerte Orgelwerke. Eine Sonate Mendelssohns und Schumanns BACH-Fuge waren nicht mehr als pietätvolle Huldigungen. Jetzt kommt eine andere Art der Orgelkomposition auf, deren erfolgreichster Vertreter der Abbe Vogler ist. Was wunder, daß er großen Sukzess mit Stücken hatte, wie „Marsch der Ritter“, „Barcarole de Venise“, „Belagerung von Jericho“ und „Spazierfahrt auf dem Rhein, von Gewitter unterbrochen“. Ebenso beliebt waren die Transkriptionen: von Beethovens Trauermarsch aus der „Eroica“, von Schumanns „Träumerei“ und dem „Meistersinger“-Vorspiel. Auch Liszt, von dem man angesichts seines halbgeistlichen Standes Besseres hätte erwarten können, segelte in diesem Fahrwasser und behandelte die Orgel als Konzertinstrument mit raffinierten Orchesterklängen und effektvoller Dynamik. — Der aus Hamburg stammende Brahms entzog sich auf dem Gebiet der Orgelkomposition dem Einfluß der Wiener Klassik und schrieb eine Reihe „sauberer“ Präludien, Fugen und Choralvorspiele.
Der einzige, der Bachs großes Erbe als legitimer Nachfolger antrat, war Max Reger (1873 bis 1916), der in seinen vielen Orgelwerken — einem gewaltigen, schier un-ausschöpflichen Opus — zwar von den harmonischen Neuerungen seiner Zeit Gebrauch machte und vor dynamischen Expansionen und Explosionen nicht zurückschreckte, aber doch wieder „orgelmäßig“ schrieb. Das zuweilen Maßlose seiner Art war gepaart mit enormen, wohl von keinem Zeitgenossen überbotenem kompositorischem, speziell kontrapunktischem Können. Reger war selbst ein ebenso großartiger wie virtuoser Orgelspieler, und in Karl Straube fand er einen kongenialen Interpreten. — Als Reger-Nach-folger kann man im deutschen Raum Joseph Haas und Karl Hasse, Hermann Grabner und Günther Ramin bezeichnen, die der Orgel wiedergaben, was der Orgel ist. Die große Wende kam aber erst durch die Orgelbewegung zu Beginn der zwanziger Jahre, als die schönen alten Orgeln von Schnitger (Hamburg, 1925), Silbermann (Freiberg) und Riepp (Ottobeuren, 1927) wiederentdeckt und renoviert wurden. Von jetzt und hier datiert eine völlige Neuorientierung: Rückkehr zu sachgemäßer Einfachheit in Dynamik und Artikulation, die Bevorzugung des „Organum plenum“ als authentischer Klang gegenüber der flexiblen Emotionstechnik, vor allem aber die Einsicht, daß der Klangwechsel durch die Architektur einer Komposition bedingt sein muß. Der aus diesen Erkenntnissen resultierende „neue Stil“ hat sich in Deutschland, Holland, der Schweiz, Skandinavien, England. Frankreich und (teilweise) in den USA früher durchgesetzt, während Italien und Spanien auch heute noch nachhinken.
Nennen wir zum Schluß die Namen der bedeutendsten Orgelkomponisten unserer Zeit. Es sind, wenn wir von der wichtigen französischen Schule um Messiaen absehen, zum Großteil Deutsche und Österreicher, von denen die meisten auch als hervorragende Organisten tätig sind oder waren: Heinrich Kaminski, Paul Hindemith, Hugo Distler, Ernst Pepping, Johann Nepomuk David, Joseph Lechthaler, Anton Heiller. Wolfgang Fortner, H. F. Micheelsen u. a. Ihnen geht es nicht um sterile Sachlichkeit, wohl aber, wie es Fred Hamel einmal formuliert hat, um „jenen Abstand, den ein im Göttlichen beruhender Mensch gegenüber allem Zufällig-Irdischen zu finden trachtet.“ — Vergessen wir aber nicht, daß neben den Schöpfungen einer hohen Kunst die beliebten Transkriptionen, wie sie in Standesämtern und Warenhäusern erklingen, nicht ausgestorben sind: von den Ouvertüren zu „Egmont“ und „Lohengrin“, bis zu den sentimentalen Songs und Zwischenspielen aus „Porgy und Bess“...