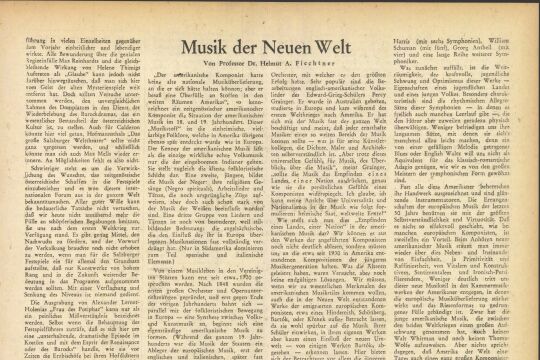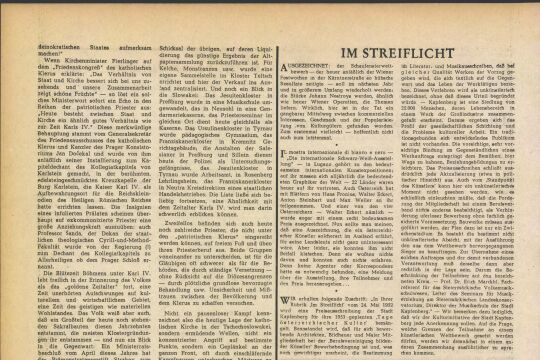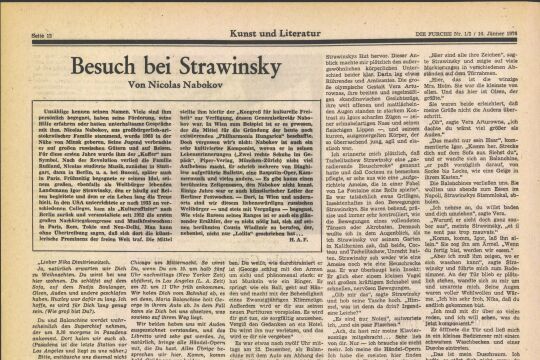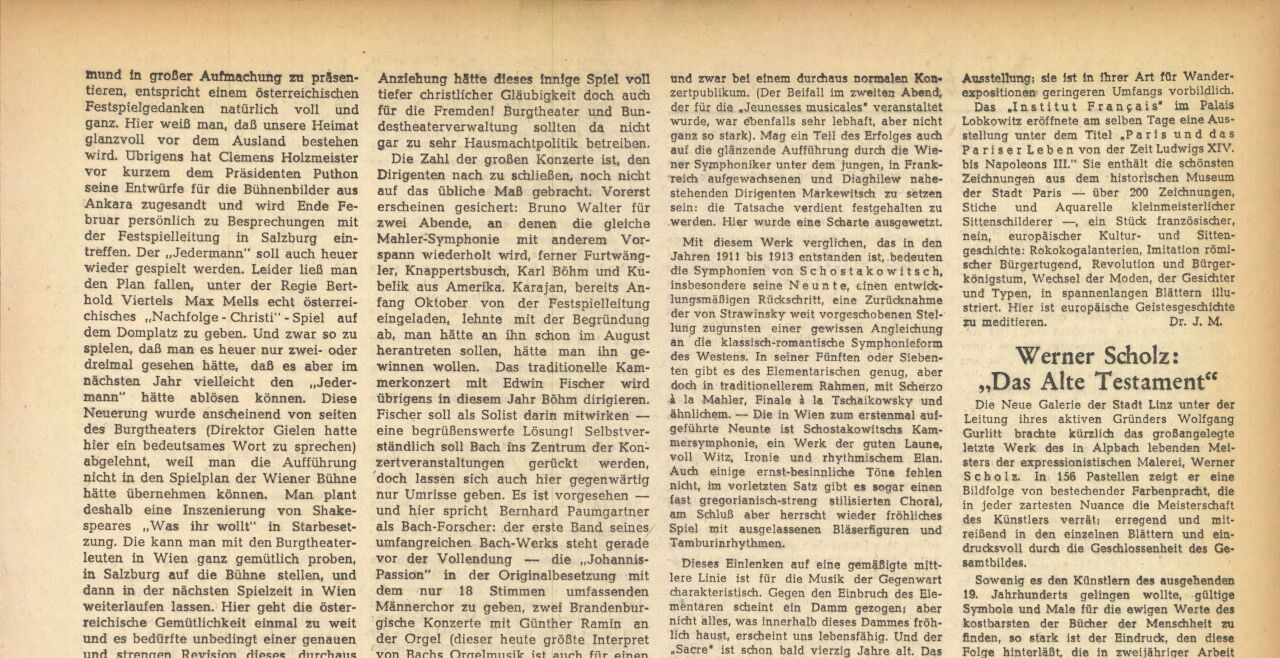
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Einbruch des Elementaren
Daß das Extrem-Subjektive und das Elementare, Vorkulturell-Barbarische in der Kunst eng beieinander wohnen, wissen wir nicht erst seit den Erläuterungen, welche der Humanist Serenus Zeitblom über die Musik seines Freundes Adrian Leverkühn im „Doktor Faustus“ gegeben hat. Es genügt, Dostojewsky zu lesen oder einmal die drei großen Symphonien Tschaikowskys aufmerksam anzuhören, um davon einen zwingenden Eindruck zu empfangen. Zwei Konzerte — das eine unter Igor Markewitsdi, der die VI. Symphonie von Tschaikowsky und den „Sacre du Printemps“ von Strawinsky dirigierte, das andere ein Philharmonisches unter Furtwäng-ler mit Tschaikowskys Vierter und der IX. Symphonie von Schostakowitsch — regen dazu an, diesen Zusammenhängen ein wenig nachzusinnen.
Von keinem anderen Musiker sind Zeugnisse jener Art bekannt, wie sie Tschaikowsky über seine IV. oder VL Symphonie abgelegt hat: daß sie nämlich in jeder Note durch ein Programm bestimmt seien, „das durch und durch von meinem eigensten Sein erfüllt ist, so daß ich, unterwegs in Gedanken komponierend, oft heftig weinte.“ — Diesem extremen Subjektivismus, der zu einer unmittelbaren Selbstdarstellung führt, bezeichnete man früher als „romantisch“, und es ist keine Frage, daß gerade diesem Element Tschaikowskys Kunst einen Großteil ihres Erfolges zu danken hat. Daß er es verstand, seine Gefühle in eine Form zu gießen, die durch die klassisch-romantische Musik, vor allem deutschen und österreichischen Ursprungs, geprägt wurde und damit auch überall, wenigstens als Form, verstanden wurde, bildet die zweite Komponente von Tschaikowskys Weltruhm. Aber immer wieder wird sein an westlichen Vorbildern orientierter Stil getrübt, werden die Schranken der Form durchbrochen: etwa im Finale der Vierten oder im Allegro der Sechsten, besonders deutlich im letzten Satz der Fünften, wo plötzlich ein fast melodieloses Toben des vollen Orchesters beginnt, ein barbarisches Hämmern und Dröhnen, das bereits an Strawinsky erinnert und Schostakowitsch vorwegnimmt.
Den Streit zwischen den „Westlern“ und den „Autochthonen“, dem „mächtigen Häuflein“ der Fünf, zu denen auch Mussorgsky und Rymski gehörten, verstehen wir heute nicht mehr ganz. Im Gegenteil mutet es fast wie eine Ironie an, daß sich Strawinsky in seiner Selbsbiographie — und vor kurzem auch in einem Vortrag — leidenschaftlich zu der ersten Gruppe und ihrer Kunstanschauung bekannte — vor allem zu Tschaikowsky. Denn von diesem hat er fast nichts, höchstens ein paar Barbarismen, die er aber in weit stärkerem Maße mit den „ Autprhthor.en“ teilt. Diese Gruppe vor allem schuf jene Werke, die einen Einbruch des Elementaren in die gesicherten Bezirke der westlichen Kunst bedeuten. Wohl drängten schon seit der Jahrhundertwende, besonders aber in den zwanziger Jahren, auch hier neue — vor allem folkloristische — Kräfte an die Oberfläche, aber sie waren in Deutschland, Frankreich und England zu schwach, um die zeitgenössische Musik maßgebend zu bestimmen. In Italien und Spanien war die Volksmusik noch lebendiger, ihr Einfluß daher bedeutender. Der Hauptimpuls kam aus Rußland und anderen slawischen Ländern, aus Ungarn und Amerika. Da in der vorausgegangenen Entwicklungsphase, dem Impressionismus, die Grundlagen und das Gefüge des musikalischen Satzes erschüttert worden waren, bestimmt die Volksmusik — wie etwa in einem Teil der romantischen Kompositionen — nicht nur gelegentlich die Melodik, sondern durchdringt auch Rhythmik und Klangbild. Genauer: sie ersetzt das klassisch-romantische Kompositionsprinzip und Schönheitsideal durch etwas Neues.
Strawinskys „Sacre du Printemps“ ist nicht nur das Meisterstück, sondern auch das Schulbeispiel für diese Art Musik. Sie ist ohne Tradition, durch keine Schule geformt und durch keinen konventionellen Stil bestimmt. Es gibt darin weder Lyrismen noch Impressionismen, keinen Klangzauber und keine naturalistische Malerei. Die geistige Grundlage dieser Musik ist kultisch-magisch, gespiegelt in einem kühlen Intellekt. Zeichnerische Klarheit, kurzatmige, aber sprengkräftige Motive sowie ein harter, fast brutaler Klang sind weitere Kennzeichen. Motor des Ganzen aber ist der Rhythmus: dumpfpochend, drängend, hämmernd — in einer Vielgestaltigkeit, wie ihn keine andere Partitur aufzuweisen hat. Ebenso wie man den Gegenstand dieser Ballettmusik mit dem Untertitel: „Szenen aus dem heidnischen Rußland“ („Anbetung der Erde“ und „Das Opfer“) nicht nach den Kategorien schön oder unschön beurteilen kann, ebensowenig läßt sich diese Musik, die einem Elementarereignis gleicht, mit den herkömmlichen ästhetischen Maßstäben messen. Wir stehen hier einer fremden, bedrohlichen, magisch-mythischen Welt gegenüber, und es bleibt natürlich jedem überlassen, sich für das „Frühlingsrauschen“ von Sinding zu entscheiden. — Die Aufnahme des Werkes durch das Publikum war völlig unerwartet: der „Sacre“, bei seiner Wiener Erstaufführung — ebenso wie einige Jahre vorher „Petruschka“ — ausgepfiffen und vom Orchester abgelehnt, hatte den größten Erfolg, und zwar bei einem durchaus normalen Konzertpublikum. (Der Beifall im zweiten Abend, der für die „Jeunesses musicales“ veranstaltet wurde, war ebenfalls sehr lebhaft, aber nicht ganz so stark). Mag ein Teil des Erfolges auch auf die glänzende Aufführung durch die Wiener Symphoniker unter dem jungen, in Frankreich aufgewachsenen und Diaghilew nahestehenden Dirigenten Markewitsch zu setzen sein: die Tatsache verdient festgehalten zu werden. Hier wurde eine Scharte ausgewetzt.
Mit diesem Werk verglichen, das in den Jahren 1911 bis 1913 entstanden ist, bedeuten die Symphonien von Schostakowitsch, insbesondere seine Neunte, einen entwicklungsmäßigen Rückschritt, eine Zurücknahme der von Strawinsky weit vorgeschobenen Stellung zugunsten einer gewissen Angleichung an die klassisch-romantische Symphonieform des Westens. In seiner Fünften oder Siebenten gibt es des Elementarischen genug, aber doch in traditionellerem Rahmen, mit Scherzo 4 la Mahler, Finale i la Tschaikowsky und ähnlichem. — Die in Wien zum erstenmal aufgeführte Neunte ist Schostakowitschs Kammersymphonie, ein Werk der guten Laune, voll Witz, Ironie und rhythmischem Elan. Auch einige ernst-besinnliche Töne fehlen nicht, im vorletzten Satz gibt es sogar einen fast gregorianisch-streng stilisierten Choral, am Schluß aber herrscht wieder fröhliches Spiel mit ausgelassenen Bläserfiguren und Tamburinrhythmen.
Dieses Einlenken auf eine gemäßigte mittlere Linie ist für die Musik der Gegenwart charakteristisch. Gegen den Einbruch des Elementaren scheint ein Damm gezogen; aber nicht alles, was innerhalb dieses Dammes fröhlich haust, erscheint uns lebensfähig. Und der „Sacre“ ist schon bald vierzig Jahre alt. Das ist nicht viel für ein Kunstwerk, aber ein beträchtliches Alter innerhalb einer Kunstrichtung, die schon bei ihrer Geburt totgesagt wurde.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!