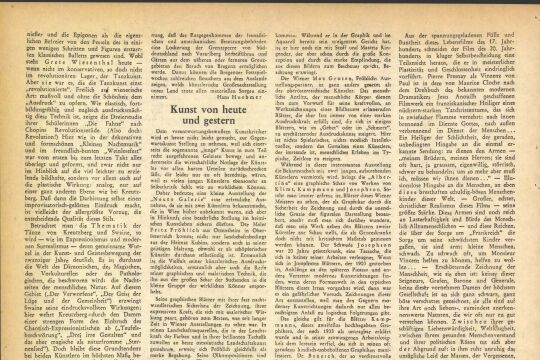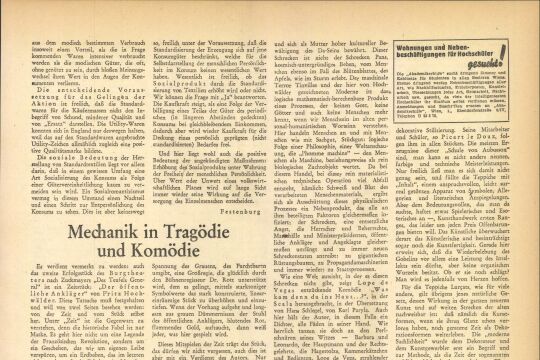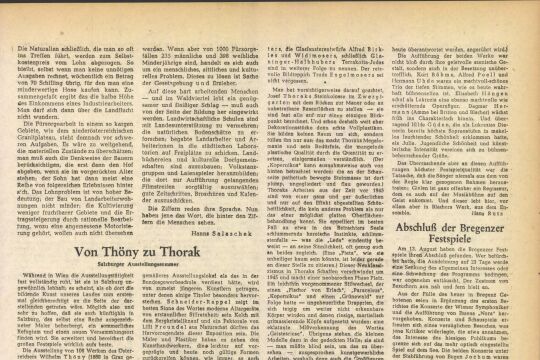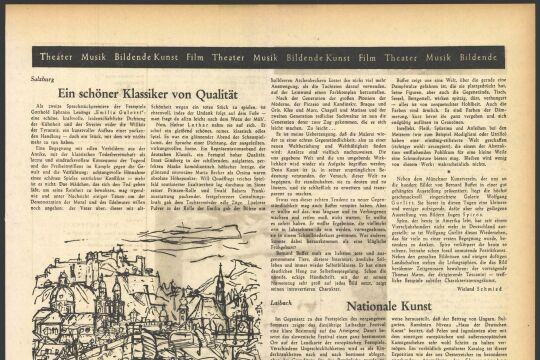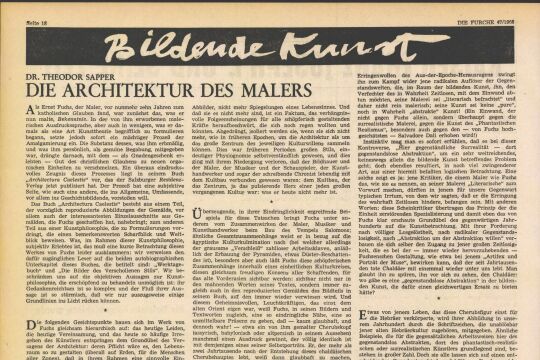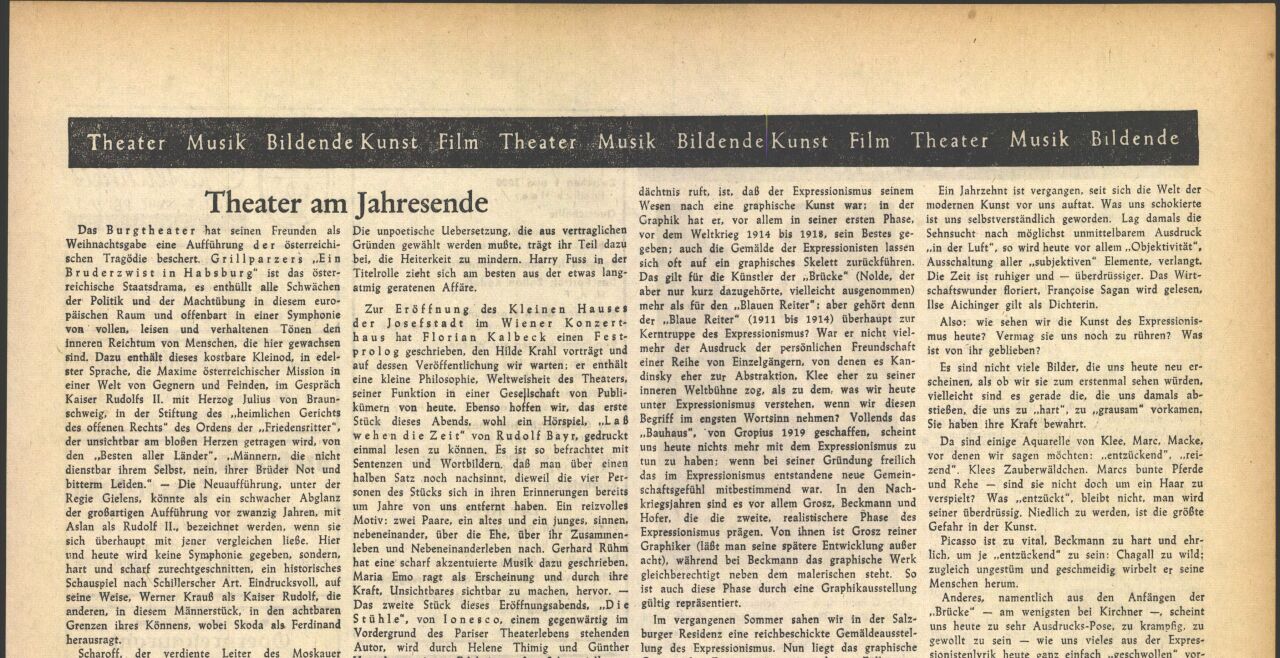
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Expressionismus — gesehen 1958
Die große Herbstausstellung der Albertina (Wien I, Augustinerstraße) ermöglicht eine Neubegegnung mit der Graphik des Expressionismus. Gezeigt werden etwa 310 Arbeiten von 47 Künstlern. Am stärksten vertreten sind die Künstler der „Brücke“ (1904 bis 1913) sowie Klee, Marc, George Grosz und Max Beckmann.
Was diese großartige Ausstellung zunächst ins Ge-
dächtnis ruft, ist, daß der Expressionismus seinem Wesen nach eine graphische Kunst war; in der Craphik hat ei, vor allem in seiner ersten Phase, vor dem Weltkrieg 1914 bis 1918, sein Bestes gegeben; auch die Gemälde der Expressionisten lassen sich oft auf ein graphisches Skelett zurückführen. Das gilt für die Künstler der „Brücke“ (Nolde, der aber nur kurz dazugehörte, vielleicht ausgenommen) mehr als für den „Blauen Reiter“: aber gehört denn der „Blaue Reiter“ (1911 bis 1914) überhaupt zur Kerntruppe des Expressionismus? War er nicht vielmehr der Ausdruck der persönlichen Freundschaft einer Reihe von Einzelgängern, von denen es Kan-dinsky eher zur Abstraktion, Klee eher zu seiner inneren Weltbühne zog, als zu dem, was wir heute unter Expressionismus verstehen, wenn wir diesen Begriff im engsten Wortsinn nehmen? Vollends das „Bauhaus“, von Gropius 1919 geschaffen, scheint uns heute nichts mehr mit dem Expressionismus zu tun zu haben; wenn bei seiner Gründung freilich das im Expressionismus entstandene neue Gemeinschaftsgefühl mitbestimmend war. In den Nachkriegsjahren sind es vor allem Grosz, Beckmann und Hofer, die die zweite, realistischere Phase des Expressionismus prägen. Von ihnen ist Grosz reiner Graphiker (läßt man seine spätere Entwicklung außer acht), während bei Beckmann das graphische Werk gleichberechtigt neben dem malerischen steht. So ist auch diese Phase durch eine Graphikausstellung gültig repräsentiert.
Im vergangenen Sommer sahen wir in der Salzburger Residenz eine reichbeschickte Gemäldeausstellung des Expressionismus. Nun liegt das graphische Oeuvre der Expressionisten in seltener Fülle ausgebreitet vor uns. Und da stellt sich die Frage: Was bedeutet uns der Expressionismus heute, 1958? Mit welchen Augen sehen wir ihn, nachdem mehr als fünf Jahrzehnte seit seinem Beginn und etwa drei Jahrzehnte seit seiner Phase des letzten Glanzes vergangen sind?
Als wir — das „wir“ soll hier ganz allgemein für die Nachkriegsgeneration des zweiten Weltkrieges stehen, für alle, die etwa um 1947 begannen, regelmäßig in Ausstellungen der „neuen“ Kunst zu gehen — zum erstenmal die Bilder der Expressionisten sahen, waren wir betroffen und begeistert, schokiert und ergriffen. Wir spürten das Neue, das ganz Andere, daä imbedingte Streben nach Wahrhaftigkeit, den verzweifelten Schrei in den verzerrten Gesichtern der Menschen. Ein furchtbarer Krieg, der uns gerade noch in seinen Strudel gezogen und einen Blick in den Abgrund hatte werfen lassen, war eben vorbei; die Dichtungen eines Wolfgang Borchert waren damals Ausdruck der Stunde, das: Nie wieder!, das daraus sprach.
Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit sich die Welt der modernen Kunst vor uns auftat. Was uns schokierte ist uns selbstverständlich geworden. Lag damals die Sehnsucht nach möglichst unmittelbarem Ausdruck „in der Luft“, so wird heute vor allem „Objektivität“, Ausschaltung aller „subjektiven“ Elemente, verlangt. Die Zeit ist ruhiger und — überdrüssiger. Das Wirtschaftswunder floriert, Francoise Sagan wird gelesen, Ilse Aichinger gilt als Dichterin.
Also: wie sehen wir die Kunst des Expressionismus heute? Vermag sie uns noch zu rühren? Was ist von ihr geblieben?
Es sind nicht viele Bilder, die uns heute neu erscheinen, als ob wir sie zum erstenmal sehen würden, vielleicht sind es gerade die, die uns damals abstießen, die uns zu „hart“, zu „grausam“ vorkamen. Sie haben ihre Kraft bewahrt.
Da sind einige Aquarelle von Klee, Marc, Macke, vor denen wir sagen möchten: „entzückend“, „reizend“. Klees Zauberwäldchen. Marcs bunte Pferde und Rehe — sind sie nicht doch um ein Haar zu verspielt? Was „entzückt“, bleibt nicht, man wird seiner überdrüssig. Niedlich zu werden, ist die größte Gefahr in der Kunst.
Picasso ist zu vital, Beckmann zu hart und ehrlich, um je „entzückend“ zu sein: Chagall zu wild: zugleich ungestüm und geschmeidig wirbelt er seine Menschen herum.
Anderes, namentlich aus den Anfängen der „Brücke“ — am wenigsten bei Kirchner —, scheint uns heute zu sehr Ausdrucks-Pose, zu krampfig, zu gewollt zu sein — wie uns vieles aus der Expressionistenlyrik heute ganz einfach „geschwollen“ vorkommt: so spricht niemand.
Uebrig bleiben die ruhigen, verhaltenen Künstler. Ihrer wird man nicht überdrüssig. Man stelle sich vor ein Porträt von Schiele: „Eduard Kosmak.“ Es stammt aus dem Jahre 1911. Das bleibt! Man hält den traurigen und wissenden Blick dieses Mannes aus; er schreit nicht, er gestikuliert nicht — er ist da. Es scheint, als habe Schiele gegen sich selbst gezeichnet, sich selbst überwindend, seine Verzweiflung niemand aufdrängend. ..Objektiv“, wie wir heute sagen würden. Darum bleibt sein Bild.
Oder Edvard Münch, der Norweger. Die Gestaltung siegt über das Verlangen nach Ausdruck. Er bleibt.
So stehen wir vor vielen Blättern und fragen sie und fragen uns. Mag sein, daß wir uns im einen oder anderen Fall irren, daß eine Generation nach uns sie wieder mit anderen Augen sieht; verwirft, wo wir ja sagen, ja sagt, wo wir verwerfen — dies mag sicher sein: das Ruhige, Unaufdringliche bleibt länger als aller Sturm und Drang.
Was bleibt also vom Expressionismus?
Man gehe in die Albertina und entscheide.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!