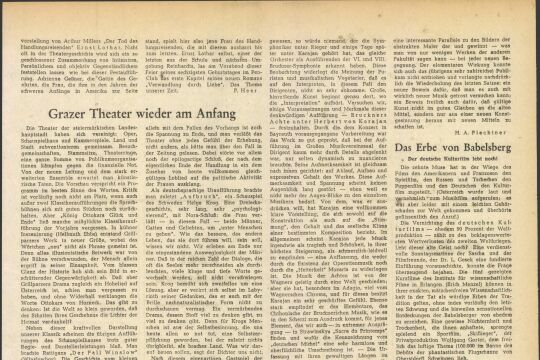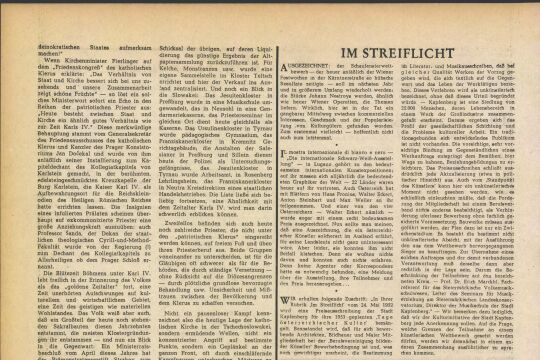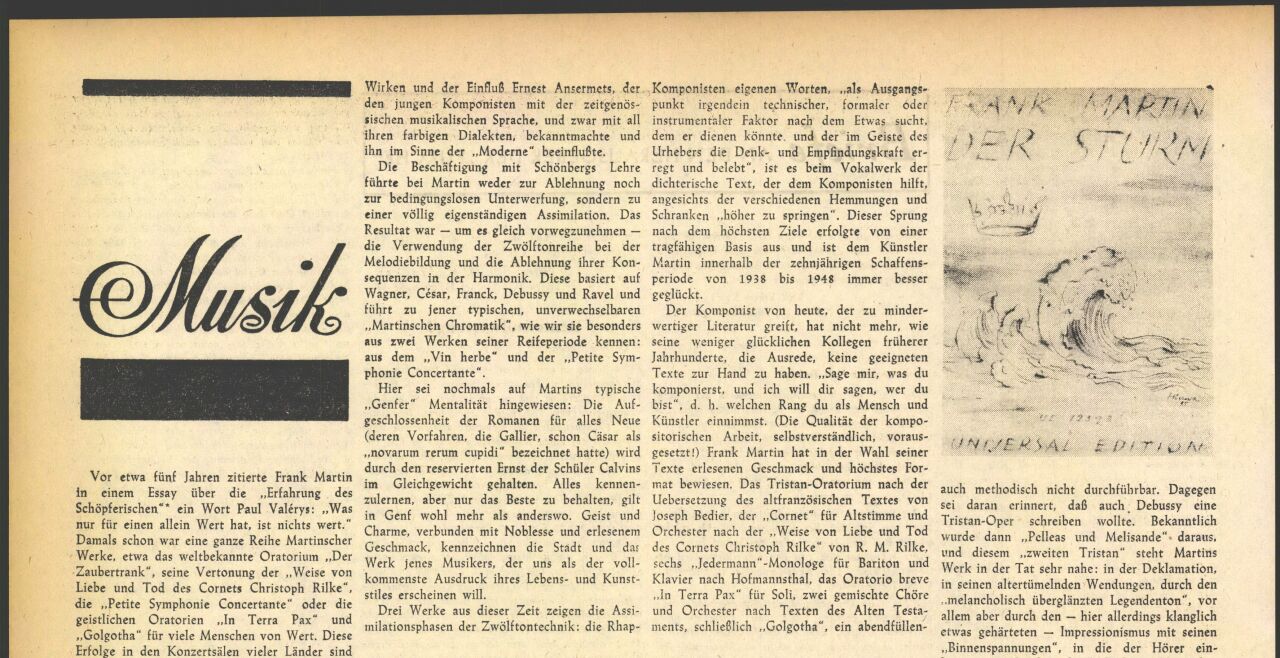
Vor etwa fünf Jahren zitierte Frank Martin in einem Essay über die „Erfahrung des Schöpferischen“* ein Wort Paul Valerys: „Was nur für einen allein Wert hat, ist nichts wert.“ Damals schon war eine ganze Reihe Martinscher Werke, etwa das weltbekannte Oratorium „Der Zaubertrank“, seine Vertonung der „Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“, die „Petite Symphonie Concertante“ oder die geistlichen Oratorien „In Terra Pax“ und „Golgotha“ für viele Menschen von Wert. Diese Erfolge in den Konzertsälen vieler Länder sind um so erfreulicher, da Martin — in einer Zeit, die von Lärm, Plakat und Schlagzeile beherrscht wird — ein Künstler der diskreten Aussage und der maßvollen Gebärde ist, dem alles Sensationelle fernliegt. Seine Einstellung ist der Ravels ahn ich, der einmal sagte, er habe es nicht nötig, seine Brust aufzureißen, um zu zeigen, daß er ein Herz besitze . ..
Obwohl Frank Martin die typische Frühbegabung des Musikers zeigte, kam er verhältnismäßig spät zur Reife, und diejenigen seiner Werke, die im gegenwärtigen Musikleben eine Rolle spielen und von denen wir annehmen können, daß sie die Zeit überdauern werden, sind sämtlich nach dem 40. Lebensjahr geschaffen worden. Die Annahme der Möglichkeit, daß einige von Martins Werken ein wesentlich längeres Leben haben würden als ihr Autor, gründet sich vor allem auf die Feststellung eines unüberhörbaren Eigentones dieser Musik. Ein Komponist, bei dem ein solcher wahrzunehmen ist, verdient — die allgemeine Qualität vorausgesetzt — unsere Aufmerksamkeit.
Daß Martin erst ziemlich spät zu einem Eigenstil gelangte, ist — wenigstens zum Teil — durch das Milieu und die Kunstatmosphäre der Stadt zu erklären, in der er aufwuchs. Der 1890 in Genf Geborene machte schon mit acht Jahren seine ersten kompositorischen Gehversuche und begann 1906 Theoriestudien bei dem konservativen Joseph Lauber. Von den — gleichfalls konservativen — Schweizer Komponisten Hans Huber und Friedrich Klose geschätzt, wurde Martin vor allem durch die Vereinigung Schweizer Tonkünstler gefördert, die alljährlich, etwa bis 1925. je ein Werk von ihm aufführte. — „Poemes Palens“, für Bariton und Orchester, war das erste größere Werk Martins, das (1911) öffentlich aufgeführt wurde.
Obwohl Genf dicht an der französischen Grenze und schon innerhalb des romanischen Kunstbereiches liegt, macht sich der Einfluß der französischen Musik in den Werken Martins erst nach einem zweijährigen Aufenthalt in Paris (1923 bis 1925) bemerkbar: in einem Trio über irische Volksmelodien und in dem dreisätzigen Orchesterwerk „Rhythmes“, das, mit mittelalterlichen Ganzen und Halben beginnend, über Polymeter des Fernen Ostens fortschreitend, mit ungeraden, unregelmäßigen, ständig wechselnden Rhythmen im Stile Strawinskys endet.
Etwa 1932 beginnt Martins intensive Beschäftigung mit der Schönbergschen Zwölftonlehre, und innerhalb der nächsten 1 Jahre (bis 1937) entstehen die folgenden fünf Werke, welche diesen Einfluß dokumentieren: „Guitarre“, ein Klavierkonzert, die Rhapsodie für fünf Streicher, ein Streichtrio und eine Symphonie. In dieser Zeit ist Martin als Pianist und Cembalist in einer Genfer Kammermusikvereinigung tätig, und er lernt u. a. die letzten Sonaten Debussys kennen, die gleichfalls Einfluß auf die Bildung seines Persönlichkeitsstils haben. Einige Jahre unterrichtete er auch am Institute Jaques-Dalcroze und an der Meisterklasse für Kammermusik am Genfer Konservatorium. Von besonderer Bedeutung wurde in dieser Zeil' auch das
* In „Die Furche“, 1951, 14. Folge.
Wirken und der Einfluß Ernest Ansermets, der den jungen Komponisten mit der zeitgenössischen musikalischen Sprache, und zwar mit all ihren farbigen Dialekten, bekanntmachte und ihn im Sinne der „Moderne“ beeinflußte.
Die Beschäftigung mit Schönbergs Lehre führte bei Martin weder zur Ablehnung noch zur bedingungslosen Unterwerfung, sondern zu einer völlig eigenständigen Assimilation. Das Resultat war — um es gleich vorwegzunehmen — die Verwendung der Zwölftonreihe bei der Melodiebildung und die Ablehnung ihrer Konsequenzen in der Harmonik. Diese basiert auf Wagner, Cesar, Franck, Debussy und Ravel und führt zu jener typischen, unverwechselbaren „Martinschen Chromatik“, wie wir sie besonders aus zwei Werken seiner Reifeperiode kennen: aus dem „Vin herbe“ und der „Petite Symphonie Concertante“.
Hier sei nochmals auf Martins typische „Genfer“ Mentalität hingewiesen: Die Aufgeschlossenheit der Romanen für alles Neue (deren Vorfahren, die Gallier, schon Cäsar als „novarum rerum cupidi“ bezeichnet hatte) wird durch den reservierten Ernst der Schüler Calvins im Gleichgewicht gehalten. Alles kennenzulernen, aber nur das Beste zu behalten, gilt in Genf wohl mehr als anderswo. Geist und Charme, verbunden mit Noblesse und erlesenem Geschmack, kennzeichnen die Stadt und dar Werk jenes Musikers, der uns als der vollkommenste Ausdruck ihres Lebens- und Kunststiles erscheinen will.
Drei Werke aus dieser Zeit zeigen die Assimilationsphasen der Zwölftontechnik: die Rhapsodie für zwei Geigen, zwei Bratschen und Kontrabaß (193 5), „Danse de la Peur“, für zwei Klaviere und kleines Orchester und ein Streichtrio (1936). An der Schwelle zur Reifeperiode, die etwa 193 8 beginnt, steht eine durch die „Apokalypse“ und Shakespeares „Sturm“ inspirierte Symphonie. Ihre Melodik ist durch die Zwölftonreihe bestimmt, im ganzen erscheint sie überkompliziert, vor allem polyphon überladen. Hier führte für Martin kein Weg ins Freie. Bereits das nächste Werk, das (auch szenisch aufführbare) Kammeroratorium für zwölf Singstimmen, sieben Streicher und Klavier, „Le vin herbe“ („Der Zaubertrank“), zeigt bereits einen neuen, vereinfachten und geläuter-teu Stil.
Nun kommt auch der „Ausdrucksmusiker“ Martin voll zur Entfaltung seiner Möglichkeiten. Während bei einem Instrumentalwerk, nach des Komponisten eigenen Worten, „als Ausgangspunkt irgendein technischer, formaler öder instrumentaler Faktor nach dem Etwas sucht, dem er dienen könnte, und der im Geiste des Urhebers die Denk- und Empfindungskraft erregt und belebt“, ist es beim Vokalwerk der dichterische Text, der dem Komponisten hilft, angesichts der verschiedenen Hemmungen und Schranken „höher zu springen“. Dieser Sprung nach dem höchsten Ziele erfolgte von einer tragfähigen Basis aus und ist dem Künstler Martin innerhalb der zehnjährigen Schaffensperiode von 1938 bis 1948 immer besser geglückt.
Der Komponist von heute, der zu minderwertiger Literatur greift, hat nicht mehr, wie seine weniger glücklichen Kollegen früherer Jahrhunderte, die Ausrede, keine geeigneten Texte zur Hand zu haben. „Sage mir, was du komponierst, und ich will dir sagen, wer du bist“, d. h. welchen Rang du als Mensch und Künstler einnimmst. (Die Qualität der kompositorischen Arbeit, selbstverständlich, vorausgesetzt!) Frank Martin hat in der Wahl seiner Texte erlesenen Geschmack und höchstes Format bewiesen. Das Tristan-Oratorium nach der Uebersetzung des altfranzösischen Textes von Joseph Bedier, der „Cornet“ für Altstimme und Orchester nach der „Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ von R. M. Rilke, sechs ,,Jedermann“-Monologe für Bariton und Klavier nach Hofmannsthal, das Oratorio breve ,,In Terra Pax“ für Soli, zwei gemischte Chöre und Orchester nach Texten des Alten Testaments, schließlich „Golgotha“, ein abendfüllendes Oratorium für vier Solostimmen, gemischten Chor, Orchester und Orgel nach den Evangelien und den Betrachtungen des hl. Augustin bilden die aufsteigende Reihe. Den Sprung auf die Opernbühne versucht Frank Martin mit einer Oper nach Shakespeares „Sturm“, die unter der musikalischen Leitung von Ernest Ansermet während der Wiener Festwochen im Juni dieses Jahres in der Staatsoper stattfindet.
Da im Rahmen dieser Studie eine Analyse aller Kompositionen nicht möglich ist, wollen wir lediglich versuchen, an Hand des ersten und des vorletzten Werkes der obigen Reihe einige Besonderheiten und Qualitäten von Martins musikalischer Sprache zu kennzeichnen. Ein Vergleich von Bedier-Martins „Zaubertrank“ mit Wagners „Tristan“ im Hinblick auf das gleiche ■ Sujet wäre zu billig, ist übrigens auch methodisch nicht durchführbar. Dagegen sei daran erinnert, daß auch Debussy eine Tristan-Oper schreiben wollte. Bekanntlich wurde dann „Pclleas und Melisande“- daraus, und diesem „zweiten Tristan“ steht Martins Werk in der Tat sehr nahe: in der Deklamation, in seinen altertümelnden Wendungen, durch den melancholisch überglänzten Legendenton“, vor allem aber durch den — hier allerdings klanglich etwas gehärteten — Impressionismus mit seinen „Binnenspannungen“, in die der Hörer einbezogen wird, ohnt durch Pathos oder orchestrale Effekte attackiert zu werden. Bewunderns- ' wert und höchst eindrucksvoll ist die Einheitlichkeit des Stils, der, ohne durch Monotonie zu ermüden, konsequent durchgehalten wird. Die Harmonik kann bereits als typisch Martinscher „Chromatismus“ bezeichnet werden. *
Größer im Format und kühner im Wurf, dagegen weniger einheitlich im Stil ist das vorläufig letzte Chorwerk Martins, das Oratorium „Golgotha“. Die Verwendung verschiedenartiger Stilelemente, wie Gregorianik, Ariosi mit obligaten Instrumenten, Palestrinensischer Homophonie und Zwölftonmelodik neben Rhythmen und Melodien des Volksliedes ist vor allem dadurch zu erklären, daß der Autor sich vorbehaltlos an den Gehalt des Textes hingegeben hat. Auch eine gewisse Reserviertlleit des Ausdrucks, wie wir sie aus früheren Werken kennen, wurde aufgegeben. Wie diese auf den ersten Blick disparaten Elemente dennoch zur Einheit gebunden sind, bleibt Geheimnis der schöpferischen Persönlichkeit. Die Anlage des großen Werkes ähnelt in vielem der der Bach-schen Passionen mit ihrer Abfolge von Arien, Rezitativen und Chören. (Nach einer biographischen Notiz empfing der Komponist als Kind von zwölf Jahren den ersten starken musikalischen Eindruck durch eine Aufführung der „Matthäus-Passion“ von Bach.) Durch die Betrachtung von Rembrandts „Drei K/euzen“ auf einer Ausstellung in Genf angeregt, war Martins ursprüngliche Idee, „dieses schreckliche und großartige Drama in einem kurzen Werk zu konzentrieren, wie es Rembrandt auf seinem bescheidenen, kleinen rechteckigen Stück Papier getan hat“. Doch kommt der Komponist bald zu der Einsicht, daß nur ein breit angelegtes Fieskogemälde dem Stoff angemessen sei, 'ie Form des Oratoriums, und zwar nicht nur auf den Text der Evangelien, sondern auch mit lyrischem Kommentar, als eine Art Meditation über die verschiedenen Episoden des Erlösungsdramas. Der Kühnheit des Unterfangen?, die Passion nach Bach musikalisch neu zu gestalten, ist sich der Komponist bewußt gewesen, doch meint er, „daß jede Epoche wohl das Recht hat, zu versuchen, die großen Themen zu behandeln, von denen unser Geist gespeist wird, und daß eine neue Vision der Leiden und des Sieges Christi über den Tod ihr eine verstärkte Gegenwart verleihen kann“.
Neben den großen Vokalwerken dürfen die Instrumentalkompositionen der Reifezeit nicht vergessen werden, vor allem jene Reihe von Konzerten, denen der Komponist (wohl um ihre freiere, rhapsodische Form zu rechtfertigen) den Titel „Balladen“ gegeben hat, das von W. Schneiderhan in Wien erstaufgeführte Violinkonzert, schließlich die „Petite Symphonie Concertante“ mit Harfe, Cembalo, Klavier und zwei Streichorchestern, deren Welterfolg schon erwähnt wurde. Dieses zweiteilige, durch seinen rhythmischen Elan bezaubernde und durch die Ausdrucksgewalt der langsamen Teile ergreifende Werk erweist, daß sich ein Musiker unserer Tage weder vor dem Rhythmus der Zeit abzusperren noch sich seiner „romantischen“ Empfindungen zu schämen braucht. Freilich zeigt es auch - und der Erfolg bei Fachleuten und beim breiten Publikum gibt ihm recht! -,' daß neue Musik nicht mehr im guten Glauben an die alten Mittel, sondern nur aus einem neuen Glauben mit neuen Mitteln zu machen ist.