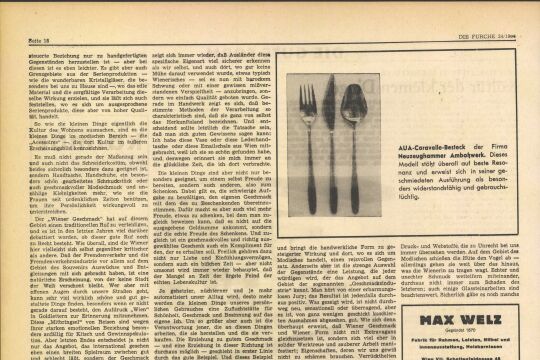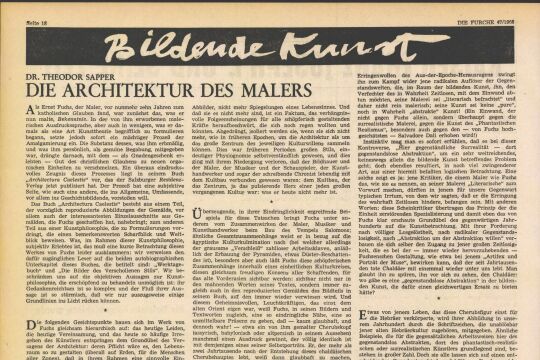Die Jahre nach dem ersten Weltkrieg bedeuteten für unsere Kunst eine Zeit vollkommener Umstürzung, die sich vor allem in der bewußten Aufgabe der Form äußerte, die Jahrhunderte hindurch als Grundbedingung und Spezifikum jeglicher Kunstübung gegolten hatte, nun aber durch eine Revolution, wie sie in diesem Ausmaße in der Geschichte der Kunst nie zuvor bekannt war, als lästige Fessel gesprengt und vernichtet wurde. Gleichzeitig kommt es zu einem Eindringen von Gedanken aus der Sphäre des Politischen, also zu dem Versuch, das Darzustellende in eine parteidogmatisch gebundene Anschauung zu versetzen, es als einen weltanschaulich-politischen Propagandafaktor zu gebrauchen. Es mutet wie ein Treppenwitz der Kulturgeschichte an, daß der Nationalsozialismus, der ansonst die Stiltendenzen jener Zeit prinzipiell ablehnte, genau wie jene den Versuch unternahm, die Kunst zu politisieren — freilich mit demselben negativen Erfolg.
Es ist noch zu früh, um eine umfassende Deutung der Stiltendenzen unserer Nachkriegszeit geben zu können, aber es läßt sich immerhin feststellen, daß in all den zahlreichen Dichterlesungen und Neuaufführungen, die in Wien geboten werden, ein gemeinsamer Grundton vorherrschend ist: das bewußte Ringen um Form, das bewußte Streben nach formaler Geschlossenheit, das bisweilen fast klassizistisch anmutet. Erscheinungen, die in absolutem Widerspruch zu solchen der zwanziger Jahre stehen. Dort, wo sich vereinzelt Ähnlichkeiten zeigen, werden sie instinktiv als intellektuelle Versuche empfunden, Überholtes zu konservieren.
Es ist selbstverständlich, daß all das, was man mit Expressionismus, Surrealismus und anderen Schlagworten bezeidmet, nicht spurlos vorübergegangen ist. Dazu war ihr Auftauchen zu eruptiv und ihre Auswirkungen zu nachhaltig. Am besten läßt sich das an Filmen feststellen, wie sie jetzt etwa aus Amerika oder England zu uns kommen. Hier werden mit selbstverständlich anmutender Unbefangenheit Gespenster und Tote, Geister und Unsichtbare in die Handlung einbezogen, wie es ohne Surrealismus einfach nicht denkbar wäre: nur hat sich das allzu Krasse, zu sehr Überspitzte mit der Zeit - abgesdiliffen und wurde mit überkommenem Formgut zu einer Einheit verschmolzen.
Zwölf Jahre lang hat der Nationalsozialismus mit ungeheurem Material-, Kosten- und Menschenaufwand versudat, eine monumentale Kunst aus dem Boden zu stampfen. Der Erfolg war völlig negativ: was an Partei- oder Staatsbauten entstand, war bestenfalls aufdringliche, unangenehm klassizifierende Kulisse, die einen nicht vorhandenen Inhalt vortäusdien sollte. Ähnlidi verhielt es sich mit Malerei und Plastik. Auch sie sollten, wenn irgend möglich, heroisch, monumental, kämpferisch sein. Das Ergebnis war bloßer Kitsch, wie jeder Besucher der Deutschen Kunstausstellung in Mündien, die so eifrig angepriesen wurde, feststellen konnte.
Die alte Erkenntnis, daß Kunst niemals in willkürlich bestimmte Bahnen gelenkt werden kann und daß ein Stilwollen, von dem so viel die Rede war, nicht imstande ist auch schon einen Stil hervorzubringen, hat wieder einmal einen glänzenden Beweis erhalten.
Indessen ist die Ideologie, deren sich die nationalsozialistische Kunstpolitik bedient hat, keineswegs ausgestorben. Immer wieder hört oder liest man die Forderung, daß unsere Zeit der ungeheuerlichen Unterdrückung, des großen Krieges und der endlichen Befreiung auch große, das heißt „monumentale“ Kunstwerke hervorbringen sollte. Anschließend wird gewöhnlich dem Bedauern Ausdruck verliehen, daß in den Kunstausstellungen unserer Tage „nur“ so unbedeutende Dinge wie Stilleben, Landschaften, Porträts und Blumenstücke zu finden seien.
Daß diese Auffassungen eine Herabwürdigung der Kunst zu bloßer aktueller Illustration sind, sie in nächste Nähe zu Wochenschau und Zeitungsreportage stellen, liegt auf der Hand. Abgesehen davon vergißt man immer wieder, daß die Bedeutsamkeit und das Wesen eines Kunstwerkes nicht in seinem thematischen Votwurf, schon gar nicht in seiner äußeren Größe liegt, sondern für seine Beurteilung tieferliegende geistige Beziehungen maßgebend sind.
Es scheint aber nur so zu sein, daß unsere Kunst heute, zum Teil vielleicht durch jahrelangen Zwang beeinflußt, tatsächlich von der letzten Endes formlosen „Größe“ äußeren Geschehens abrückt, um bewußt in engeren Grenzen Form, Inhalt und Gesetzmäßigkeit zu gewinnen. Daher das so gänzliche Fehlen jeglicher Ansätze zur „Monumentalität“, daher wahrscheinlich auch das Zurückgreifen auf einen intimeren, sozusagen menschlicheren Themenkreis, der den Beschauer nicht erschüttern, sondern ihm Freude und Genuß bereiten soll. Daher ;— und nicht bloß aus äußerem Mangel — Aquarell, Zeichnung und ähnliche Techniken, die den Bedürfnissen weiterer Kreise angemessen sind.
Warum dieses Sichselbstbescheiden gleichbedeutend mit Verfall sein soll, ist nicht' redat einzusehen. Dem verständigen Liebhaber Freude und Genuß zu bereiten, ist eine, freilich nicht die einzige Aufgabe der Kunst seit jeher gewesen. Seien wir dankbar für das, was sie uns zu bieten hat. Auch dort, wo sich die Kunst nur an unser Schön-heits- und Freudebedürfnis wendet, gibt sie sich noch lange nicht preis.
Auch die Mode ist nicht lediglich ein Ergebnis äußerlicher Zufälligkeiten, sondern, genau wie auf anderer Ebene Kunst oder Wohnkultur, ein Ausdruck des Zeitstils. Selbst sogenannte Modetorheiten sind nidits anderes als karikierende, damit zugleich ausdrucksvolle Spiegelbilder eben des Stilwillens, dessen Ausfluß sie sind. Wie auf allen Gebieten bewirkte der erste Weltkrieg auch in der Mode das Einschlagen einer vollkommen neuen Richtung. Im Zusammenhang mit der ebenfalls durch ihn beschleunigten, völligen Emanzipation der Frau und der raschen Entwicklung der Technik zeigen sich in der weiblichen Mode Erscheinungen durchaus männlichen Gepräges. Zum erstenmal seit einem Jahrtausend trägt die Frau kurzes Haar, manche leistet es sich sogar, ausgesprochen männliche Kleidungsstücke zu tragen.
Mit der Mode ist die Vorstellung des weiblichen Schönheitsideals untrennbar verbunden. Der „Modetyp“ der zwanziger Jahre ist das knabenhafte junge Mädchen mit langen Beinen, schmalen Hüften und eckigen Schultern. Um bezeichnende Beispiele dafür vor Augen zu haben, braucht man nur an die beliebten Hosenrollen m den Filmen
jener Tage zurückzudenken. Es ist nicht erstaunlich, daß dieser radikale Umschwung nicht von langer Dauer sein konnte. Tatsächlich tritt bald eine Änderung ein und das ephebenhafte Mädchen verschwindet. In gewisser Beziehung ist dieses Auftauchen und Verschwinden gewisser Modeformen des Menschen selbst ein einzigartiges und noch nicht genügend beachtetes Phänomen. Die Vorstellung, daß sich die äußere Erscheinung der Menschheit von Zeit zu Zeit ändert, um Modebedürfnissen zu genügen, ist geradezu ungeheuerlich. Aber sie ist Tatsache und beweist, daß die Mode tiefer in unser Leben eingreift, als es den Anschein haben könnte. Wenn das Modejournal beispielsweise wieder abfallende Schultern propagieren würde
— ein sehr großer Prozentsatz von Frauen und Mädchen würde plötzlich abfallende Schultern haben.
Seit Beginn der dreißiger Jahre also wird ein neuer Modetyp „aktpell“: das junge Mädchen. Die Formen werden weiblicher, die Röcke bauschiger, die Haare wieder länger.
Auch dieses Vorbild weiblicher Schönheit wurde — man könnte fast sagen —: reifer. Mehr und mehr gilt wieder jener Typ, der solange Kanon der Eleganz und Schönheit gewesen war, als maßgebend, nämlich der der etwa fünfundzwanzigjährigen Frau. Der Krieg hat diese Entwicklung nicht zu hindern vermocht, im Gegenteil eher beschleunigt. Betrachtet man nun die Modehefte, die aus dem Ausland zu uns kommen, so kann man die immerhin recht erstaunlidae Beobachtung machen, daß in der Mode unserer Tage Elemente des Biedermeiers oder der neunziger Jahre auftaudien. Lange, schönschwingende Röcke, große Puffärmel, Näd;enfrisuren, dreieckförmige Halsausschnitte.
Man mag die Mode als äußerlich und unwichtig abtun. Man darf aber nicht vergessen, daß sie unter allen Kulturfaktoren den Weg des geringsten Widerstands geht, sie läßt sich nicht auf theoretische Auseinandersetzungen ein, irrt nicht ab, sondern folgt einfach und ohne Umwege dem allgemeinen Geschmack und ist deshalb ein ungetrübter Spiegel der Zeit. Wenn daher die Mode heute — ganz im Gegensatz zu der Nachkriegszeit um 1920 — so unbeirrt einen Weg einschlägt, der sie notwendigerweise zu Formen zurückführt, die jahrhundertelang mit dem Begriff von menschlicher oder weiblicher Schönheit untrennbar verbunden waren und nach dem Weltkrieg als veraltet abgetan wurden, so ist es Grund genug, um die gesamte Entwicklungslinie unserer Kultur daraufhin nachzuprüfen.
Der Stil der heutigen — durch die Ereignisse leider vielfach theoretisch gebliebenen
— Wohnkultur zeigt eine interessante Parallele zu einer spezifisch österreichischen Kulturperiode: dem Biedermeier.
Das Biedermeier bedeutet in der Geschichte menschlichen Wohnens einen entscheidenden Wendepunkt, denn in ihm tritt der Mensch in ein neues Verhältnis zum Wohnraum. Der F.inrichtungsgegenstand hat nun dienendes Gerät zu sein, das dem Besitzer untergeordnet, rtmv entsprecheTiclen Gebrauch
zweckdienlich geformt ist. Eine Forderung, die uns heute selbstverständlich erscheint, durchaus aber nicht immer selbstverständlich war. Man denke beispielsweise ans Barock: hier hat das Möbel vor allem gewisse ästhetische Bedürfnisse zu erfüllen, die es zum praktischen Gebrauch nicht immer geeignet erscheinen lassen. Daraus läßt sich auch das — an und für sidi paradoxe — Vorhandensein von • Prunkmöbeln und Prunkräumen erklären, die lediglidi den Schönheitssinn befriedigen, zu praktischer Benützung aber untauglich sind.
Das Biedermeier nun erhebt die Gebrauchsfähigkeit eines Möbels zum Postulat, es ver-ziditet auf die bis dahin unerläßlidie ornamentale Behandlung, baut nach einfachen, fast klassisdien Maß- und tektoni-sdien Verhältnissen, legt dafür viel Gewicht auf die dem verwendeten Werkstoff innewohnende Schönheit. Alles das sind genau die Forderungen, die wir heute an unseren Hausrat stellen.
Allerdings haben diese im Biedermeier gültig geprägten Anschauungen mancherlei Verwandlungen durchgemacht. So bedeutete zum Beispiel die Makart-Zeit einen Rückfall ins Barock, dafür hinterließ es die Vorliebe für Polstermöbel, die uns heute unentbehrlich sind.
Mit dem Jugendstil beginnen jene „sachlichen“ und „modernen“ Stile, als deren Symbole StaMrohrmöbel und der greuliche Begriff „Wohnmaschine“ gelten können. Selbst der Expressionismus versudite auf die Wohnkultur Einfluß au nehmen. Aber alles das blieb mehr oder weniger Experiment, freilich nicht, ohne neue Gedanken zu bringen, die von dem im Biedermeier geschaffenen Wohntypus, der weiterhin, vor allem in Wien, immer latent blieb, aufgenommen und verarbeitet wurden.
Die modernen Stile räumten vor allem mit dem „hprror vacui“ auf, der sich jahrhundertelang scheute, eine Fläche oder einen Raum leer zu lassen, die jetzt geradezu als ästhetisdie Ausdrucksfaktoren gewertet werden können. Zum Teil geht dies auf Einflüsse zurück, die hauptsächlidi aus Japan um die Jahrhundertwende auf Europa starke Wirkungen ausübten. Damit hängt auch zusammen, daß die Möbel, besonders die Sitzgelegenheiten, niedriger und bequemer werden, so daß man fast die paradoxe Behauptung aufstellen könnte, wir hätten erst vor vierzig Jahren richtig sitzen gelernt. Wichtig ist, daß die Möbel nun aus der Mitte des Raumes genommen und vor die Wand gestellt werden, im Gegensatz zu der bis dahin üblichen zentripedalen Anordnung, die die Raummitte, sei es durch den Tisdi, eine Sitzgruppe oder selbst ein Bett, stark betont hatte.
Die Wohnform, die wir heute haben — oder haben möchten —, ist nichts anderes als ein Biedermeier, das Neues in sida aufgenommen hat und den Bedürfnissen der Hygiene und der Technik gerecht wird. Die harten und kubisch betonten Formen der letzten Jahrzehnte mildern sich, harmonische Verhältnisse und Liniengefüge kommen zu ihrem Recht. Die Wohnung ist nicht mehr „Wohnmaschine“, sondern ein Ort der Behaglichkeit und Ruhe.