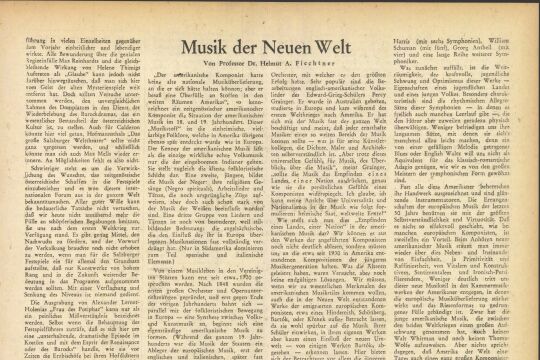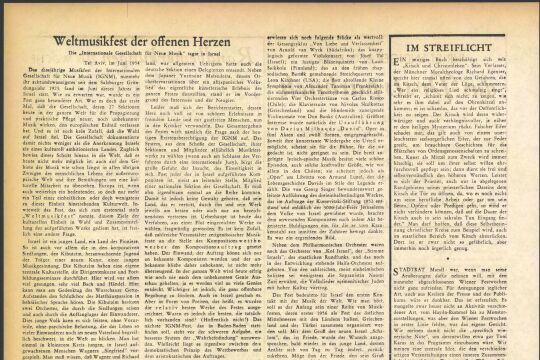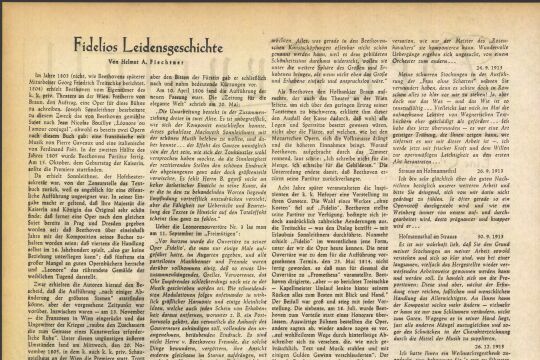Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die McKlassik rettet Schönberg
So etwas hatte Johann Strauß noch nicht erlebt: ^0.000 begeisterte Menschen waren gekommen, um ihn dirigieren zu sehen. Eine Kanonensalve war das Startzeichen für die 20.000 Sänger und 1.000 Orchestermusiker, die Strauß durch die Partitur geleiten sollte. Auf seinem meterhohen Dirigentenpult wurde ihm klar, daß „an Vortrag oder Kunstleistung nicht zu denken” sei. Trotz Unterstützung durch 100 untergeordnete Dirigenten hoffte Strauß nur noch, daß alle Mitglieder des monströsen Klangkörpers einigermaßen im Gleichklang musizieren würden. Für einen Rückzieher war es zu spät: „Eine Absage hätte ich nur mit meinem Leben bezahlt”, erinnerte sich der Komponist an jenes Massenspektakel, das 1872 in Boston über die Bühne ging.
Heutzutage übt die klassische Musik wieder eine ähnlich hohe Anziehungskraft aus: Im Juni 1993 besuchten sogar mehr als eine halbe Million Fans das Konzert von Luciano Pavarotti im New Yorker Central Park. In Wien werden immerhin 55.000 Menschen erwartet, wenn Pavarotti sowie seine Kollegen Placido Domingo und Jose Carreras am 13. Juli im Ernst-Happel-Stadion vor das nach dem heißersehnten hohen C hungernde Publikum treten. Doch ähnlich wie bei Johann Strauß vor über 120 Jahren stellen sich Zweifel betreffend die Qualität solcher Darbietungen ein -allerdings nicht bei den Künstlern selbst, sondern bei Teilen des Publikums.
Bietet ein Ort, wo normalerweise 22 schwitzende Männer einem Ball nachjagen, wirklich die geeignete Akustik und das richtige Ambiente, um Arien zu schmettern? Sind Authentizität und Unmittelbarkeit des Erlebens noch gegeben, wenn man die Sänger über riesige Videoleinwände bewundern muß, da sie für das bloße Auge viel zu weit entfernt sind? Paßt das Verspeisen gebratener Nudeln, das Trinken von Bier aus Pappbechern und das Telefonieren per Handy - so passiert zu Beginn der Tournee im Kasumigaoka National Stadion in Japan - zu der Art und Weise, wie klassische Musik für gewöhnlich rezipiert wird? Muß ausgerechnet der amerikanische Fast-Food-Konzern McDonalds, vielen Europäern Inbegriff für Kulturlosig-keit, für die Verköstigung der Ehrengäste beim Auftritt der drei Tenö-re im Ernst-Happel-Stadion sorgen?
Nach eigenem Bekunden haben Domigo, Carerras und Pavarotti großen Spaß an ihren gemeinsamen Auftritten. Auch wird ihnen die Gage ihre Auftritte versüßen: Summen zwischen 5 und 14 Millionen Schilling pro Kopf und Auftritt werden kolportiert. Für wen jedoch klassische Musik etwas Ehrfuchtgebietendes darstellt, zu dem man andächtig und würdig zu lauschen hat, für den steht der Untergang des Abendlandes bevor. „Kommerzialisierung”, „Trivialisierung” und „McDonaldisierung” lauten die Diagnosen, die der klassischen Musik gestellt werden: McKlassik als Music-Food für den kleinen Kunstgenuß zwischendurch.
Wehmütig denkt man an die alten Langspielplatten zurück, auf deren papierenen Hüllen kleine musikwissenschaftliche Abhandlungen Geschichte und Struktur eines Werkes erläuterten. Heute nennen sich CDs
„The Best of Verdi” und der Beipacktext der wohldosierten Zusammenstellung erklärt höchstens, daß Guiseppe Verdi zu seiner Zeit ein „großer Star” war. Sender wie etwa das Klassik Badio Hamburg, hierzulande über Kabel zu empfangen, dudeln von früh bis spät Arien, kurze gefällige Stücke sowie einzelne Sätze von Symphonien und Konzerten. Wie bei einem kommerziellen Popradio, bei dem dreimal täglich die aktuelle Hitparade abgespult wird, darf nichts länger als ein paar Minuten dauern oder dem Hörer irgendeine andere Anstrengung abverlangen. Meisterwerke werden zu beiläufiger Hintergrundmusik.
Auch (vordergründige) Erotik hält Einzug in das Genre. Venusgleich erhob sich auf Plakaten die junge britische Geigerin Vanes-_ sa-Mae Nicholson aus einer sanften Brandung, der zarte Körper nur von einem nassen Hemdchen bedeckt. Johann Sebastian Bach oder die Beatles: Alles, was die 17jährige „Fi-del-Lolita” (das deutsche Magazin „Stern”) interpretiert, ist in Arrangements gebettet, die sich gefährlich dem Niveau der heimischen volkstümlichen Musik nähern. Doch damit brachte sie es immerhin zu einem Gastspiel an der Wiener Staatsoper - wenngleich die Kritik das Konzert erbarmungslos zerfetzte. „Crossover” wird jene vergängliche Vermischung von Klassik und zeitgenössischer populärer Musik genannt.
Doch Kommerz und das Bedienen des populären, zeitgenössischen Geschmacks ist für die klassische Musik nichts Neues. Wie das Konzert von Johann Strauß in Boston vor Augen führt, gab es schon vor langer Zeit
Massenveranstaltungen. Auch Bier und Würstchen als Kost zur Kunst stellen nicht wirklich eine Neuerung dar: Wenn der Walzerkönig im Wiener Prater aufspielte, wurde nicht andächtig gelauscht, sondern getanzt, gescherzt, gegessen und getrunken.
„Mit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ging die Leibeigenschaft der Musiker zu Ende”, erklärt Irmgard Bontinck, Leiterin des Instituts für Musiksoziologie an der Wiener Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Bis zu diesem Zeitpunkt waren auch große Musiker als Hofkomponisten oder -kapellmeister in einem oft lebenslangen Abhängigkeitsverhältnis zu Herrscherhäusern gestanden. Im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen jener Zeit entstand plötzlich ein florierendes öffentliches Konzertwesen. Nicht nur der Adel, sondern auch das gewöhnliche Volk war nun Publikum. Die Bedingungen des freien Marktes führten naturgemäß zu einer Anpassung an den Geschmack der Zeit und zu einer intensiven Selbstvermärktung der Künstler. Virtuosen wie Franz Liszt oder Frederic Chopin, exzellente Selbstdarsteller und von ihren Anhängern fanatisch verehrt, schreckten vor gefälliger Musik keineswegs zurück; solche durchaus heute noch bekannten Musiker waren die Guldas und Pavarottis von damals.
Parallel dazu - möglicherweise als Reaktion der Eliten auf die Popularisierung der Musik - entstand auch „der Konzertsaal als Kirchenersatz” (Bontinck). Im Zuge der Aufklärung und des deutschen Idealismus' mit ihrem Drang nach Höherem wurde aus bloßer Musik die „ernste Musik”, der bürgerliche Schöngeister ehrfurchtsvoll lauschten. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war derartiges in der weltlichen Musik unbekannt gewesen. Der Bokoko-Komponist Carl Ditters von Dittersdorf etwa, der am preußischen Hof tätig war, weigerte sich eines Tages, weiterhin vor dem König zu musizieren, da jener beim Skatspiel in lautes Geschrei auszubrechen pflegte. Wohlgemerkt: Das Kartenspiel selbst stellte Dittersdorf nicht in Frage. :
Als mit dem Beginn unseres Jahrhunderts die Kluft zwischen populärer Musik und der „holden Kunst” immer größer wurde, wurden Andacht und Ehrfurcht wesentliche Merkmale der Bezeption von klassischer Musik. Wer in dieser Tradition steht, dem ist der momentane Klassik-Boom mit Tenören in Fußballstadien vor Publikum mit Pappbechern in der Hand verständlicherweise ein Greuel. Hinzu kommt ein mit der Popularisierung verbundener Qualitätsverlust, der objektivierbar ist: Bei ihrem Konzert in Wien griff Vanessa-Mae Nicholson gleich mehrmals daneben und eine Lautsprecheranlage nimmt selbst der Stimme eines Placido Domingo etwas von ihrer Fülle.
Die Musikindustrie beteuert immer wieder, daß es die die kommerziellen Produktionen sind, durch die viele Ladenhüter überhaupt finanziert werden können. Anscheinend bedarf es gefälliger Aufnahmen, die sich millionenfach verkaufen, damit auch Schönberg angeboten werden kann, den kaum jemand hören will. Also wird man wird wohl mit der Kommerzialisierung leben müssen, mag sie auch noch so seltsame Blüten treiben. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Stars im Klassik-Geschäft bald - gleich Autorennfahrern - mit Werbung übersät auf der Bühne stehen: Pavarotti mit einem Big Mac am Revers und Carreras mit dem Schriftzug „Gillette - für das beste im Mann” (sollte er sich endlich von seinem Drei-Tages-Bart trennen).
Musiksoziologin Bontinck jedenfalls freut sich, daß die klassische Musik überhaupt noch lebendig ist. Ihr Untergang - sei es durch Dahinscheiden in Würde, sei es durch Verramschung im schnöden Kommerz - steht so schnell nicht bevor: „Solange unser tonales System mit seinen Harmonien noch besteht, wird auch die klassische Musik noch gehört werden.”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!