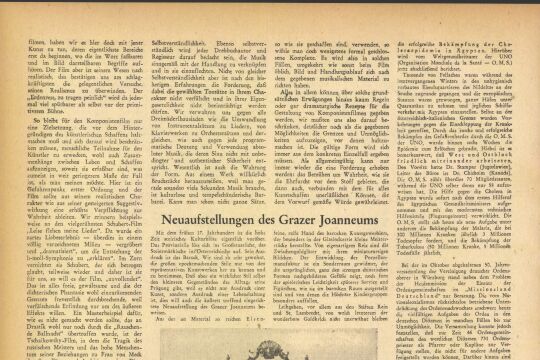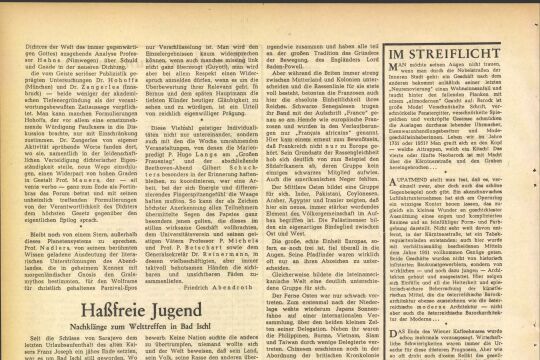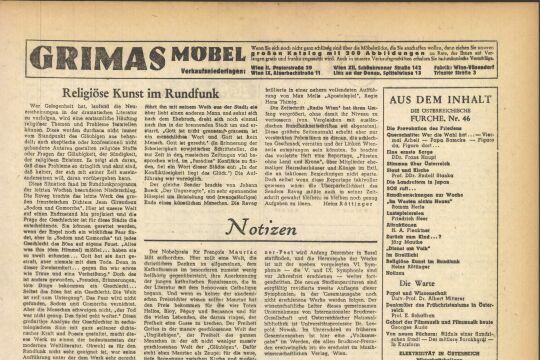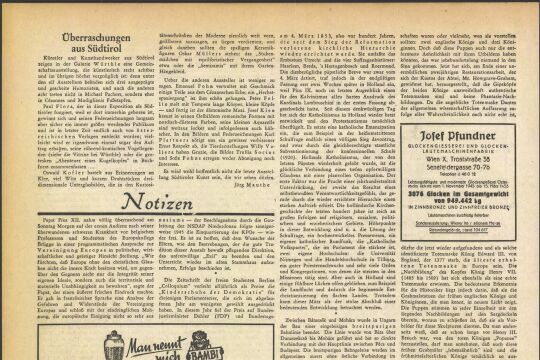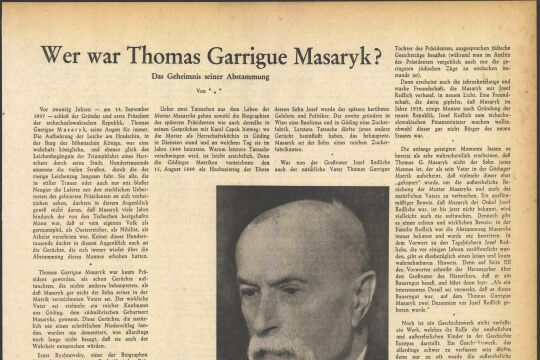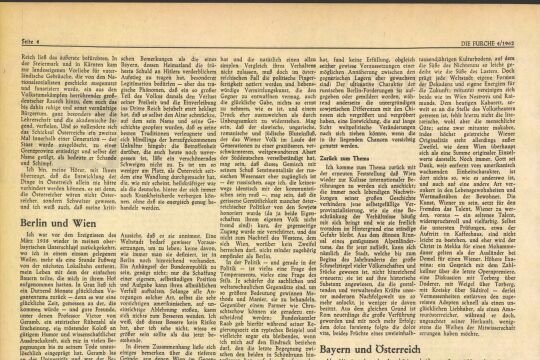Ukrainische Kunst in Wien: Die Ukraine und der Westen
Ukrainische Volkskunst als Teil Europas.
Ukrainische Volkskunst als Teil Europas.
Europa ist ein geistiger Kulturbegriff, der sich im Laufe der Zeit abwechselnd dehnte und wieder zusammenschrumpfte. Was gehört heute zum integralen Europa? Kann politischer Machtwille die Grenzen dieser geistigen Einheit willkürlich und auf immer verstellen oder ist es Gesinnung und Artung der Völker, die mit darüber entscheiden, ob sie zu Europa gehören?
Darf man auch stumme Zeugen zu den Europagesprächen laden? Wir Ukrainer haben kein offizielles Sprachrohr, da wir heute noch nicht unter den Völkern figurieren, die es zu einer staatlichen nationalen Organisation gebracht haben. So können wir nur durch Kulturleistungen — vor allem durch unsere Volkskunst.— versuchen, uns einzureihen in das Europäische oder in das Außereuropäische. Nach Haberlands „Völker Europasiirid ihre Kulturen“ sind die Ruthenen (Ukrainer) das kunstbegabteste Volk unter den Slawen. Wir wollen diese unsere stumm-beredte Volkskunst befragen.
Ukrainische Volksausstellung in der Wiener Secession
Im Gebäude der Wiener Sezession haben wir unter dem Ehrenschutz des Bundesministers für Unterricht Dr. H. Drimmel eine ukrainische Volkskunstausstellung eröffnet. Gleich in der ersten Vitrine ist dort eine Urne ausgestellt mit Bandornamentik, die ihre sehr gewichtige Stimme erhebt aus jener Urvorzeit, wo die nomadischen Jägervölker zum erstenmal erkannten, daß ein in die Erde gepflanztes Samenkorn zwanzigfache Früchte trägt und so eine neue Lebenshaltung begannen. Aus jener neolithischen Zeit, die damals auch das, was viel später Wiener Landschaft wurde, in einer donauländischen Kultur verband mit dem Tripolje-Land, welches später von Ukrainern bezogen worden ist, stammt diese Urne, die in Schipenitz im Norden der Bukowina ausgegraben worden ist. Sie ist eine Leihgabe der prähistorischen Abteilung des Hofmuseums, und wir sind glücklich, daß Wien einst die Patronanz über unser westukrainisches Gebiet übernommen hatte, sonst wären wir nicht in der Lage gewesen, diesen stummen Kronzeugen zu laden.
Neben dieser in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellten 4000 Jahre alten großen Urne steht ein ebenso altes Schipenitzer Tonscherbenstück, auf dem man noch deutlicher die Bandornamentik erkennt. Labyrinthisch schwingende Bänder mit Schraffen, genau solche, wie wir sie auf den Ostereiern daneben wiederfinden, welche einem volkstümlichen kultischen Brauchtum zuliebe und nicht aus ästhetischen Geschmacksentscheidungen heraus, gestern noch, also in einer 4000 Jahre alten Kontinuität, gebatikt wurden.
Es scheint uns wichtig, auf dieses Magisch-Kultische, das hinter den Ostereierornamenten steckt, hinzuweisen. Daß sie der Frühlingssonnenwende zugehören, ist ja schon durch ihre Benennung „Ostereier“ gekennzeichnet. Ein solches Ei mit Bandornamentik hieß bei den Ukrainern „Endlos“, bei den Rumänen „Irrweg“, es sollte ja das Symbol für einen endlosen Irrweg darstellen und damit auch die dämonischen Verführungen zu solchen Irrungen bannen. Erst wenn dieses Teufelsei mit Bandornamenten, das man niemals mit jien anderen Ostereiern zusammen zur Weihe in die Kirche trug, fertig war, bekreuzigte sich die Bäuerin und machte die übrigen Ostereier fertig, die vielfach geordnete Drehmotive, Drehkreuze, Drehblumen aufweisen, alle in derselben Richtung, wie die Sonne sich am Himmel dreht, aber auch geometrische Ornamente, die ihren Symbolcharakter längst verloren haben, kommen vor.
Wir sehen, wie durch diese Spiralenmuster schon damals vor 4000 Jahren die Donauländische Landschaft um Wien mit unserer Tripoljer Kultur verbunden war. — Ein anderes Beispiel: Teppiche, die heute kaum von einem anderen Gesichtspunkt aus angesehen werden denn als schöne, vielleicht noch dazu wärmende Zierstücke, bekamen auch nicht von ungefähr ihre Musterung. Ein Teppich mit einem Doppelsternmotiv war bei uns für das Brautpaar gelegt. Braut, Bräutigam standen im Heil dieser beiden Sterne, der Teppich hatte nebst seinem ästhetischen Wert auch noch den, bewundernde Blicke vom Brautpaar abzuziehen, damit sie nicht etwa dem bösen Blick verfallen. Ein Teppich mit einem Milieu war seinerzeit vor das Wöchnerinnenbett gelegt, die Hebamme gab über diesem Teppich das Kind dem Vater, und wenn der Vater es als seines anerkannte und damit in den Familienverband aufnahm, dann legte er es eben in diese durch Ornamente gekennzeichnete Mitte hin.
Es wird die Wiener besonders interessieren, Bukowiner Teppiche zu sehen, welche direkt als Vorbilder für das Dach des Stephansdoms angesprochen werden könnten, in ihren bunten Zickzackornamenten über Rauten. Man weiß ja schon lange, daß dieser am weitesten in den Osten vorgeschobene westliche gotische Dom durch sein unikales, bunt glasiertes Kacheldach seine geopolitische Stellung in Ostarrichi markierte. Vor der Katastrophe war der Dom noch bunter glasiert als jetzt, und die Gegenüberstellung mit unseren bunten Bukowiner Läufern wäre noch frappanter ausgefallen. Natürlich ist damit nicht gesagt, daß hier ein direkter Einfluß von einem Teppich zu solchem Dach stattgefunden hat. Es sollen nur auch wieder die geistigen Zusammenhänge zwischen unserem Osten und Wien aufgezeigt werden.
Briefwechsel mit Marc Chagall
Aber auch moderne Argumente für einen regen künstlerischen Austausch zwischen dem Westen und der volkstümlichen Kunst unseres Ostraums finden sich in der Ausstellung — welcher Ostraum jetzt durch den Eisernen Vorhang vom westlichen Europa abgesondert ist.
So zum Beispiel zeigen uns die köstlich-drolligen figuralen Darstellungen aus dem bukolischlebensfreudigen Soldaten- und Privatleben der Huzulen, wie diese naive, in Ostgalizien und der Bukowina bis gestern noch aus dem heiteren Bedürfnis unseres Volkes entstandene Keramik den großen französischen Maler Marc Chagall angeregt hat. Ein Geiger Marc Chagalls steht in dieser Vitrine in Ansichtskartenreproduktion zwischen zwei Huzulen-Geigern. Er fühlt sich hier wie unter Brüdern und ganz zu Hause.
Es sei mir gestattet, hier auf einen kurzen Briefwechsel zu kommen, den ich unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg als Direktor des Ukrainischen Nationalmuseums in Czernowitz mit dem Meister geführt habe. Ich schickte ihm die Photographie einer ukrainischen Kachel, mit einem über den Dächern schwebenden Kosaken, zwischen den Häusern aber stand auf der Kachel ein Mädchen mit einer Blume. Es war eine Kachel, die um das Jahr 1830 zu datieren war. Chagall ging heiter auf diesen motivischen und stilistischen Zusammenhang zwischen unserer Volkskunst und seinen bekannten Fliegenden Bräutigams ein und antwortete mir: „Je suis de ceux qui m'aiment.“
Ukrainische Inspiration für Henri Matisse
Auch ein zweiter ganz großer Maler, Henri Matisse, ließ sich direkt von Bukowiner Motiven inspirieren. In fortissimo Fanfarentönen, aber wieder durch einen sicheren Farbengeschmack harmonisiert, finden wir in der Ausstellung hauptsächlich auf der Mittelwand Bukowiner Bauernärmel. Man hat sie, als die Bukowina noch österreichisches Kronland war und solche Hemden billig waren, vandalisch verschnitten und sie zu Polstern oder Vorhängen in Wiener Bürgerstuben verwendet. Bei unseren Bäuerinnen waren sie niemals nur Schmuck; die Mädchen stickten ihre stillen Hoffnungen in sie hinein, einmal in ihrer bunten Schönheit vor den Traualtar zu treten, und den Glauben, sie einmal als Totenhemd mitzubekommen, um dann am Jüngsten Tag, prächtig geschmückt, vor allen Völkern vor den Richterstuhl Gottes zu treten. Daneben sehen wir aber, wieder in Ansichtskartenreproduktion, Matisse mit seiner „Blouse Roumaine“. Matisse nannte diese Hemden, die er wiederholt in seinen Bildern benützt, Blouses Roumaine, weil es Palladi war, sein rumänischer Malerfreund, der ihm diese Bukowiner Blusen nach Paris brachte. Unsere ausgestellten Hemden, die Matisse als Modell dienten, stammen aus dem ukrainischen Huzulenraum. Aber es wäre töricht, in einem Europagespräch, welches nicht trennen, sondern verbinden soll, zu behaupten, die eine Bluse wäre rumänisch, eine zweite, beinahe gleiche, ukrainisch. Es sind Bukowiner Blusen, und überall in der Volkskunst, aber, gerade in solchen stürmischen Rand- und Durchgangsgebieten, wie die Bukowina es war, gibt es eine stetige ethnische und rassische Beeinflussung und Durchdringung der Motive. Hier kommt es uns wieder nur darauf an, zu zeigen, wie europäisch unsere Volkskunst auch in ihren Ausstrahlungen war. Solche stummen Zeugen eines Hin und Her, eines Gebens und Nehmens, einer dynamischen Verzahnung zwischen Land-und Völkerschaften, beweisen mehr als alle Gespräche, wohin unser jetzt von Europa weg-geriegeltes Volk hingehört.
Ukraine und die Kirche
Die Ukrainer sind ja auch die einzigen Ostslawen, welche sich hauptsächlich in Ostgalizien zu einem großen Teil (acht Millionen) im Spannungsgefälle zwischen der fatalistischeren und schicksalsergebeneren Ostkirche und der im freieren persönlichen Verantwortungsgefühl verankerten Westkirche, durch ihren Uebertritt zum unierten, zum griechisch-katholischen Glauben für Rom und damit für Europa entschieden haben. Womit hier wiederum nicht gesagt werden soll, daß sich die griechisch-orientalisch gebliebenen vielen Millionen Ukrainer nicht auch als Europäer fühlen. Dafür jetzt ein Hinweis: Der größte letzte Stil, der Europa“ einte, war bekanntlich vom Ende des 16. Jahrhunderts an, als er aus Italien kam, der Barockstil. So ist es nach dem hier Gesagten und dem in der Ausstellung Gezeigten kein Zufall, daß in unserer großen ukrainischen Kosakenepoche dieser europäische Barockstil herrschte. Der Barockstil kam überall in den Höfen auf und senkte sich von der Hofhaltung der Großen herab auf die Kirchen und das Volk.
Unser Hetman Bogdan Chmelnickyj lebte in einem Barockschlößchen in der Ostukraine, später auch Mazeppa in einem solchen. Mazeppa. dessen Abenteuer Chopin zu einer Komposition verwendete, den Lord Byron besang, Mazeppa, der Vernet zu seinem berühmten Bild, welches in der Deputiertenkammer in Paris hängt, inspirierte. In der Großukraine wurden im 17. und 18. Jahrhundert solche griechisch-orientalischen Kirchen im Barockstil gebaut, andere, so unsere alte und wichtigste Sophienkirche in Kiew, damals, wie eine Zeichnung des Engländers Westerfield vom Jahre 1651 beweist, umbarockisiert. Auch die das Dnjepr-Tal souverän beherrschende Andreas-Kirche in Kiew ist damals von einem italienischen Architekten in diesem Stil gebaut worden wie viele andere. Unsere griechisch-katholische Juryj-Kathedrale in Lemberg ist ebenfalls Barock. Dieser heitere, schwungvolle Stil, der „der große Europa-Stil“ genannt wird, mit seinen Lichtdurchbrüchen, durch die das Jenseits herunterstrahlt, drückte ja auch dem lebensbejahenden, gläubigen Wien von damals seinen Stempel auf, Wien, welches in dieser Zeit seiner höchsten Kulturblüte sich dem Barock jauchzend in die Arme warf.
Der Musikprofessor an der Sorbonne, Doktor Virsta, bewies, daß Beethoven ukrainische und nicht, wie früher behauptet wurde, russische Volksliedmotive in seinem Opus 105 verwendete. Dies ist wieder kein Zufall, denn Beethoven war Freund des Fürsten Razumofskij, der ein Nachkomme des ukrainischen Kosaken-hetmans Razumofskij war. Beethoven konzertierte viel in dessen Palais im 3. Wiener Bezirk, das vom selben Architekten gebaut wurde wie die Albertina in Wien. Auch der strenge Empirestil vereinte später Kiew öfter mit Wien. Die Wladimir-Universität von Kiew zeigt dasselbe mächtige Säulenmotiv wie das Rasumofskij-Palais in der österreichischen Kapitale. Auch die Ukrainer werden, wie die Oesterreicher ihrer Lebensführung wegen, oft als „Hupaktänzer und Banduraspieler“ von ihren Nachbarn verspottet. Aber in blutiger Stunde waren sie wie die Oesterreicher stets ritterlich bereit, ihren Mann zu stellen, um ihre Ideale zu verteidigen.