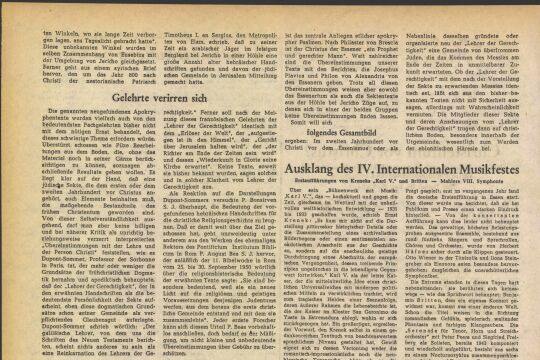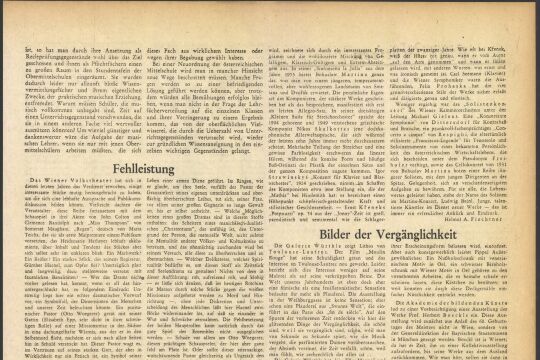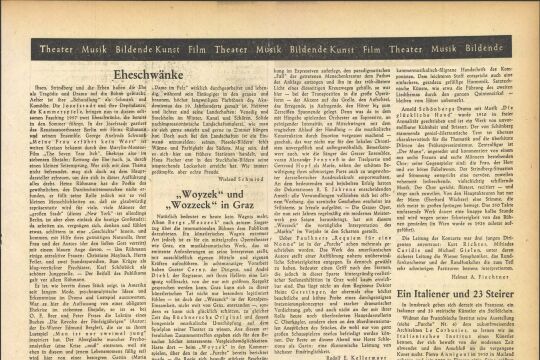Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die vorderste Linie
In diesen Herbstwochen feiert die musikalische Welt den 75. Geburtstag des erfolglosesten Komponisten. Es gibt Ansprachen, Radiokommentare und Konzerte zu Ehren eines Musikers, der eigentlich kein Publikum hat. Denn seit vor etwa 40 Jahren Arnold Schönberg der Tonalität absagte und die Komposition mit der demokratischen Reihe der zwölf völlig gleichberechtigten, nur aufeinander (also auf keinen Grundton) bezogenen Töne begann, komponiert er für seine Schüler und einen kleinen Kreis Eingeweihter. Nur sie kennen seine Syntax genau, ohne die Schönbergs musikalische Sprache unverständlich bleiben muß. Die Gründe hiefür liegen für den naiven Hörer in der Emanzipation der Dissonanz, dem Fehlen einer wahrnehmbaren formalen Gliederung und in der undurchdringlichen Dichte des stimmlich-thematischen Gewebes. — Diese merkwürdige Situation der Schönbergschen Musik bestätigte auch das Festkonzert, welches unter dem Ehrenschutz des Unterrichtsministeriums und der Gemeinde Wien die IGNM gemeinsam mit den Wiener Symphonikern veranstaltete. Das Konzert hatte zugleich auch instruktiven Charakter und führte uns von den frühen Orchester liedern (aus „Des Knaben Wunderhorn" und Petrarca) vom Jahre 1904 und dem gemischten Chor a capella „Friede auf Erden“ (nach C. F. Meyer), die beide noch ganz im Banne der „Tristan“-Harmonik stehen, über das Monodram „Erwartung“ (1909) und die „Begleitmusik zu einer Lichtspielszene“ (1930) bis zu einem der letzten größeren Werke Schönbergs, dem Klavierkonzert op. 42 aus dem Jahre 1942. Der Bruch in Schönbergs Entwicklung tritę mit aller-wünschenswerten Deutlichkeit zutage: er liegt unmittelbar vor dem Monodram. Bezeichnend ist auch, daß sich iy diesem, ebenso wie in der Lichtspielmusik, mit den drei Phasen: Drohende Gefahr, Angst und Katastrophe jene Seelenlage spiegelt, die so suggestiv aus dem bekannten Schönberg-Porträt Kokoschkas spricht, aus jenem Bild mit der beschwörenden Gebärde und der Urangst im Blick. Als Kunstwerk, ästhetisch und dramaturgisch betrachtet, ist diese über 30 Minuten dauernde Soloszene mit ihrer einzigen Stimmung unheilvoller Erwartung — etwa im Stile von „Salome“, „Elektra" oder Maurice Maeterlincks — ein Unding. Die Musik zeigt schon jenes zerrissene Bild, jene übergroßen Intervall-Schritte, die ein Charakteristikum für Schönbergs Spätstil sind und in der freien, fast rhapsodischen Form der Lichtspielmusik überdeutlich ausgeprägt sind. Vor dem Klavierkonzert kapituliert der Rezensent, da beim ein- und erstmaligen Hören dasjenige, worauf es dem Komponisten ankommt, nämlich eine bestimmte Tonreihe in ihren sämtlichen Abwandlungen (Umkehrung,
Krebs und Umkehrung des Krebses) mit dem Ohr nicht zu erfassen waren. An musikalisch greifbarer Substanz im Sinne der Musikentwicklung etwa der letzten 300 Jahre bietet dieses Konzert fast nichts. Schönberg hat diese seine Position in der vordersten Linie klar erkannt, als er schon 1934 schrieb: „Ich weiß seit langem, daß ich Verbreitung des Verständnisses für mein Werk nicht erleben kann, und meine vielgerühmte Standhaftigkeit ist eine Zwangslage und stützt sich auf den Wunsch, es dennoch zu erleben.“ Auch wir zweifeln daran, daß es uns noch einmal gelingen wird, uns in Schönbergs Klangsystem einzuhören, aber wir schulden dem Werk jene Aufmerksamkeit und Achtung, die seiner Position in der vordersten Linie angemessen ist. Aber wird diese weitvorgeschobene Stellung sich eines Tages nicht vielleicht als ein verlorener Posten erweisen? Diese Frage bleibt offen und kann nur von der Zukunft beantwortet werden. — Allerhöchste Anerkennung verdienen die ausführenden Künstler dieses Konzerts: der Dirigent Herbert Häfner vor allem, der die überkomplizierten Partituren des Monodrams und des Klavierkonzerts erarbeitet und einstudiert hat, Felix Prohaska als zweiter Dirigent des Abends, Peter Stadien und Ilona Steingruber in solistischen Aufgaben,-die nur von Künstlern mit höchster Musikalität zu bewältigen sind, Julius Pat- zak in wesentlich leichteren Gesangspartien und die Symphoniker.
Aus der gleichen Sphäre kommt Alban Bergs letztes vollendetes Werk, das Violinkonzert, als Requiem für die jungverstorbene Manon Gropius gedacht. Auch dies — ein Werk im Zwölftonsystem, aber um wieviel freier, melodischer, „musikalischer"! Die neue Technik wird so souverän angewendet, daß sich nicht nur die anmutig-melancholischen Kärntner Volkstanzweisen, sondern auch die Melodie des Bachschen Chorals „Es ist genug“ in das Liniengeflecht der Stimmen einfügen. Der ausgezeichnete Geiger Andrč Gert- 1 e r, Professor am Conservatoire Royal de Musique in Brüssel, war der Interpret in einem Sonntagvormittagkonzert der Ravag unter Herbert Häfner. Von dem gleichen Geiger hörten wir im Rahmen eines Konzerts der Universal-Edition einen Satz aus dem Violinkonzert von Casella, eine „Rhapsodie roumaine“ von Jean Absil (nach von Bela Bartök gesammelten Volksthemen) und, als Höhepunkt, die außerordentlich schwierige Sonate für Solovioline von Bela Bartök, bei deren Interpretation sich der belgische Geiger als wahrer Zauberer des Klangs und blendender Techniker erwies.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!