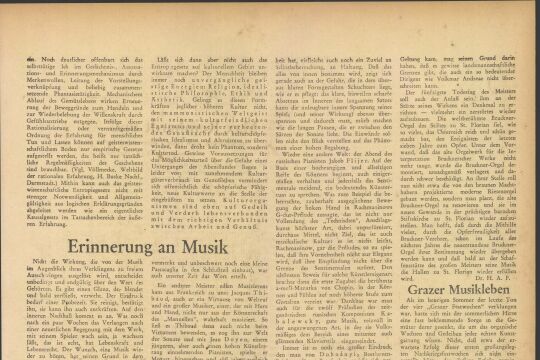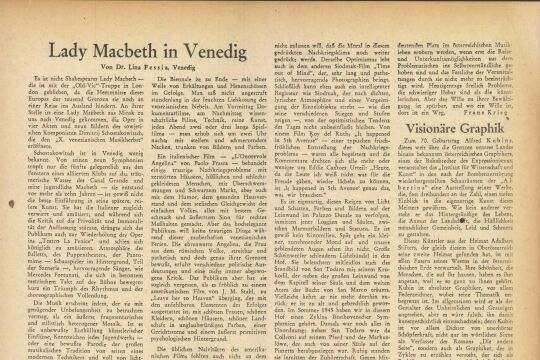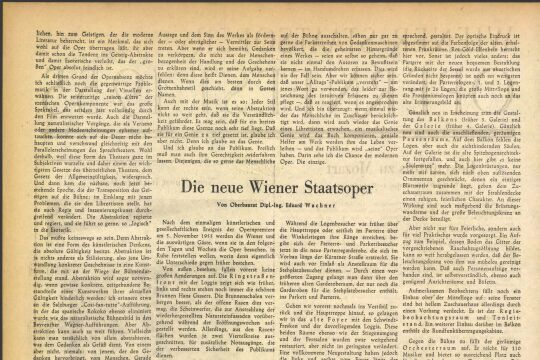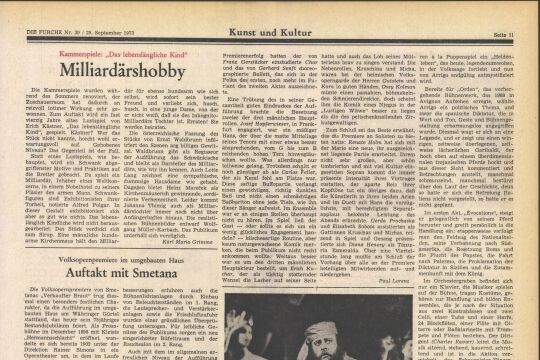Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Diesseits der chinesischen Mauer
Kurz vor Berlin zieht das Flugzeug eine Schleife: dunkelblau leuchten die Havelseen herauf, und von rechts grüßt mit dem herbstlichen Gold seiner breiten Alleen Potsdam herauf. Und dann, auf einmal — man hat soviel darüber gehört und gelesen und traut trotzdem seinen Augen nicht: das Bild eines Kriegsschauplatzes oder eines Riesen-Konzentrations- lagers. Kilometerlang, bis er sich in dem von einem kleinen Wald aufsteigenden Dunst verliert: der „Todesstreifen”, völlig kahl und leer, mit hölzernen Wachttürmen, etwa alle hundert Meter, wie man sie aus den KZ-Bildern kennt. Aber schon ist man in Tempelhof gelandet, wo ein lebhafter Betrieb herrscht, wie eh und je. Das aus München gekommene Flugzeug war bis auf den letzten Platz besetzt, ebenso das kurz vorher gelandete, und, wie man mir am Flughafen sagt, auch die nächste, aus Frankfurt kommende Maschine, die in wenigen Minuten erwartet wird. Über die Flucht von Hunderttausenden aus Berlin haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gelesen. Aber auch der Verkehr nach Berlin ist nicht zum Stillstand gekommen …
So auch bei den heurigen Berliner Festwochen vom 24. September bis zum 10. Oktober. Von den zahlreichen auswärtigen und ausländischen Künstlern und Ensembles (es waren insgesamt 770 Personen) hat, vom 79jährigen Strawinsky bis zum Haiti-Ballett, niemand abgesagt. Im Gegenteil: die Leitung der Berliner Festwochen bekam zahlreiche Angebote, von denen sie keinen Gebrauch machen konnte, und die internationale Kunstkritik war mit insgesamt 180 Mann vertreten, unter diesen viele, die heuer zum erstenmal nach Berlin gekommen sind. Die Kunst- und Kulturwelt steht also demonstrativ zu West-Berlin. Mehr kann sie leider — ohnmächtig wie sie ist — nicht tun. Aber die Berliner freuen sich trotzdem, daß man zu ihnen kommt. Um so mehr, als zum erstenmal die Bewohner aus der Zone fehlen, die bei manchen Veranstaltungen der Berliner Festwochen bis zu 40 Prozent der Besucher stellten.
Freilich gab es auch eine besondere Attraktion: die Eröffnung des neuen Hauses der „Deutschen’Oper Ber1in”. Es liegt im Zentrum West-Berlins, in der Bismarck-Straße, nur wenige Meter voi der Fahrbahn, und .ist mitreeiner rtöbt liehgBt’sfensterlosen Fassade füf-ddff Ftein- den kaum von anderen modernen Bauten dieses Viertels zu unterscheiden. Die einzige Dekoration bildet eine riesige Eisenplastik von Hans Uhlmann, deren Schatten auf der glatten Fläche wandert und die abends angestrahlt ist. Der Zuschauerraum ist amphitheatralisch, mit einigen vorspringenden Logen, hellgelben Sitzen und graubratin getönten Wänden aus edlem Holz. Wenig glücklich ist die Deckenbeleuchtung: zwanzig, dreißig verschieden große runde Glasscheiben unter den Lampen, die irgendwie an ein technisches Büro erinnern. Die Foyers im ersten Stock eind in schmucklosem Grau gehalten, von dem sich ein großes, grellbuntes abstraktes Bild (Polyphonie von E. W. Nay) sowie eine Monumentalplastik von Henry Laurens (La grande musicienne) abheben. Am wenigsten gelungen ist das Foyer des ersten Stockes, das zu einer labyrinthischen Garderobe ausgebaut wurde und eher an eine Flughafenhalle als an den Vorraum eines Opernhauses erinnert. Sieht man von den häßlichen Leuchtkörper-Ballons im großen Foyer, wie man ihnen auf Künstlerfesten begegnet, ab, so wird der Gesamteindruck — von der Fassade und den Garderoben über die Foyers im ersten Stock bis zum Zuschauerraum — immer günstiger. Die Bühne schließlich läßt, ebenso wie Akustik und Sicht, kaum einen Wunsch offen. Und das ist bei einem Opernhaus schließlich die Hauptsache.
Am ersten Opernabend, dem der Verfasser dieses Berichtes beiwohnte, gab es bereits in der ersten Minute, als sich, nach wenigen Einleitungstakten des Or chesters, der Vorhang teilte, lebhaften Applaus. Er galt dem Bühnenbild, das Wilhelm R e i n k i n g für das szenische Vorspiel zu der Oper „Alkmen e” nach Kleists „Amphitryon” geschaffen hatte. Es ist in der Tat bezaubernd und von einer Heiterkeit, die uns die Musik des jungen, hochtalentierten deutschen Komponisten Giselher Klebe fast den ganzen Abend über schuldig blieb. Die riesige Bühne ist ausgestattet mit kleinen, wie Vogelhäuschen aussehenden Tempeln, in deren jedem die Bewohner des Olymp in gefälligen Gruppen beisammen sind. Klebe nimmt die Amphitryon-Ge- schichte, die Giraudoux und so viele vor ihm abgewandelt haben, durchaus ernst und schrieb dazu eine feine, differenzierte Musik, die auch die Singstimmen (Evelyn Lear, Thomas Stewart, Walter Dirks, Richard Lewis, Ernst Krukowski und Lisa Otto) nicht zu kurz kommen läßt. Was dieser Musik, deren einzelne Teile keineswegs austauschbar sind, fehlt, ist die große Linie, die plastische Gestaltung, das rhythmische Element, dessen Absenz den Eindruck des Amorphen und Monotonen hervorruft. Aber die Inszenierung Gustav Rudolf Seil ners. des neuen Intendanten. die hervorragende Wiedergabe aller Solopartien sowie des Orchester- und Chorparts unter der Leitung Heinrich Hollreisers sowie die reizenden Bühnenbilder und Kostüme Verhalten dem Werk, auch bei der zweiten und dritten Aufführung (also vor einem quasi nor malen Auditorium), zu einem echten Publikumserfolg.
Ob dieser auch dem „Doktor aus Glas” von Roman V1ad nach einem Buffo-Stoff von Philippe Quinault beschie- den sein wird, der in der Akademie der Künste in einer Studioaüfführung unter der Leitung Wolf Volkers gezeigt wurde? Eher schon dem anderen Einakter dieses Abends, der gleichfalls uraufgeführ- ten Kammeroper „Escorial” von dem Berliner H. F. H a r t i g nach dem gleichnamigen Schauspiel Michel de Gheldero- des, einem in der Grabkammer der spanischen Könige spielenden Stück, in dem es um Machtwahn und Selbstzerstörung geht und das vom Komponisten mit einer fesselnden, expressiven und effektvollen Musik sowie mit dankbaren Rollen und Gesangspartien (allerdings nicht für junge Sänger!) ausgestattet wurde.
Am meisten aber sprach man in Berlin von Wieland Wagners „A ida” - Inszenierung, die alle traditionellen Vorstellungen, die man von dieser populären Oper hat, über den Haufen wirft und ein archaisches Ägypten vor den erschreckten und gebannten Zuschauer stellt, dessen Symbol ein mächtig aufragender Totempfahl ist. Aber auch an diesem Abend wurde dem Publikum Versöhnliches geboten: in den großartigen Stimmen von Gloria Davy, Christa Ludwig. Jess Thomas, Thomas Stewart und losef Greindl sowie durch das unter Karl Böhms Leitung herrlich musizierende Orchester.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!