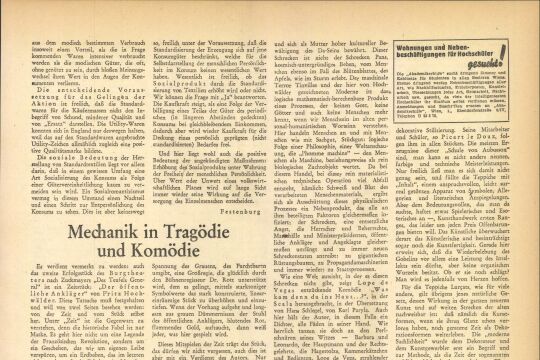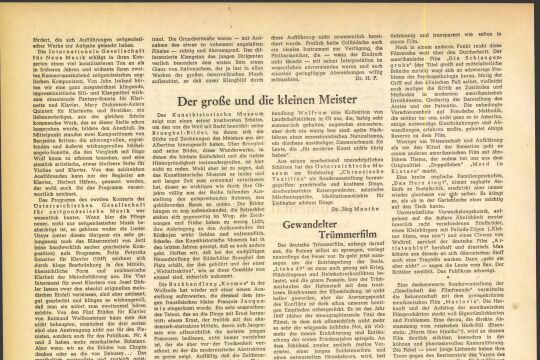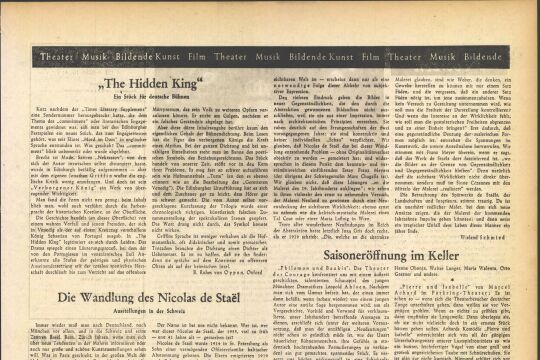Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Drei große Kunstausstellungen
Der Albertina und ihren Wissenschaftlern hat es Wien zu danken — ob es das wirklich tut, ist aber zu bezweifeln —, daß es heute noch Aus-steltungsmetropole ist und die großen Werke der Moderne noch ein Stückchen weiter als nur bis in die Kunsthäuser von Winterthur oder München kommen. Und die neue Albertina-Exposition von nahezu 250 Zeichnungen, Aquarellen und Druckgraphiken Marc Chagalls ist nur ein neues Glied in einer seit sieben Jahren nicht unterbrochenen ■ Kette hervorragender Ausstellungsunternehmen.
Marc Chagall, Führer und Außenseiter zugleich unter den Künstlern dieses Jahrhunderts, stammt aus einer Familie russischer Juden und ist sein Lebtag lang, ob in Paris, Moskau oder Berlin, ein Chasside und ein Mystiker geblieben: „Die Kunst scheint mir vor allem ein Zustand der Seele zu sein“ — dieses Ausspruches wäre kaum ein anderer Moderner fähig gewesen, noch hätte ein anderer ihn zu Recht auf das eigene Werk anwenden dürfen. Chagalls Kunst ist fromm und jüdisch wie das Alte Testament — schwermütig wie die Predigt des Königs Salomo, verzückt wie das Hohe Lied und schön wie die Gesänge Davids. (Und wohl auch tiefsinnig und scharf wie der jüdische Witz.) Daß in diesem Werk immer wieder die Erinnerung an die Heimat auftaucht, an verlorene russische Dörfer, an deren Himmeln sich wunderliche Dinge tun, an brennende Sabbatleuchter, unter denen versunkene Gesichter sich über den Talmud beugen — nun das ist nicht verwunderlich. Aber Chagalls Frömmigkeit ist — wie jede andere — fähig, auch entfernteste Themen oder Bewußtseinsinhalte zu fassen und zu absorbieren: Motive aus den> Neuen Testament oder Lafontaines Fabeln, zu denen Chagall einen Zyklus von nahezu visionären Radierungen geschaffen hat. Die Farblithographien aber zu den Geschichten aus Tausendundeiner Nacht — nun darüber ließe sich entweder eine Notiz oder ein Buch, jedenfalls aber nicht mehr ein Absatz schreiben. Man gehe hin und sehe sie sich an.
Leonardo da Vinci — dieser Name steht in den Koordinatensystemen der Kunstgeschichte neben jenem Schnittpunkt, in dem sich — dank eines historischen Zufalls oder einer göttlichen Ueberlegung — für einmal die Widersprüche zwischen Denken und Erfühlen, zwischen Konstruktion und Organisation zugunsten einer unausmeßbaren Harmonie aufhoben. Man könnte sagen, daß Leonardos Werk der Nullmeridian der neueren Kunstgeschichte ist, man könnte ihn selbst mit der Sphinx vergleichen, die das Rätsel nicht preisgibt: den Punkt nämlich, vpn dem aus der Künstler — sonst immer nach Totalität strebend und immer wieder zum Spezialisten verurteilt — die Welt nicht nur erfassen, sondern auch,, vielleicht, beherrschen könnte. Leonardo allein hat ihn gefunden. Und deshalb ist er, allem Stil- und Geschmackswandel zum Trotz, immer „aktuell“ geblieben; und da heute, neben anderen, auch die Künstler in klarer Bewußtheit zum „Totalen“ streben (was immer sie und wir uns darunter auch vorsteilen mögen), ist ihnen Leonardo fast nicht weniger wichtig als Picasso . . .
Es ist also aus mancherlei Gründen anzunehmen, daß die gemeinsam von österreichischen, französischen und italienischen Kunsthistorikern in der Kunstakademie aufgebaute Leonardo-Ausstellung großen Zulauf finden wird. Denn es sind in ihr zwar keine Originale zu sehen, wohl aber jene Makro-, Infrarot- und Quarzlichtphotos, mit denen die heutigen Kunstspezialisten näher an den Ursprung, an Entwurf und Intention herankommen wollen: phantastische Methoden, deren Ergebnisse faszinierend sind und das Lächeln der Mona Lisa zwar um nichts weniger rätselhaft, dafür aber so groß machen, daß man, nicht nur aus Gründen des Taktgefühls, schnell einige Schritte zurücktritt.
Das Oesterreichische Barockmuseum im Unteren Belvedere ist nun, nach langer Pause, wiedereröffnet worden: 15 Schausäle, darunter auch der so traurig zerstört gewesene und schön restaurierte Groteskensaal.
Nun, wir stehen nicht an, zu sagen, daß dieses Museum, so prächtig es auch ist, von seinen Besuchern ein wenig Phantasie verlangt; denn es ist nun einmal so, daß gerade die hohen Leistungen des Barocks niemals in einem Museum zu finden sein werden — aus dem einfachen Grunde, weil man Karlskirche oder das Stift von Sankt Florian ebensowenig in einem Museum unterbringen kann wie die Fresken Grans oder Maulpertsch'; anderseits „leben“ gerade diese barocken Denkmäler noch und werden noch lange nicht zu Museen werden. Die Folge davon ist, daß in einem Barock m u s e u m notwendigerweise nur die Kleinkunstwerke des 18. Jahrhunderts stehen können — aber die zweispannenlangen und doch wahrhaft antikischen Götterfiguren G. R. Donners haben nicht viele Verwandte im kleinen Format und großen Geist —, neben ihnen aber fast ausschließlich aus dem Zusammenhang gerissene Objekte — Altarbilder zum Beispiel — und schließlich eine Unzahl von Entwürfen, Skizzen und Vorstudien zu riesigen Deckenfresken oder ähnlich umfangreichen Werken. Das heißt: wer die Architekturen des österreichischen Barock kennt, wird von diesem Museum nicht enttäuscht sein. Der Unwissende aber wird, ungeachtet aller Sorgfalt, mit der man versucht hat, Bilder und Plastiken in die zeitgenössischen Räume dei Bel-vederes einzuordnen, eher enttäuscht sein — er sieht ja nur schöne Splitter aus einem unvergleichlich gewaltigen Ganzen. Der Zweck eines Museums ist freilich ein anderer als der einer Lehrausstellung; aber ein wenig bedauert man doch, daß es ihm die Konvention verwehrt, mit Mitteln, wie Photomontagen oder Hinweistafeln, zu arbeiten, um die Struktur eines Stiles darzustellen, in dem auch das schönste Bild nur Ornament des Ganzen ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!