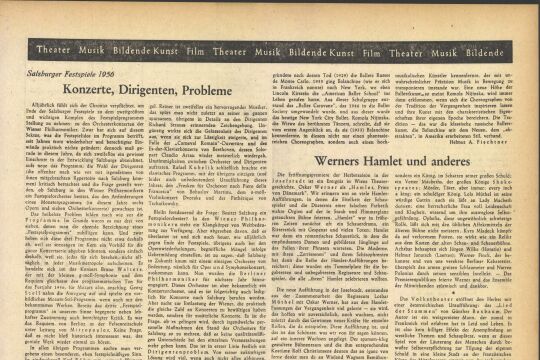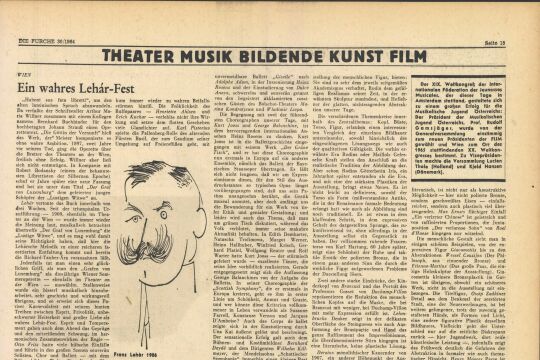Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein großer Ballettabend
Drei nicht nur stilistisch verschiedene, sondern auch dem Inhalt nach denkbar gegensätzliche Werke standen auf dem Programm des letzten Ballettpremierenabends der Wiener Staatsoper. Er wird während der Festwochen wiederholt und ist zugleich der letzte, den Aurel von Milloss gestaltet hat. Für Wien. Denn er wird künftig in Rom tätig sein. Doch hoffen wir, ihn als Gastchoreographen bald wieder bei uns zu sehen.
Mit der im Mittelpunkt stehenden „Serenade” von Baianchine nach Musik Tschaikowskys setzt Milloss seine selbstgestellte Aufgabe fort, die Solisten und das Corps de Ballet an Meisterwerken zu schulen. Denn zu diesen kann Baianchines Werk, obwohl erst (oder schon) 1934
geschaffen, durchaus gezählt werden. Wir sahen es wiederholt in Wien und anderswo. Die damit geleistete Arbeit und Kleinarbeit ist im höchsten Grad anzuerkennen. Daß sie, im ganzen, nicht jene Brillanz hatte, wie sie etwa die Balanchine-Truppe ausstrahlt, liegt in der Struktur unseres (und aller anderen) Staatsopernballette begründet. Auf dekorationsloser Bühne erleben wir, vor blauem Hintergrund, ein reines Spiel der Formen, das sich im letzten Teil, der „Elegie” (die bei Tschaikowsky an vorletzter Stelle steht), auch zu persönlicher Aussage konzentriert. — Francia Rüssel hatte Baianchines Meisterwerk einstudiert. Die Haupttänzerinnen waren die Damen Brexner, Klemisch und Lisi Maar, die Haupttänzer Karl Musil und Paul Vondrak, die insgesamt überdurchschnittliche Leistungen boten.
Kaum ein größerer Gegensatz zu dieser klassisch gerundeten und ausgereiften Schöpfung ist denkbar als das ihr vorausgeschickte neue Ballett. „Tancredi” nach Musik von Hans Werner Henze in der Choreographie Rudolf Nurejews. Die farbige, opalisierende und erfindungsreiche Musik, die auch prägnant-rhythmischer Passagen nicht entbehrt, stammt aus einem früheren Ballett Henzes, das 1952 uraufgeführt und unmittelbar darnach vom Komponisten zurückgezogen wurde. In den letzten Jahren schrieb Henze auf ein Libretto von Peter Csobadi, der den Musikfreunden Wiens als künstlerischer Betreuer der hier vor zehn Jahren begründeten „Philhar- monia Hungarica” noch in bester Erinnerung ist, eine neue Partitur, die an diesem Abend zum erstenmal erklang. Die von Peter Csobadi ersonnene, ebenso einfache wie poetische und allgemein-menschliche Aktion zeigt einen Mann, Tancredi, zwischen zwei Frauen: der mädchenhaft-unschuldigen Cantilena und der sinnlich-dämonischen Laura, zwischen denen er sich nicht entscheiden kann. Der Konflikt führt zur Persönlichkeitsspaltung des Helden und zu dessen Tod in dem Augenblick, da sich die beiden Tancredi von ihren Idolen lösen und wieder in eine Person Zusammenstürzen. Rudolf Nurejew war nicht nur der umjubelte Titelheld dieser psychologisch-dramatischen Aktion, sondern auch deren Choreograph, der das gradlinige Szenar Csobadis in eine surreale Phan-
tasmagorie verwandelte, zu welcher der australische Bühnenbildner Barry Kay den entsprechenden Rahmen und die Kostüme schuf. Durch allerlei Zutaten und Nebenpersonen wurde der Kern des Ganzen übermäßig verkompliziert und verdunkelt. Da gab es eine „Urmutter” und die Gruppe der „Lebenspendenden”, neben Tancredis zweitem Ich auch dessen „Reflektionen” (sieben Tänzer!), die Spiegelungen des ersten Frauenbildes (sieben Tänzerinnen) und anderes mehr. Vor allem aber waren die beiden gegensätzlichen Frauenbilder Cantilena und Laura (Lisi Maar und Ulli Wührer, beides vorzügliche Tänzerinnen) viel zu wenig voneinander differenziert. In der Titelpartie bot Rudolf Nurejew, ohne sich je in den Vordergrund zu spielen, eine faszinierende Leistung: als Tänzer und Darsteller, der in manchen Posen an Bilder des jungen Kainz erinnerte.
Abschluß und Krönung des interessanten Abends waren „Les Noces” von Strawinsky, jenes großartige Werk, an dem der Komponist jahrelang gearbeitet hat und das sich nach seiner wenig erfolgreichen Pariser Uraufführung im Jahr 1923, vor allem wegen seiner komplizierten Besetzung, nur selten im Repertoire der großen Tanzensembles und Operntheater findet. Denn diese „russischen choreographischen Szenen mit Gesang und Musik” verlangen im Orchesterraum vier Klaviere, vier Gesangssolisten, einen kleinen Chor und einen großen Schlagwerkapparat. Der Rezensent sah das Werk zuletzt bei den Salzburger Festspielen in einer Choreographie Maurice Bejarts und während der Berliner Festwochen vor einigen Jahren in einer prunkvollen Ausstattung Michel Raffaelis, gewissermaßen als „Nobelhochzeit”. Aurel von Milloss hat von der szenischen Realisierung dieser zugleich raffinierten und strengen Musik eine andere Vorstellung. Der Rahmen — ebenso wie die Kostüme von ihm selbst entworfen — ist in Schwarz, Weiß und Grau gehalten, die Kostüme in Pastellfarben, von denen nur die grellbunten Perücken abstechen. Das Russisch-Folkloristische ist nur angedeutet oder sublimiert, die einzelnen Szenen klar gegliedert (zuweilen symmetrisch) und von idealer Übersichtlichkeit. Das Rituelle und das Spirituelle halten sich genau die Waage, und der Gesamteindruck ist der einer herben Schönheit. Am Schluß, wenn die Glockenschläge erklingen, die Hochzeitsgäste sich im Vordergrund kniend bekreuzigen und im Hintergrund die beiden Brautleute einander zugewandt stehen, breitet sich eine „Stimmung” aus, die aus vitalen und sakralen Elementen gleichermaßen genährt ist — wie sie dem bäuerlichen Leben entspricht. Von wunderbarer Elastizität und Spannkraft, anmutig und geistreich, war Christi Zimmerl als Braut, ihr zur Seite Ludwig Musil als Bräutigam. Auch die musikalische Realisierung der drei Werke unter Ernst Märzendorfer ließ keinen Wunsch offen. Zum Schluß: überaus herzliche Ovationen und viele Blumen für Milloss. Auf nichts versteht man sich hier so gut, wie aufs Abschiednehmen
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!