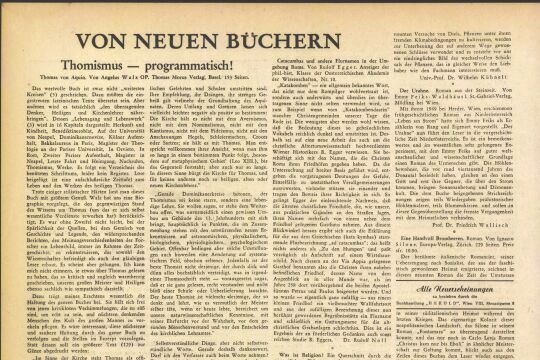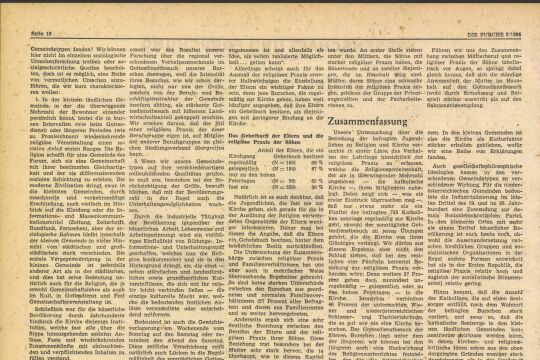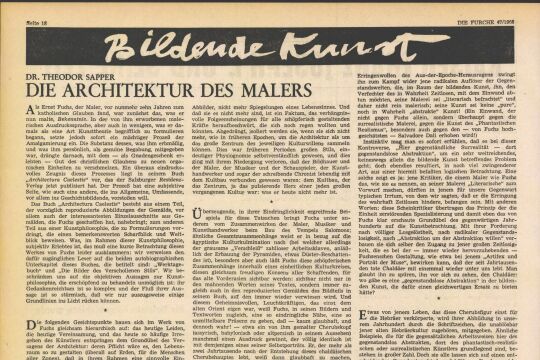Die zweitgrößte Insel der Welt — Neuguinea — ist selbst heute noch keineswegs zur Gänze erforscht. Im Tropengürtel der Südsee gelegen, zeichnet sie eine überwältigende Fülle der Pflanzen- und Tierwelt aus und die von nahezu undurchdringlichen Urwäldern bedeckten Gebirgszüge sind reich an verschiedenartigsten Mineral- und Erzvorkommen. So werden beispielsweise die reidihaltigen Goldvorkommen im Inneren der Insel wohl ausgebeutet, doch müssen zu diesem Zwecke Flugzeuge eingesetzt werden, um einerseits der Ungunst der Umwelt zu begegnen und um andererseits den feindlich gesinnten Eingeborenen auszuweichen.
Die ältesten Bewohner Neuguineas sind die Papuas. Dieser Name ist jedoch nur als Sammelbezeichnung zu werten, denn sowohl rassisch als auch ethnologisch und linguistisch tritt uns unter demselben eine Fülle sich wohl von einander unterscheidender Stämme entgegen, die manchmal kaum hundert Köpfe zählen. Rassisch leben neben austrah-formen Typen Vertreter des feinen, vielfach semitisch anmutenden Melanesiertypus, sowie solche eines derberen, protomorphosen Melanesiertypus. Schließlich treten auch noch zwergähnliche Völker auf, die seinerzeit der Wiener Pestforscher und Anthropologe Dr. Rudolf Pöch als erster in Neuguinea nachweisen konnte. Die sprachliche Zerklüftung in eine Vielheit von selbständigen Idiomen wurde von dem österreichischen Ethnologen und Linguisten P. Dr. Wilhelm Schmidt genauestens studiert. Diese sprachliche Zerklüftung brachte es mit sich, daß beispielsweise manche Nachbarstämme nur mittels Dolmetscher sich verständigen können. Solche Sprachmittler gehen aus den Jugendlichen der Nachbarstämme hervor, die im gegenseitigen Einvernehmen, der oft nur dorfweise getrennten Stämme ihre Jugend bei den Nachbarn zum Zwecke der Erlernung der Sprache verlebt haben. Bunt und vielfältig ist aber auch das kulturelle Bild, wenngleich dasselbe bemerkenswert viele Ähnlichkeiten mit den Lebensverhältnissen der europäischen St-in zeit aufweisen kann. Wir dürfen aber auf Grund der letzteren Feststellung jedoch keineswegs auf ein wirklich primitives, kulturarmes Dasein der Papua schließen, möge auch deren technisch-zivilisatorische Lebensführung einfacher als unsere eigene sein. Als Beweis dafür bringe ich nachfolgend einen Tatsadienberidit, der ebenso rätselhaft als auch wunderbar ersdieint und unserer Selbstüberhebung als einzige Kulturträger Abbruch zufügt.
Bereits 1907 wies P. Abel in einer Studie über Knabenspiele auf Neu-Mecklenburg auf die aligemeine Anschauung der dort lebenden Eingeborenen hin, daß sich die Angehörigen der beiden indigenen Heiratsklassen in den Handlinien unterscheiden sollen. Aber auch die auf der Gazellehalbinsel beheimateten Gunantuna vertreten nach P. Laufer die gleiche Anschauung. Nun hat P. Dr. Georg , Höltker gelegentlich seiner in den Jahren 1936 bis 1937 durchgeführten Neuguineaexpedition nicht nur ethnologische und linguistische Studien betrieben, sondern auch im Zuge anthropologischer Aufnahmen eine größere Anzahl von Daktylogramimen gesammelt, die er mir zur Überprüfung obiger Behauptung übersandte.
Die soziologische Gliederung der Gunantuna in zwei getrennte Heiratsklassen muß als Beweis einer höheren als urkulturlichen Gesittung gewertet werden. Derartig* soziologische Gliederungen treffen wir in der Südsee bei allen mutterrechtlichen und hochbautreibenden Stämmen nahezu immer an. EKirch diese Gliederung ist eine strenge Heiratsregelung gesichert, denn es dürfen sich nur stets Angehörige der beiden unterschiedlichen Heiratsklassen zu einer rechtisgültigen Ehe vereinen.
Die Haut des Menschen und fast aller Säugetierordnungen zeigt auf der Innenfläche der Hände wie auch der nach unten gekehrten Fläche der Füße abweichend von fast der ganzen übrigen Haut Erhebungen und Senkungen, die als parallel laufende Stromlinien kunstvoll sich zu Liniengebilden von bestimmi ten Musf-rrmen anordnen.
Durch diese Reibehaut wird an den betreffenden Stellen der Tastsinn in seiner Wirkungsweise besonders unterstützt. Die Eigentümlichkeit dieser Haut ermöglicht es nun, mittels Einfärbung derselben den feineren Verlauf der Hautleisten sichtbar zu machen und auf Papier durch Abdrücken der eingefärbten Stellen festzuhalten.
Es hat sich nun gezeigt, daß derartige Abdrücke individuell die größte Mannigfaltigkeit zeigen und für den kriminalistischen Erkennungsdienst von unschätzbarem Werte sind. Die einzelnen Hautleisten sind nämlich vom Alter sowie sonstigen Einflüssen in ihrem Ausbildungsgrade ebenso wie in ihrer kombinatorischen Formung vollkommen unabhängig und bilden daher ein sicheres Charakteristikum des einzelnen individuellen Trägers der Muster. —■ Die Hautleistenmuster an den Fingerbeeren können entweder über die Kuppe ungestört verlaufende Bogen oder aber radial, das ist Speichen-, beziehungsweise ulnar, das ist ellenwärts gerichtete Schleifen oder schließlich komplizierter gebaute und meist in sich geschlossene Wirbelmuster sein. Nun kommt den Fingerbeer- sowie den Handabdrücken nicht nur in der Kriminalistik unter dem Namen der „Daktyloskopie“ eine erhöhte Bedeutung zu, sondern es hat sich auch gezeigt, daß sie außer für die individuelle Identifizierung ebenso erbbiologisch-anthropologisch wertvolle Kriterien darstellen. Die Anzahl der einzelnen Leisten auf den Fingerbeeren sowie die von diesen Leisten gebildeten Muster in ihrer Form und in der jeweiligen räumlichen Lage auf der Hand- und Sohlenfläche sowie auf den Fingerbeeren bilden eine Grundlage für weitere, besonders erbbiologisch sehr wertvolle Erkenntnisse.
G. Höltker übersandte mir nun seinerzeit die Daktylogramme von 63 Papuas; unter diesen befanden sich solche von 35 Gunantuna, die sämtliche einer drei Generationen umfassenden Sippe angehörten.
Der Verteilung nach sind der Muttertypen auf den Fingerbeeren dieser 63 Gunantuna zu 3,4 Prozent Bogen, 3,7 Prozent radiale und 62,6 Prozent ulnare Schleifen sowie 30,3 Prozent Wirbel. Diese Verteilung steht jener der Negritos Afrikas sehr nahe. Denn es haben die Negritos relativ zahlreiche (von 3 bis 18 Prozent) Bogen und wenige (von 15 bis 34 Prozent) Wirbelmuster, dagegen nimmt bei den Mongoliden die Zahl der Bogen (von 0 bis 7 Prozent) ab und jene der Wirbelmuster (von 33 bis 81 Prozent) zu. Die Europiden nehmen eine vermittelnde Stellung zwischen diesen beiden Großrassen-kreisen ein. — Zwischen den der obgenannten Sippe „To-Palaram“ angehörigen in Paparatava lebenden Gunantuna und anderen sippenfremden Gunantuna besteht in der Häufigkeit der Mustertypen kein nennenswerter Unterschied. Auffallend ist jedoch die Tatsache, daß von den der Sippe „To-Palaram“ angehörigen Paparatavaleuten 29 Prozent an beiden Händen die gleichen Musterfolgen auf den Fingerbeeren zeigen, dagegen ist bei 43 Prozent der übrigen Gunantuna eine gleiche Musterfolge festzustellen. Andererseits haben jedoch 39 Prozent der sippen-angehörigen Paparatavaleute radialwärts gerichtet Schleifen und bloß 25 Prozent der sippenfremden Gunantuna zeigen dieses immerhin seltenere Merkmal am zweiten oder dritten Finger. Außer den Mustern auf den Fingerbeeren treten aber auch auf der inneren Handfläche verschiedene Musterbildungen im Verlaufe der Hautleisten auf. Vor allem sind es der Daumen- und der Gegendaumeniballen, das sind der Thenar und Hypothenar, welche Träger von Haut-leästenmuister sind. Von den Angehörigen der obengenannten Sippe sind nun 39 Prozent und von den Sippenfremden jedoch 87,5 Prozent Träger derartiger Muster. Fassen wir diese objektiven Tatsachenfeststellungen zusammen, so ergibt sich, daß gleiche Musterfolgen auf den Fingerbeeren beider Hände sowie Muster auf Thenar und Hypothenar bei den „To-Palaram“ Gunantuna bedeutend seltener sind als bei sippenfernen Gunantuna, dagegen haben die letzteren seltener radiale Schleifen als die ersteren. Es besteht daher in diesen Haut-leistenmustern tatsächlich eine auffallende Verschiedenheit zwischen den Angehörigen einer bestimmten Sippe und den außerhalb dieser Sippe stehenden Gunantuna.
Der allgemeinen Anschauung dieses Papuastammes zufolge sollen sich die Angehörigen der beiden Heiratsklassen auch in den Handlinien — richtiger wohl in den Hautleistenmustern an der inneren Handfläche und auf den Fingerbeeren — unterscheiden. Da nun Angehörige einer Sippe auf Grund der bestehenden Heiratsordnung stets einer und derselben Heiratsklasse angehören und daher erbmäßig an den Sippenältesten gebunden sind, so werden bei diesen bestimmte Erbmerkmale häufiger anzutreffen sein als bei sippenfremden Stammesangehörigen. Es ist daher auf Grund obiger Feststellungen naheliegend, die Schlußfolgerung zu ziehen, daß tatsächlich die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Heiratsklasse von auffallenden Unterschieden in den Musterbildungen des Hautleistensystems begleitet erscheint. Dadurch wird aber die rätselhafte Anschauung eines kulturell als einfacher zu bezeichnenden Naturvolkes in verblüffender Weise uns erst verständlich, denn wir müssen hierin eine volkstümlich gewordene und allgemein verbreitete erbbiologische Erkenntnis als Grundlage dieser Anschauung annehmen. Wir werden wohl fragen: ja, kann denn ein einfaches, jeglicher systematischer und wissenschaftlicher Schulung bares Naturvolk überhaupt solch weitgehende erbbiologisdie Erkenntnisse, die wir selbst in europid-amerikanischen Fachkreisen bisher nicht anzutreffen vermochten, aus eigener Kraft erwerben und folgerichtig in ihre Ideenwelt einbauen? Es ist naheliegend, jede derartige Schlußfolgerung entweder als phantastische Behauptung gänzlich zu verwerfen oder aber für eine solche auch eine Beweismög-lidikeit zu suchen. Einen diesbezüglichen Vensaich will ich nun im nachfolgenden anführen.
Aus einer Schnür wird durch Knüpfen eine Schleife gebildet, die man bei ausgestreckten Annen über die beiden Hände schiebt. Mit je vier Fingern wird nun eine Schlinge gebildet und zur gegenüberliegenden Hand gezogen. Der Spielpartner bemüht sich nun, das entstandene Gebilde abzunehmen, indem er mit seinen Fingern dasselbe durch Verdrehungen abgewandelt auf seine beiden ausgestreckten Arme übernimmt. In dieser Form treffen wir das Spiel heute noch manchmal bei unseren Kindern an. Jedenfalls war es aber für unsere Ahnen ein beliebter Zeitvertreib gewesen. Sie ordneten jeder erhaltenen Figur irgendeine Bezeichnung, so zum Beispiel der „Korb“ oder der „Krebs“ oder die „Spinne“ usw. zu. Diese sogenannten „Fadenspiele“ sind Gemeingut aller Völker der Erde und sie erreiditen in der Südsee einen besonders hohen Grad von Vollkommenheit, das heißt sowohl an Mannigfaltigkeit als auch an Formvollendung werden sie kaum in einem anderen Gebiete übertroffen. Bei allen Naturvölkernxist es üblich, jede Beobachtung in irgendeiner Art und Weise dem eigenen Gedankenkreis einzuverleiben und auszudeuten. Daher hat man auch bei den Fadenspielen nicht nur allein den entstandenen Figuren erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet, sondern man schenkte auch den die Figuren formenden Händen eine größere Beachtung. Da der Naturmensch ein schärferer Beobachter ist als wir mit unserem abstrakt wohl tiefer schürfenden Denken, doch der geminderten Beobachtungsgabe, so wird es verständlich, daß den Papuas auch die Feinheiten der Hautleistenmuster an den Händen aufgefallen sein müssen. In unserem Lebensraum fehlt einerseits die Muße zu derartigen Beobachtungen und andererseits besteht keinerlei praktische Notwendigkeit für solche Studien. Wurde nun einmal der Formiunterschied in den Hautleistenmustern erkannt, so folgten wohl Vergleiche derselben. Diese aber mußten zu der Erkenntnis führen, daß derartige Muster in bestimmten Ausbildungen im Kreise sich blutartlich näherstehenden Personen öfters wiederholen als zwischen sich fernestehenden Individuen. Dadurch war aber die Möglichkeit der intuitiven Erfassung bestimmter Erbvorgänge geboten, wenngleich diese Erkenntnis keineswegs in irgendeine starre, abstrakt festgehaltene Formel eingezwängt wurde.
Wir dürfen also annehmen, daß die Papuas auf Grund von Beobachtungen zu ihrer Schlußfolgerung gelangt sind, daß zwischen den Angehörigen einer Sippe und daher den Mitgliedern einer der bestehenden Heiratsklasse und den Haudeistenmustern an den Händen irgendeine ursächliche Bindung bestehen muß. Diese Erkenntnis lebt nun heute noch in den Stammestraditionen unverändert fort, wenngleich für dieselben keine direkte Erklärung mehr gegeben werden kann. Es hat also eine objektive Tatsachenfeststellung an Hand eines vorliegenden Originalmaterials uns gezeigt, daß selbst das soziologisch-anthropologische Rätsel der Südsee seine Lösung finden kann.
Der Verteilung nach sind der Muttertypen auf den Fingerbeeren dieser 63 Gunantuna zu 3,4 Prozent Bogen, 3,7 Prozent radiale und 62,6 Prozent ulnare Schleifen sowie 30,3 Prozent Wirbel. Diese Verteilung steht jener der Negritos Afrikas sehr nahe. Denn es haben die Negritos relativ zahlreiche (von 3 bis 18 Prozent) Bogen und wenige (von 15 bis 34 Prozent) Wirbelmuster, dagegen nimmt bei den Mongoliden die Zahl der Bogen (von 0 bis 7 Prozent) ab und jene der Wirbelmuster (von 33 bis 81 Prozent) zu. Die Europiden nehmen eine vermittelnde Stellung zwischen diesen beiden Großrassen-kreisen ein. — Zwischen den der obgenannten Sippe „To-Palaram“ angehörigen in Paparatava lebenden Gunantuna und anderen sippenfremden Gunantuna besteht in der Häufigkeit der Mustertypen kein nennenswerter Unterschied. Auffallend ist jedoch die Tatsache, daß von den der Sippe „To-Palaram“ angehörigen Paparatavaleuten 29 Prozent an beiden Händen die gleichen Musterfolgen auf den Fingerbeeren zeigen, dagegen ist bei 43 Prozent der übrigen Gunantuna eine gleiche Musterfolge festzustellen. Andererseits haben jedoch 39 Prozent der sippen-angehörigen Paparatavaleute radialwärts gerichtet Schleifen und bloß 25 Prozent der sippenfremden Gunantuna zeigen dieses immerhin seltenere Merkmal am zweiten oder dritten Finger. Außer den Mustern auf den Fingerbeeren treten aber auch auf der inneren Handfläche verschiedene Musterbildungen im Verlaufe der Hautleisten auf. Vor allem sind es der Daumen- und der Gegendaumeniballen, das sind der Thenar und Hypothenar, welche Träger von Haut-leästenmuister sind. Von den Angehörigen der obengenannten Sippe sind nun 39 Prozent und von den Sippenfremden jedoch 87,5 Prozent Träger derartiger Muster. Fassen wir diese objektiven Tatsachenfeststellungen zusammen, so ergibt sich, daß gleiche Musterfolgen auf den Fingerbeeren beider Hände sowie Muster auf Thenar und Hypothenar bei den „To-Palaram“ Gunantuna bedeutend seltener sind als bei sippenfernen Gunantuna, dagegen haben die letzteren seltener radiale Schleifen als die ersteren. Es besteht daher in diesen Haut-leistenmustern tatsächlich eine auffallende Verschiedenheit zwischen den Angehörigen einer bestimmten Sippe und den außerhalb dieser Sippe stehenden Gunantuna.
Der allgemeinen Anschauung dieses Papuastammes zufolge sollen sich die Angehörigen der beiden Heiratsklassen auch in den Handlinien — richtiger wohl in den Hautleistenmustern an der inneren Handfläche und auf den Fingerbeeren — unterscheiden. Da nun Angehörige einer Sippe auf Grund der bestehenden Heiratsordnung stets einer und derselben Heiratsklasse angehören und daher erbmäßig an den Sippenältesten gebunden sind, so werden bei diesen bestimmte Erbmerkmale häufiger anzutreffen sein als bei sippenfremden Stammesangehörigen. Es ist daher auf Grund obiger Feststellungen naheliegend, die Schlußfolgerung zu ziehen, daß tatsächlich die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Heiratsklasse von auffallenden Unterschieden in den Musterbildungen des Hautleistensystems begleitet erscheint. Dadurch wird aber die rätselhafte Anschauung eines kulturell als einfacher zu bezeichnenden Naturvolkes in verblüffender Weise uns erst verständlich, denn wir müssen hierin eine volkstümlich gewordene und allgemein verbreitete erbbiologische Erkenntnis als Grundlage dieser Anschauung annehmen. Wir werden wohl fragen: ja, kann denn ein einfaches, jeglicher systematischer und wissenschaftlicher Schulung bares Naturvolk überhaupt solch weitgehende erbbiologisdie Erkenntnisse, die wir selbst in europid-amerikanischen Fachkreisen bisher nicht anzutreffen vermochten, aus eigener Kraft erwerben und folgerichtig in ihre Ideenwelt einbauen? Es ist naheliegend, jede derartige Schlußfolgerung entweder als phantastische Behauptung gänzlich zu verwerfen oder aber für eine solche auch eine Beweismög-lidikeit zu suchen. Einen diesbezüglichen Vensaich will ich nun im nachfolgenden anführen.
Aus einer Schnür wird durch Knüpfen eine Schleife gebildet, die man bei ausgestreckten Annen über die beiden Hände schiebt. Mit je vier Fingern wird nun eine Schlinge gebildet und zur gegenüberliegenden Hand gezogen. Der Spielpartner bemüht sich nun, das entstandene Gebilde abzunehmen, indem er mit seinen Fingern dasselbe durch Verdrehungen abgewandelt auf seine beiden ausgestreckten Arme übernimmt. In dieser Form treffen wir das Spiel heute noch manchmal bei unseren Kindern an. Jedenfalls war es aber für unsere Ahnen ein beliebter Zeitvertreib gewesen. Sie ordneten jeder erhaltenen Figur irgendeine Bezeichnung, so zum Beispiel der „Korb“ oder der „Krebs“ oder die „Spinne“ usw. zu. Diese sogenannten „Fadenspiele“ sind Gemeingut aller Völker der Erde und sie erreiditen in der Südsee einen besonders hohen Grad von Vollkommenheit, das heißt sowohl an Mannigfaltigkeit als auch an Formvollendung werden sie kaum in einem anderen Gebiete übertroffen. Bei allen Naturvölkernxist es üblich, jede Beobachtung in irgendeiner Art und Weise dem eigenen Gedankenkreis einzuverleiben und auszudeuten. Daher hat man auch bei den Fadenspielen nicht nur allein den entstandenen Figuren erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet, sondern man schenkte auch den die Figuren formenden Händen eine größere Beachtung. Da der Naturmensch ein schärferer Beobachter ist als wir mit unserem abstrakt wohl tiefer schürfenden Denken, doch der geminderten Beobachtungsgabe, so wird es verständlich, daß den Papuas auch die Feinheiten der Hautleistenmuster an den Händen aufgefallen sein müssen. In unserem Lebensraum fehlt einerseits die Muße zu derartigen Beobachtungen und andererseits besteht keinerlei praktische Notwendigkeit für solche Studien. Wurde nun einmal der Formiunterschied in den Hautleistenmustern erkannt, so folgten wohl Vergleiche derselben. Diese aber mußten zu der Erkenntnis führen, daß derartige Muster in bestimmten Ausbildungen im Kreise sich blutartlich näherstehenden Personen öfters wiederholen als zwischen sich fernestehenden Individuen. Dadurch war aber die Möglichkeit der intuitiven Erfassung bestimmter Erbvorgänge geboten, wenngleich diese Erkenntnis keineswegs in irgendeine starre, abstrakt festgehaltene Formel eingezwängt wurde.
Wir dürfen also annehmen, daß die Papuas auf Grund von Beobachtungen zu ihrer Schlußfolgerung gelangt sind, daß zwischen den Angehörigen einer Sippe und daher den Mitgliedern einer der bestehenden Heiratsklasse und den Haudeistenmustern an den Händen irgendeine ursächliche Bindung bestehen muß. Diese Erkenntnis lebt nun heute noch in den Stammestraditionen unverändert fort, wenngleich für dieselben keine direkte Erklärung mehr gegeben werden kann. Es hat also eine objektive Tatsachenfeststellung an Hand eines vorliegenden Originalmaterials uns gezeigt, daß selbst das soziologisch-anthropologische Rätsel der Südsee seine Lösung finden kann.