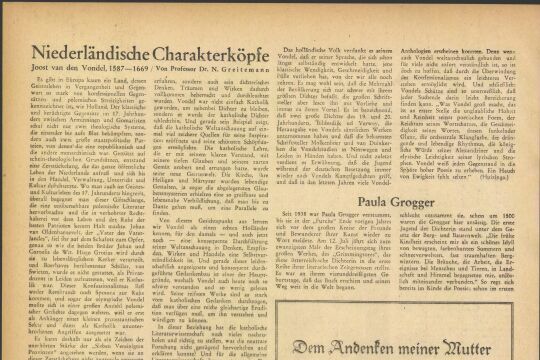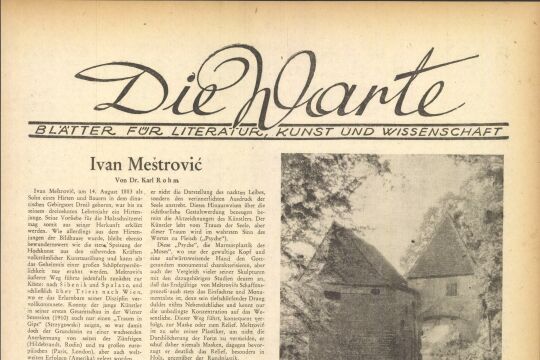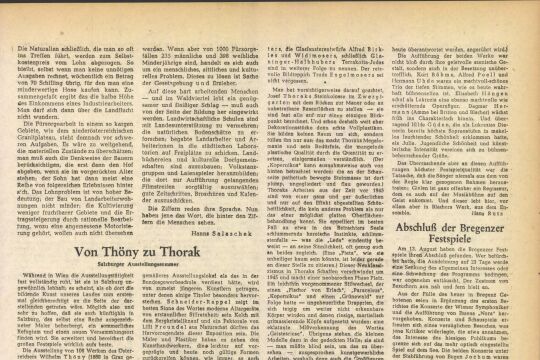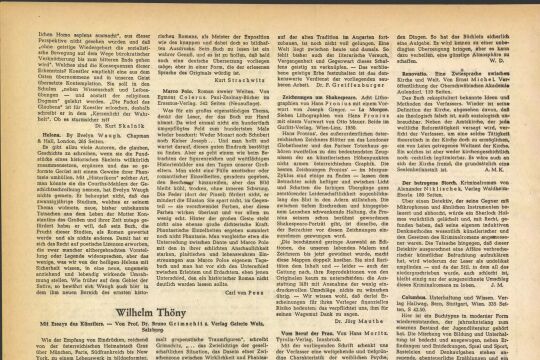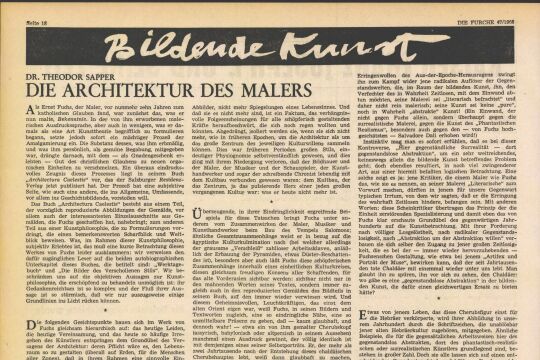Es sieht so aus als lebten wir im Zeitalter der vom j Himmel gefallenen Meister. Es soll in früheren Zeiten ein Sprichwort gegeben haben, demzufolge kein Meister gelernt vom Himmel fällt, doch scheint dies für das 20. Jahrhundert keine Gültigkeit mehr zu haben — vor allem, was die Malerei betrifft. In der modernen Kunst ist es nämlich in zunehmender Weise üblich geworden, Bilder als „Erfindungen“ zu präsentieren, und der Künstler ist in immer minderer Weise damit befaßt, seine „Erfindung“ auf der Leinwand in einer dauerhaften Weise zu fixieren. So ist es meist in den folgenden Jahren nach der „Erfindung“ eines Bildes ein Restaurator, der unter Zuhilfenahme seines Laboratoriums das Bild malt, das heißt die Ruine eines Bildes mit allen möglichen Hilfsmitteln so konserviert, daß wenigstens die teilweise Erhaltung derselben gewährleistet werden kann. Es soll Zeiten gegeben haben, wo ein Großteil der Maler dieses Geschäft (des technisch-fundierten Handwerks) mit dem des künstlerischen Aktes, also der obenerwähnten Erfindung, verbanden. Nur so kann es dazugekommen sein, daß wir einen Großteil der erhaltenen Bilder aus den Jahrhunderten von der Gotik bis zum Anfang des Biedermeier durchweg in gutem Zustand vorfinden, ohne daß ein Restaurator kurz nach ihrer Entstehung sie behandeln mußte. Manche dieser Bilder sind bis auf unsere Tage völlig unverändert erhalten geblieben.
•
Mit dem Aufkommen der Industrie, die das Handwerk nach und nach verdrängte, kamen auch zu Anfang des 19. Jahrhunderts Farbfabrikanten dem Künstler mit vorfabrizierter Farbe „zu Hilfe“, um diesen, der inzwischen dem Werkstattbetrieb entwachsen war und seither noch größerer „Spontaneität“ nachjagte, mit schon in Tuben gefüllter fertiger Farbe zu beliefern. Die Künstler dieser Zeit fragten nicht viel nach der Qualität dieser Produkte und verwendeten fraglos alles, was so auf den Markt kam. Auch neue, bis dahin in der Malerei nie verwendete Mittel kamen so in Anwendung, zum Beispiel verschiedene Teerfarben, vor allem die damals sehr beliebte Asphalt-Lasur. Ist es einerseits wahr, daß etwa um die Zeit der beginnenden Plein-Air-Malerei Delacroix oder Courbet etwa mit besonderem Verve malen und eine Spontaneität der Pinselführung an den Tag legen, die vom Gros der damaligen eher faden Akade-misten absticht, so ist anderseits eklatant, daß diese Bilder in den hundert Jahren ihres Bestehens alles das eingebüßt haben, was man ihnen zur Zeit ihrer Entstehung nachrühmte: ihre ehemals leuchtende Farbigkeit ist verblaßt oder zur Unkenntlichkeit nachgedunkelt (durch die Verwendung neuartiger Sikkative, die ein rasches Trocknen der Farbe bewirken und so ein schnelles Ubermalen gestatten). Zentimeterbreite Risse durchziehen die Malschicht, die fast Inseln bildend zusammenschrumpft, wie die mumifizierte Haut eines Elefanten. Diese Bilder sind zweifellos Ruinen geworden und kein Restaurator der Welt kann ihnen zu jenem Glanz und jener Frische verhelfen, die ihr Schöpfer ganz gewiß in sie gelegt hat. Erleben wir dies in einem Museum, so haben wir meist Gelegenheit, nach Gemälden des 19. Jahrhunderts denen des 17., 16. und 15. Jahrhunderts zu begegnen, und wir stehen verblüfft vor dem Phänomen, daß die Bilder dieser Epochen alle diese Mängel nicht aufweisen. Fast ausnahmslos finden wir die Bilder der Gotik, der Renaissance und des Barocks in einer ungebrochenen Leuchtkraft, und außer jener wohltuenden Patina, die jeden antiken Kunstgegenstand ziert, haben sie keine Spur einer Verwesung an sich. Gewiß war Francesco Guardi ein kühner spontaner Meister des Pinsels, geübt in allen Disziplinen der Freilichtmalerei und deren Virtuosität, die selbst von einem Manet nicht übertroffen wurde (oder denken wir an Goyas kühne Pinselführung); auch hier kann jeder Vergleich mit dem Anfang der sogenannten Moderne angestellt werden — und doch finden wir die Bilder dieses Meisters und seiner Zeitgenossen von der Malerei des 19. Jahrhunderts, vor allem was ihre Konservierung betrifft, vorteilhaft unterschieden.
•
Mit dem Ausklingen des Barocks verschwindet auch die letzte Kultur des Werkstattbetriebes aus der Malerei. Wir befinden uns ja im turbulenten Zeitalter der Revolution des über sich selbst bestimmenden Bürgers und sehen plötzlich den Künstler auf sich allein gestellt, einen Käufer suchend, der nicht mit einem Auftraggeber zu verwechseln ist. Ungefähr um diese Zeit werden Bilder auf den „Markt“ gebracht, und das fast ausschließlich von Künstlern, die in niemandes Auftrag das gemalt haben, was ihnen gefiel. Um diese Situation richtig zu verstehen und zu bewerten, muß man sich vor Augen halten, daß Jahrtausende hindurch als Künstler oder Meister nur der angesprochen wurde, der lange eines Meisters Schüler war und durch eine richtige Lehrzeit in die Zunft der Meister aufgenommen wurde. Die Kunst des Malens war in diesen Zeiten an einen sehr hohen Grad diffizilen Handwerks gebunden und das Tradieren uralten Erfahrungsgutes Gegenstand des Unterrichts. Man war stolz, Schüler eines bestimmten Meisters zu sein oder gewesen zu sein. Das Auftauchen eines weitgehend autonomen, also im wahrsten Sinne autodidakten Künstlers, ist als ausgesprochenes Novum zu verstehen, das in zunehmender Weise den Kunstbetrachter zu überfordern begann.
•
Sicher gab es Bildermärkte schon im 16. und 17. Jahrhundert, wie etwa den Markt des Genrebildes in Belgien und Holland. Trotzdem war das Bündnis zwischen Auftraggeber und Meister beherrschend. Ja, wir können sogar sagen, daß der Auftraggeber, sehen wir ihn nun in der Person des Papstes, des Regenten oder Adeligen, fast immer beteiligt war an der Bildung des Stils, des Niveaus, der Kunstfertigkeit und des Geschmacks seiner Zeit schlechthin. Sicher hat es keinen Sinn, diesen Epochen nachzutrauern und das vielzitierte Rad er Geschichte zurückdrehen zu wollen — und doch sind die Versuche solcher Umkehr seit dem Anfang des vorigen Jahrhunderts zahlreich. Denken wir an William Blake, an William Morris und seine Marshall-Faulkner-and-Company-Bewegung, mit der er versuchte, Kunst und Kunsthandwerk wieder auf solider Grundlage zu erneuern.
Auch seine Vorbilder waren in dieser Bestrebung die alten Meister. Nur in einem tiefen Rückblick auf die Erkenntnisse dieser Vorfahren hoffte er, eine Erneuerung der Kunst herbeiführen zu können. Und so wie sein Versuch eine Art Rückläufigkeit des Rads der Geschichte bedeutet, ist der Sinn anderer Bewegungen, die seither die Künstler im Verlangen nach Erneuerung erfaßt haben, ein gleichartiger Versuch des Zurückgreifens auf die Traditionen hochentwickelten Handwerks, deren Überlieferung, wie oben schon erwähnt, unterbrochen war. Ist solch retrospektive Gesinnung wirklich ein Novum? Ist das Rad der Geschichte nicht schon einige Male zurückgedreht worden? Just in der Renaissance, wurde da nicht vieles wiedergeboren, was seit den Hellenen und Römern verschollen war? Ist nicht das Inpasto der Mumienbildnisse aus Fayum (ohne Risse und craquele, seit dem Anfang unserer Zeitrechnung!) eine Wachsölmalerei, wiederentdeckt in der Ölmalerei der Renaissance? Die Verwendung der Perspektive nicht schon in den pompejanischen Wandmalereien zu finden? Kurz: ist die Epoche der Renaissance nicht auch die der Wiederentdeckung und Wiederfindung vieler antiker Ausdrucksmittel und Techniken? Und trotzdem galt diese Epoche als revolutionär, also das Zurückdrehen, wenn man so sagen darf, jenes sprichwörtlichen Rades der Geschichte, ist nicht unbedingt mit einem „Zurück“ im schlechten Sinne des Wortes identisch. Ist es undenkbar, daß es den Künstler heute sehr wohl zu interessieren beginnt, ob seine Werke künftige Zeiten erreichen werden — und daß er das in seiner Macht Stehende dazu beitragen will, daß sie dies tun? Ich würde sagen, daß eine solche Reaktion auf die um diese Belange unbekümmerte Haltung der Generationen seit Delacroix, allzu natürlich wäre, und viele Anzeichen einer solchen Reaktion sind vorhanden.
Seit dem Erscheinen des Buches von Max Doerner „Malmaterial und seine Verwendung im Bilde“ im Jahre 1921 hat es immer wieder Maler gegeben, die in gleicher Weise wie Doerner und unter Zuhilfenahme der Ergebnisse seiner Forschung, sich um die Rekonstruktion einer Malkultur bemüht haben, die der der alten Meister wieder ähnlich werde. Doerner hatte zusammen mit anderen Kollegen versucht, den Fehlerquellen der modernen Maltechnik auf wissenschaftlich-chemisch-analytischer Basis und durch zahlreiche Experimente auf diesem Gebiete beizukommen. Sicher war dies nur ein Anfang, der von etlichen Künstlern aufgegriffen und weitergeführt wurde, und im allgemeinen ist ein Zunehmen des Interesses der Künstler für diesen Bereich festzustellen. Das hat natürlich auch seine geistigen Wurzeln in einer Abwendung von der Uberbetonung der Skizze und jener sprichwörtlich gewordenen Spontaneität. Die exzessive Aufwertung der Momentmalerei im Tachismus und der „peinture de geste“ hat endlich zu einer Übersättigung des Bedürfnisses nach Vehemenz und Spontaneität geführt. Wenngleich der junge Künstler im allgemeinen noch immer versucht ist, mit der Imitation des Altersstils eines Meisters seine Laufbahn zu beginnen, also mit dem Vorbild des Spätwerks etwa eines El Greco, Tintoretto, Van Gogh oder Corinth, so ist man auf maßgebenden Kunstschulen in zunehmendem Maße bemüht, an den Anfang der Laufbahn eines jungen Malers oder Bildhauers das simple Naturstudium zu stellen, und das ohne Seitenblick auf Cezanne, beziehungsweise ohne das allzu schwierige Abstrahieren, das selbstverständlich voraussetzt, daß „alles“ am Modell schon beobachtet und gezeichnet wurde. Es ist doch kein Zufall, daß eben der beliebte Spätstil der obenerwähnten und anderer heute vielbewunderter Maler, der sogenannten Väter der modernen Kunst, zustandekam, nachdem sie unzählige penible und vielfach auch uninteressante „naturalistische Naturstudien“ gemacht haben. Denken wir etwa an Klimt, von dem es hunderte „akademische“ Aktzeichnungen gibt, die nicht zu verwechseln sind mit jenen aberhundert freien, flüssigen Aktzeichnungen, von denen jeder Schatten von Schweiß und Mühe, der gewiß auf jenen früheren Zeichnungen lastet, gewichen ist; die frei, wie eine Offenbarung in der Kunst, in einer neuen Handschrift die Schönheit des menschlichen Körpers erzählen.
•
TV7ir sehen also, daß eine Verflachung der künstlerischen Intentionen im großen und ganzen zusammenhängt mit einem Verfall der maltechnischen Gediegenheit der Bilder. Von den bekanntesten Malern unserer Zeit hat sich nur Salvadore Dali mit Materialfragen beschäftigt. Er hat es der Mühe wert gefunden, ein Buch und einige Traktate über Maltechnik zu verfassen. Im Zusammenhang mit der Untaug-lichkeit der technischen Mittel der postimpressionistischen Malerei für die von ihm angestrebte Akribie, und der einem Großteil der Surrealisten eigenen, genauen, miniaturhaften Pinselführung, hat er die alte Primamalerei oder „Fa'-presto“-Malerei so wiederbelebt, daß ihre unveränderte Haltbarkeit garantiert werden kann. Vor allem haben sich seine Bemühungen darauf konzentriert, ein Malmittel zu finden (Bernstein-Lacköl-Verbindungen), das den dickeren Auftrag der Frabe ermöglicht, ohne daß diese während des Trocknens reißt oder, runzelige Haut bildend, schrumpft. Sind die frühen Bilder dieses Malers noch vielfach durchzogen von Sprüngen und anderen Schäden, so zeigen seine Bilder von dem Zeitpunkt an, da er dieses Material zu verwenden beginnt (1940), eine gediegene und brillante Malschicht. Ein halbes Jahrhundert vorher hatte Arnold Böcklin, als er erkannte, daß viele seiner frühen Bilder erheblich nachgedunkelt waren, eine Technik entwickelt, die der des italienischen Quattro Cento ähnlich war. Er begann, seine Farben selbst mit einer Eiemulsion anzureiben und lasierte diese Temperafarbe mit Kirschgummi. Ich hatte Gelegenheit, Bilder, die in dieser Technik gemalt sind (sein Spätwerk), unlängst in München zu betrachten und muß sagen, daß die Frische dieser Werke ganz unvergleichlich von den Gemälden aus den Jahrzehnten vorher absticht. Wobei noch zu sagen wäre, daß selbst die Arbeiten des jungen Böcklin von besonderer technischer Qualität und im allgemeinen viel besser erhalten sind, als die meisten Bilder seiner Zeitgenossen. Er hatte, wie so mancher große Maler, eben eine Ader, ein besonderes Interesse für diese Belange. Und das zum Nutzen der Malkultur im allgemeinen. Gewiß macht die beste Schule, die gründlichste Kenntnis, selbst der Geheimnisse der „alten Meister“ noch lange keinen guten Künstler. Doch hat umgekehrt solches Rüstzeug keinem Künstler je geschadet. Im Gegenteil, es scheint mir kein Zufall zu sein, daß vieles an offensichtlicher Technik, etwa der wachsartige Schmelz des Inpastos Vermeers ein strenggehütetes Geheimnis des Meisters war und dieser sein Geheimnis mit ins Grab nahm, weil man damals diese Qualitäten ganz und gar zur Kunst zählte und keineswegs als Handwerk oder Geschicklichkeit abtat. Manufaktur war nicht ein abfällig bemerktes Kennzeichen von Kunstgewerbe, ebenso war es eine Ehre, Schüler der Werkstatt eines berühmten Meisters und eventueller Erbe seines besonderen technischen Wissens zu sein. So war etwa Leonardo da Vinci stolz, Verroccios Schüler gewesen zu sein, und die Spuren dieser Schülerschaft sind immer sichtbar geblieben, trotz der einzigartig ausgeprägten Individualität Leonardos. Dies tat seinem Ansehen im Kreise der Kunstverständigen keineswegs Abbruch, im Gegenteil!
•
Das galt für die Meister aller Zeiten bis in die jüngste Vergangenheit. Einer baute auf dem anderen auf, stolz auf das übernommene Erbe. Nur heute, oder besser seit einigen Jahrzehnten, gefallen sich die meisten Maler darin, als Meister vom Himmel gefallen zu sein. Tradition, tradieren ist fast zum Schimpfwort geworden, sehr zum Schaden der Malerei, in der wir immer seltener das „Hauptwerk“ finden, auf das hin alle Bemühungen der alten Meister gerichtet war, und in das die Vielzahl der Skizzen und Studien mündeten, als Werk der Zusammenfassung. Darin liegt die Größe der meisten Werke dieser Epochen: sie haben etwas Universelles, etwas Zusammenfassendes und sind „Weltbild“ schlechthin. Heute aber findet der Kunstbetrachter, wo er hinsieht, „spontane“ Skizzen. Es ist dies kein Wunder, wenn man bedenkt, daß selbst die heute allgemein gebräuchlichen Farbstoffe und Malmittel, ein längeres Arbeiten an einem Bild in größerem Format, etwa einer viel-flgurigen Komposition (dies nicht unbedingt im gegenständlichen Sinn des Wortes gemeint), nicht erlauben: sie trocknen zu rasch und machen eine etwa zweiwöchige Arbeitszeit zur Qual. Meist leidet der Maler darunter, daß bei notwendigen Ubermalungen das darunter liegende Relief des vorherigen Auftrags die darüber liegende Malschicht deformiert; es entsteht dadurch meist eine krustige, faltenreiche Oberfläche, die in ihren Poren Staub aufnimmt, der die farbige Wirkung schwer beeinträchtigt. Die industriell hergestellte Farbe wird nämlich noch immer in der Konsistenz und Beschaffenheit erzeugt, wie sie der Impressionist für seine rasche Arbeit „Ton neben Ton“, nicht Schicht über Schicht, wie das heute vielfach geübt wird, benötigt. Die so entstehenden Mängel und zufälligen, unabsichtlichen Fehler werden nur zu oft als Absicht des Künstlers interpretiert, sind aber bestenfalls die sprichwörtliche Tugend aus Not. — Doch diese Bilder tragen ihre baldige Verwesung in sich. Es wäre also nötig, daß der Maler im allgemeinen wieder beginnt, seine Farbe selbst herzustellen und, auf der Erfahrung vorangegangener Meister aufbauend, seine ihm gemäße Technik erarbeitet. Nur so kann er der Verwirklichung seiner Ideen dienen. Dadurch könnte dem gewiß rühmlichen Inventionismus und der Experimentierfreudigkeit in formalen Belangen der modernen Kunst eine wichtige Adäquation zuteil werden.