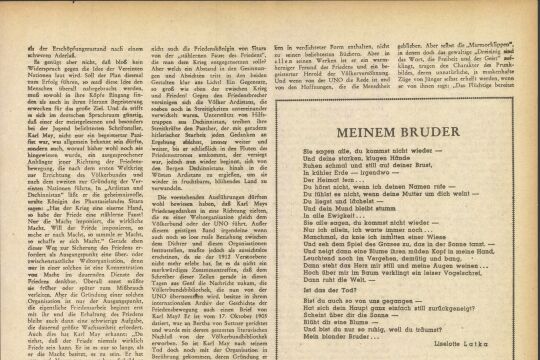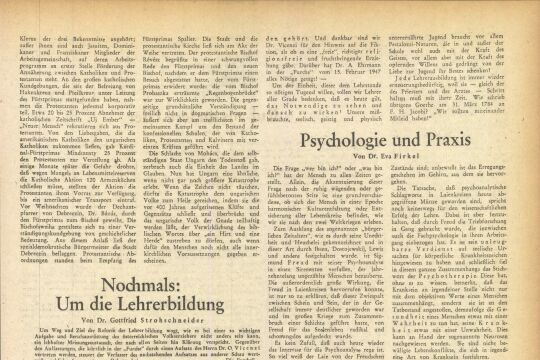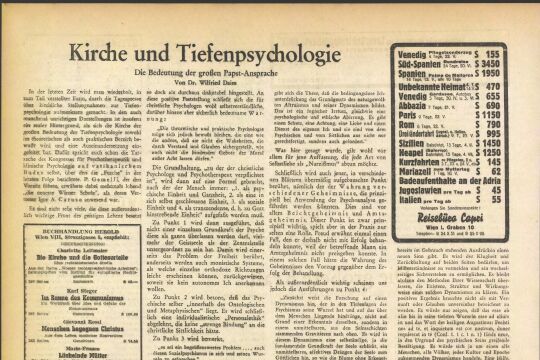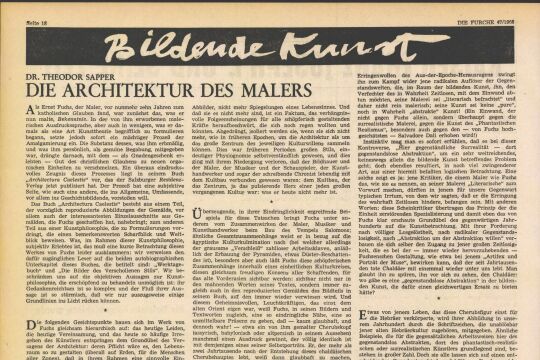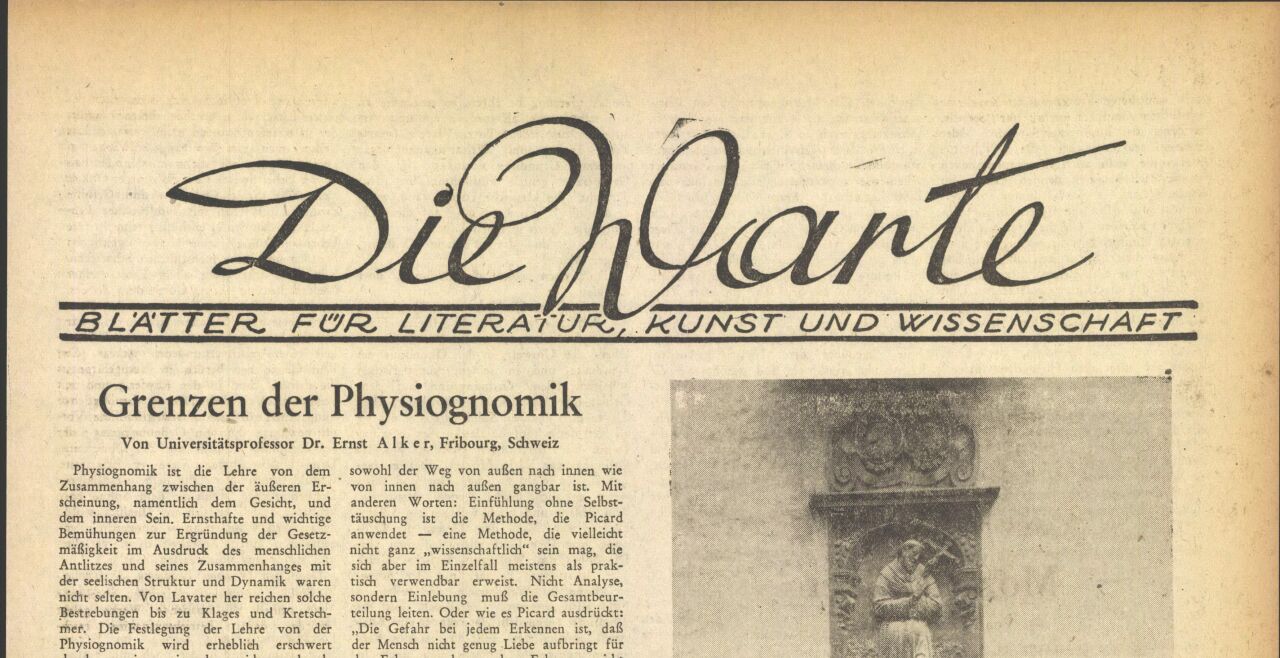
Physiognomik ist die Lehre von dem Zusammenhang zwischen der äußeren Erscheinung, namentlich dem Gesicht, und dem inneren Sein. Ernsthafte und wichtige Bemühungen zur Ergründung der Gesetzmäßigkeit im Ausdruck des menschlichen Antlitzes und seines Zusammenhanges mit der seelischen Struktur und Dynamik waren nicht selten. Von Lavater her reidien solche Bestrebungen bis zu Klages und Kretschmer. Die Festlegung der Lehre von der Physiognomik wird erheblich erschwert durch gewisse einander widersprechende Überschneidungen der einzelnen Systeme. Lavaters größtenteils aus uralter Erfahrung schöpfenden Anschauungen stimmen keineswegs überein mit den grundsätzlichen Erkenntnissen, die Kretschmer aus seinen Konstitutionstypen holt. Klages' antiintel-lektualistische Tiefenseelenschau gerät in Widerstreit mit der rassenkundlichen Physiognomik. Die Dinge liegen vielfach so, daß jede Lehre fast die Aufhebung der anderen darstellt. Dennoch ist an sich keine Lehre unrichtig. Die tiefste Ursache dieser scheinbaren Verwirrung liegt darin, daß einerseits das Gebiet der Physiognomik nicht total erfaßt wird, andererseits ihre Grenzen wesentlich überschritten werden. Die Un-einheitlichkeit der Deutungen hat das Ansehen der Physiognomik vermindert. Lavater erklärt zum Beispiel eine fliehende Stirn als Zeichen einer gewissen moralischen und •geistige Minderwertigkeit. Bei der dinari-schen Rasse aber ist die fliehende Stirn eine ausgesprochene und unverlierbare Rasseneigentümlichkeit und daher keineswegs im Sinne der Lavaterschen Ideologie auslegbar. Rundköpfe der pyknischen Konstitutionstypen, wie sie Kretschmer konstruierte, stehen nicht im Einklang mit den Wertungen der Rassenkunde, die von anderen Gesichtspunkten ausgeht. Widersprüche solcher Art könnten zu Dutzenden angeführt werden. Die Widersprüche aber fallen vielfach weg, wenn man bedenkt„ daß die verschiedenen physio?nomischen Lehren nicht auf den gleichen Ebenen errichtet sind.
Daran scheitert auch vielfach die praktische Auswertung der Physiognomik. Man zieht einseitige und infolgedessen meistens unrichtige Rückschlüsse von dem Gesichts-ausdruck auf das Seelische oder man will gewaltsam angenommene seelische Eigenschaften im Spiegel des Antlitzes wiederfinden.
Max Picard, der durch seine tiefgründigen und sehr durchdachten Bücher „Das Menschengesicht“ und „Hitler in uns selbst“ rühmlich bekanntgeworden ist, macht in einem vor dem Krieg erschienenen Werk „Die Grenzen der Physiognomik“ (E. Rentsch, Erlen-bach-Zürich und Leipzig) den Versuch, die Aufgabe auf das wirklich Erkennbare zu beschränken. Er zeigt, was alles von einem Gesicht abzulesen ist, aber er zeigt auch, daß ein Antlitz keineswegs identisch sein muß mit den Eigenschaften eine's Menschen. Ein Gesicht kann zum Beispiel als Maske über das Innere gelagert sein und umgekehrt kann die Kraft des Inneren ein ursprünglich maskenhaftes Antlitz so gewandelt haben, daß es zum wahren Spiegel wird. Besonders wichtig ist Picards Einsicht, daß ein Mensch mehr zu werden vermag als sein Gesicht. Diese Einstellung dem Problemkomplex gegenüber bedeutet, daß Picard bewußt auf die Aufstellung allgemeingültiger logischer Kategorien verzichtet, deren Konstruktion bei anderen Forschern Ziel und Sinn wird. ' Picard hat begriffen, daß die unendliche Fülle der in Betracht kommenden Erscheinungen mit den gegenwärtigen Mitteln noch nicht zu einer gesetzgebundenen Ordnung vereinfacht werden kann, sondern daß man sich damit begnügen muß, das einzelne Gesicht auf eine intuitive Weise zu deuten, wobei sowohl der Weg von außen nadi innen wie von innen nach außen gangbar ist. Mit anderen Worten: Einfühlung ohne Selbsttäuschung ist die Methode, die Picard anwendet — eine Methode, die vielleicht nicht ganz „wissenschaftlich“ sein mag, die sich aber im Einzelfall meistens als praktisch verwendbar erweist. Nicht Analyse, sondern Einlebung muß die Gesamtbeurteilung leiten. Oder wie es Picard ausdrückt: „Die Gefahr bei jedem Erkennen ist, daß der Mensch nicht genug Liebe aufbringt für das Erkannte, das er dem Erkennen nicht nachkommt mit der Liebe. Nur bei Gott ist Erkennen und Liebe eins. Der Akt des Erkennens wurde beim Menschen ausgezeichnet dadurch, daß auch bei ihm Erkennen und Liebe zueinander gehören dürfen.“
Zu deri besonderen Vorzügen des Picard-schen Buches gehört, daß er seine Rückschlüsse bloß vorsiditig zieht, diese aber folgerichtig durchführt. Weiter, daß er als Unterlage für seine Betrachtungen nicht etwa das stets etwas zufällige und daher keineswegs immer in höherem Sinn wahrhafte Material benutzt, das Lichtbilder bieten, sondern Kunstwerke. In ihrem Wesen liegt es ja, daß hier über die stoffgebundene und daher letzthin unwesentliche äußere Erscheinung hinaus diese gleidie äußere Erscheinung als Träger eines Seelischen, dessen Wesen irgendwie im Exterieur durchschlägt, dargestellt wird. Picards Bilddeutungen sind in den meisten Fällen schledit-hin überzeugend. Sie zeigen dem Leser an dreißig Tafeln, was alles aus einem Porträt herauszuholen ist, und sie warnen vor jenen billigen Rückschlüssen, zu denen besondere Eigentümlichkeiten mancher markanten Gesichtsbildung verleiten. Der stärkste Gewinn, den da$ Buch vermittelt, besteht darin, daß man nicht nur gelernt hat diese dreißig Bildtafeln zu deuten, sondern daß man eine Übung durchgemacht hat, selbständig physiognomische Erkenntnisse aus neuem Material zu schöpfen. (Es ist selbstverständlich, daß dies nicht ohne einen a priori vorhandenen psychologischen Blick möglich ist.) Picards Sprache wird von einem feierlich-dichterischen Schwung geträgen, die auf kleinstem Raum sehr viel sagt und das Buch an sich zu einem ästhetischen Erlebnis macht.
Die tiefe, vielleicht leidenschaftliche Religiosität, die Picard erfüllt, macht ihn zu einem zornigen Streiter gegen jedweden Materialismus. So kommt es, daß manche seiner Formulierungen eine fast Kierke-gaardsche Schärfe gewinnen — meiner Meinung nach zum Vorteil des Buches. Es hebt sich gleichsam ein Vorhang, wenn man zum Beispiel einen Passus liest wie folgenden: „Ein .. . Mensch, dessen Gesicht im Formal-Bildhaften verfangen ist, verfällt leicht dem Sexuellen . .. Das Rechtmäßig-
Allgemeine, das Sexuelle, wird korrumpiert durch das Unrechtmäßig-Allgemeine, durch das nur Formal-Bildhafte, und darum sind viele Menschen mit solchen Gesichtern (Ästhetengesichter!) pervers.“ Selten wurde auch je das Negative der Psychoanalyse so treffend umschrieben wie mit den Worten, daß sie „die Dämonen triumphierend aus den Abgründen des Menschen hervorholt und den Menschen zur Bedienung des Dämons degradiert...“ Daran anschließend wird sehr richtig gesagt: „Die Psychoanalyse liefert überhaupt die Erde oben dem Dämon aus, indem der Mensch von unten, von den Löchern der Erde her, hinaufhorcht, was der Dämon oben treibt.“ Picards heiliger Zorn geht allerdings gelegentlich zu weit, so etwa an jener Stelle,wo er gegen eine Persönlichkeit polemisiert, die er den Musiker X nennt. Diese Per-sönlidikeit sieht äußerlich Goethe sehr ähnlich — ist aber nach Picards Meinung bloß eine maskenhafte Parodierung des Dichters. „Denn das Gesicht war zerstört: an der Stelle, wo bei der Erscheinung (in der Ferne) die Stirne hoch gewölbt gewesen war, da stand jetzt zwar noch etwas wies eine Wölbung, . aber sie war wie aus Blech, sie war wie die Blechwand einer entleerten Büchse; von den weit geöffneten Türen der Augen waren nur nodi zwei Schlitze übriggeblieben, aus denen heraus nichts mehr angesehen, von denen her nur noch “-etwas angestreift werden konnte, und dieses Anstreifen war wie eine Verletzung ...“ Diese Polemik steht wenig' in Einklang mit einer grundsätzlidien Ansicht, die Picard zu Beginn seines“ Buches ausgesprochen hat: „Man darf einen Menschen nur erkennen, wenn der Erkennende die Liebe für den Erkannten bereit hat.“
Der Widerspruch ist sehr belehrend, denn er zeigt, vo die Grenzen einer nur von Liebe getragenen Erkenntnis liegen, dort, wo der Haß anfängt, der ja auch seine besondere Art - von Scharfsichtigkeit hat. Von dieser Sicht aus ist die Antithese zwischen Grundsatz und Ausführung nicht unbegreiflich. Picards eigentliche Stärke ist ja überhaupt weniger die Systemisierung irgendwelcher physiognomischen Einsidnen, sondern die Intensität der einzelnen physiognomischen Einsicht. Daher sind fast alle seine Bilddeutungen kaum widerlegbar, manche aber so zutreffend, man möchte fast sagen genial, daß sie zu unvergänglichen Erlebnissen werden. So etwa jene Stelle, wo in einem einzigen Satz ein Problem gelöst ist, mit dem Scharen von Kunsthistorikern nicht zurecht kamen: „Manche Gesichter auf den Bildern des Hieronymus
Bosch und Peter Brueghel sind so: keine eigentlichen Gesichter mehr, nur Gestelle, auf denen das Böse gezeigt wird.“ Oder diese Charakterisierung der Bildstatue Casars, die man auch ihrer sprachlichen Fassung nach klassisch nennen kann: „Im Gesicht Casars ist die Ordnung so vollkommen, daß selbst die Götter an ihr teilzunehmen sdieinen. Wie die Erde am Horizont den Himmel berührt, so berührt auch der Rand dieser Stirne den Himmel. Das Gesidit ist wie eine Leiter, aufgestellt auf der Erde, daß die Götter herabsteigen. Und sie würden herabsteigen — aber die Götter fliegen: die Götter fliegen über dieses Gesicht, es rauscht auf unter diesem Fluge, die Ordnung des Gesidnes, der Erde, rauscht auf unter dem Fluge der Götter.“
Das ganze Buch wird getragen von einem tiefen christlichen Geist, bei dem nicht zu erkennen ist, ob er irgendwelche konfessionelle Entscheidung getroffen hat. Das abschließende Kapitel „Christus und das Ebenbild“ ist darum die eigentliche Achse des Werkes, um die alle Gedankengänge kreisen. Besonders schön sind Picards Darlegungen über die Unterschiede des Men-chengesichtes vor und nach Christi Ersdieinung. Das Menschengesicht vor Christus wirkt so, als könne das, was sich in ihm zeigt, auch in einer Landschaft oder in einem Baum oder einem Stein oder einem Sternbild erscheinen. Griechische Gesichter sehen wie verwandelter Marmor aus und Blöcke griechischen Marmors wie schlafende Menschen in heller Erde vergraben; die griechischen Götter konnten sich in Tiere und Bäume verwandeln. Der Mensch war nicht gesichert in seine Gestalt eingebettet, er konnte aus ihr herausgerufen werden, ja, er wollte es. Seit Christus aber kann alles, was den Menschen angeht, nur in menschlicher Gestalt geschehen. Die menschliche Gestalt ist sozusagen zu einer Grenzlinie gegenüber dem Nichts geworden. Griechische Gesichter . sind schön wie die Natur, sie sind notwendig schön. Bei christlichen Gesichtern ist die Schönheit entbehrlich, weil sie an das Metaphysische rühren. Aber ist bei ihnen Schönheit vorhanden, dann ist sie ungleich stärker und ursprünglicher als bei griediischen Gesichtern; sie ist nicht das Ergebnis einer allgemeinen Gnade, sondern das Resultat einer für ein Einzelgesidit vorgenommenen Schöpfung.