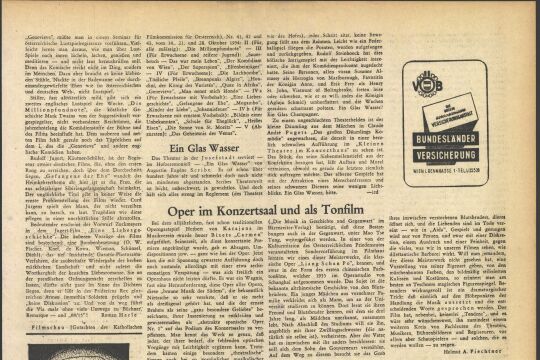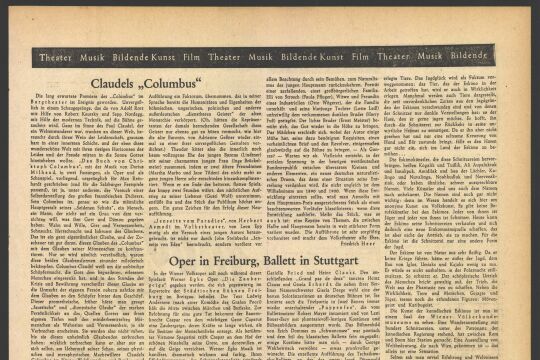Die Berliner Festwochen, mit ihren über 200 Veranstaltungen dem Wiener Juni-Festival vergleichbar, haben auf dem Gebiet der Oper, des Balletts und des Konzerts keinen Leitgedanken, kein bestimmtes Konzept. Aber man sieht und hört hier, Jahr für Jahr, das Ungewöhnliche, das für unsere Zeit Bedeutsame und Interessante. Hierfür hat der Berliner Intendant, Dr. Gerhart von Westerman, der seit neun Jahren das Programm betreut, ein sicheres Gefühl. Freilich wird er bei der Realisierung seiner Absichten, besonders was das Musiktheater betrifft, von einem Mann unterstützt, der einen ebenso soliden wie zeitgemäßen Opernspielplan aufgebaut hat und diesen laufend bereichert: von Intendant Professor Carl Ebert.
Ein Glanzstück seines Spielplanes ist Debussys lyrisches Drama „Pelleas und Meli- sande“, das seit einem Menschenalter im Repertoire der Wiener Staatsoper fehlt und hier zuletzt im Novembier 1946 von einem französischen Ensemble gegeben wurde. Bei aller Traum- haftigkeit und Verhaltenheit des Maeterlinck- schen Textes entbehrt das aus 14 Bildern bestehende Werk in der kongenialen Vertonung Debussys nicht der Spannung und der Wirksamkeit. Zumal man in Berlin gewagt hat, das Werk deutsch zu spielen. Die neue Uebertragung von Dr. Julius Kapp, an welcher der musikalische Leiter der Aufführung in der Städtischen Oper, Richard Kraus, noch einige textliche Retuschen vorgenommen hat, kann als nahezu mustergültig bezeichnet werden. Das gilt auch von der Spielleitung Werner Kelchs, während man Wilhelm Reinkings Bühnenbilder und Kostüme als durchaus akzeptable, wenn auch nicht als einzig denkbare Lösung dieses schwierigen Stilproblems bezeichnen kann. Die Dekorationen sind großräumig — soweit das die Bühne der Berliner Oper gestattet — und ziemlich realistisch. Vielleicht sollte man einmal eine strengere Stilisierung, etwa in sezessio- nistischer Manier und mit kleinerem Bühnenausschnitt, versuchen. — Agiert und gesungen wird großartig. Fast jeder der sieben Hauptrollenträger gehört einer anderen Nation an. Die beiden Titelhelden Hans Wilbrink und Pilar Lorengar sind auch in der Erscheinung ideal. Die anderen Bewohner des traurigen Märchenschlosses von Allemonde inmitten düsterer Wälder sind Peter Roth-Ehrang König Arkel, Nada Puttar Genoveva, Thomas Stewart Golo, Helge Hildebrand Yniold und Leopold Clam Arzt. — Diese Oper ist seit Saisonbeginn im Repertoire, wird gut besucht und erhält starken Beifall. Ein Grund mehr für die Wiener Staatsoper, sich um dieses musikhistorisch wichtige Meisterwerk zu kümmern.
Ein Werk sui generis, wenn auch als Beitrag zum Musiktheater nicht epochemachend, ist Schönbergs nachgelassene Oper „M o s e s und Aron“. Die etwa 1930 begonnene Arbeit blieb unvollendet, d. h. die Musik zum dritten letzten Akt fehlt. Die Leiter der Aufführung, Hermann Scherchen als Dirigent und Gustav Rudolf Seltner als Regisseur, haben das Problem so gelöst, daß sie die Musik der am Beginn stehenden Dornbuschszene der großen Auseinandersetzung zwischen Moses und Aron, mit welcher die Oper schließt, unterlegten. Die erste szenische Aufführung am Zürcher Stadttheater vor zwei Jahren schloß mit dem zweiten Akt und mit Moses’ verzweifeltem Bekenntnis: „So war alles Wahnsinn, was ich gedacht habe? … O Wort, du Wort, das mir fehlt!" Um dieses Wort geht es in Schönbergs religionsphilosophischer Dichtung, die sich auf das dritte und vierte Kapitel des zweiten Buches Moses stützt. Es geht, hier wie dort, um die Erkenntnis des „einzigen, unsichtbaren und unvorstellbaren Gottes“, den Moses seinem Volke nahebringen will. Aber Moses ist des Wortes nicht mächtig, er braucht Aron, um seine Erkenntnis zu verkünden. Und Aron — der Sprecher, Wundertäter, Magier und Volksfreund — verrät den Gedanken, indem er ein greif- und sichtbares Bild.
Gottes errichten läßt, eben das Goldene Kalb, das im Mittelpunkt des orgiastischen zweiten Aktes steht. Ein Stoff und ein Text also, wie er wohl noch nie einer Opernbühne zugemutet wurde. Aber nicht nur deshalb hielt Schönberg sein Werk für unaufführbar, als er 1932 die Partitur unvollendet liegenließ. Sie stellte in ihrer Vielschichtigkeit solche Anforderungen, das ganze Werk erfordert zu seiner Realisierung einen so großen Apparat, daß die Aussichten für eine szenische Aufführung gleich Null waren. Nun hat man, nachdem die Bedeutung dieses Nachlaßwerkes erkannt worden war, sich schrittweise darangemacht, seiner Schwierigkeiten Herr zu werden.
Vor fünf Jahren brachte der Nordwestdeutsche Rundfunk eine vielbeachtete Uraufführung der Partitur, dann folgte Zürich mit den ersten beiden Akten, und nun hat die Städtische Oper Berlin mit Unterstützung der Preußischen Akademie der Künste den Versuch unternommen, „Moses und Aron“ durch sechs Aufführungen für das Repertoire größerer Opernhäuser zu gewinnen. Mit Chören und Sprechchören, Sängern und Sprechern hat Hermann Scherchen die Riesenpartitur nach monatelanger Probenarbeit zum Klingen gebracht. Ganze Partien wurden auf Tonband aufgenommen und so dargeboten beziehungsweise in die „life“-musizier- ten Szenen eingeblendet. Hierdurch wurde eine leichtere Hörbarkeit, eine bessere Transparenz des vielschichtigen Klanges erreicht. Der Picasso-Schüler Michel Raffaeli illustrierte die Dornbuschszene mit wechselnd beleuchteten metallenen Mobiles, mit kahlen, sandgelben Wänden die Wüstenbilder, einer verwinkelten Treppen- und Gitterkonstruktion sowie mit morgenländisch-bunten Kostümen das ägyptische Ghetto des jüdischen Volkes. Weniger glücklich war die Choreographie derMary- Wigman-Schülerin Dore Hoyer teils schwerfällig, teils, indezent, trotz aller Stilisierung. Aber hier stand man, das sei zugegeben, vor einem Dilemma: entweder die exzentrischen Anweisungen des Autors zu befolgen dann mußte geschehen, was da auf der Bühne von den Tänzern vorgeführt wurde oder sie zu negligieren und sich etwas anderes auszudenken… Bewunderungswürdig die Leistungen aller Ausführenden: des durch den RIAS-Kammerchor verstärkten großen Chors der Städtischen Oper, des Orchesters und der Solisten, vor allem der beiden Titelhelden: des eindringlich und mit hohem Ernst sprechenden Josef Greindl und des stimmgewaltigen Helmut Melchert, die alle von Hermann Scherchen als Dirigent und von Gustav Rudolf Sellner als Spielleiter souverän geführt wurden. Das Publikum der beiden Festwochenaufführungen zeigte sich zutiefst ergriffen von einem esoterischen Werk und seinem Autor, der das Unmögliche anstrebt. Die Proteste einer Gruppe Jugendlicher, die gekommen waren, um zu pfeifen, brachte zwar scharfe Mißtöne in den Premierenabend sollte aber nicht weiter beachtet werden — es wäre denn aus Gründen, die hier, in einem österreichischen Blatt, nicht zur Diskussion stehen.
Die Städtische Oper war auch der Schauplatz zweier großer Ballettabende der Berliner Festwochen. Am ersten wurden zwei schon seit längerer Zeit im Repertoire befindliche Werke gezeigt: „Agon", Ballett für zwölf Tänzer von Igor Strawinsky, und „Der Mohr von Venedig“ von Boris Blacher, seinerzeit für die Wiener Staatsoper geschrieben, von Erika Hanka choreographiert und von Georges Wa- khewitsch ausgestattet. Für Berlin schuf Jean- Pierre Ponnelle die Bühnenbilder und Kostüme und Tatjana Gsovsky, die Ballettmeisterin der Städtischen Oper, die Choreographie. Unter ihrer Leitung stand auch der zweite Abend mit den beiden Novitäten. „Schwarze Sonn e“, nach einer harten, dissonanzreichen, gestisch empfundenen Musik von Heinz Friedrich Hartwig, benützt als Stoff die antike Sage von Orest, Elektra, Klytämnestra und Aegist — ohne wesentliche Veränderung der Sophoklei- schen Fassung der Atriden-Tragödie. Um so eigenartiger und origineller, in manchen Szenen dieses dreiaktigen Balletts freilich auch intellektuell und ein wenig ausgefallen, war die Tanzgestaltung durch Tatjana Gsovsky. Diese bedeutende Künstlerin zeigt in den letzten Jahren eine vielleicht zuwenig kontrollierte Neigung für die großen Stoffe der Weltliteratur „Hamlet“ und „Othello" nach Shakespeare, „Der Idiot“ nach Dostojewsky, jetzt das Atriden- Ballett usw., wobei schwierige psychologische Vorgänge letzten Endes durch eine Art Stummensprache ausgedrückt werden müssen und das eigentlich Tänzerische zu kurz kommt. Freilich ist, was Tatjana Gsovsky macht, immer interessant und kultiviert, auch hat sie hervorragende Solisten zur Verfügung für „Schwarze Sonne" zum Beispiel Gisela Deege, Gert Reinholm und Tana Herzberg, so daß der Gesamteindruck doch überwiegend positiv bleibt. Freilich hätten manche Einzelheiten in dem Ballett „Undine“ in vier Bildern nach de la Motte- Fouque von Frederick Ashton, das sehr erfolgreich bereits auch in London und in München gegeben wurde, poetischer sein können. Denn der junge deutsche Komponist Hans Werner Henze, zweifellos die reichste Begabung seiner Generation, schrieb hierfür eine zauberhafte, in allen Farben spielende, melodiöse, klanglich hochraffinierte Musik, die eine ebenso traumhaft schöne Choreographie und Ausstattung inspirieren könnte. Dem Bühnenbildner Werner Schachteli lag der Stil des Atriden-Balletts, eine Art Trümmerantike, wie man sie jetzt häufig auf europäischen Bühnen sieht, offensichtlich besser als die romantische „Undine“, die der Librettist und der Komponist aus den deutschen Wäldern ins Mediterrane verpflanzt hatten. Die Titelpartie wurde von der jungen, hochtalentierten Judith Dornys, die im vorigen Jahr in einem „Lulu"-Ballett nach Wedekind Aufsehen erregt hatte, virtuos und sehr anmutig, aber recht distanziert getanzt. Das Orchester hat Ernst Märzendorfer dirigiert, der die Partitur von Hartwig hart und präzis, wie sich’s gehört, und die von Henze weich und poetisch zum Klingen brachte.
Schließlich gab es, außer dem Gastspiel der „Ballets: USA“ von Jerome Robbins, die in Berlin mit ihrem Programm ebenso akklamiert wurde wie bei den Salzburger Festspielen, noch ein interessantes Ballettexperiment. Unter dem poetischen Titel „Such sweet thunder“ welcher dem vierten Akt des „Sommernachtstraums“ entnommen ist schrieb Duke Ellington 12 Jazzskizzen, die vor zwei Jahren in einem Konzert „Music for Moderns“ urauf geführt wurden und inzwischen auch auf einer Schallplatte Philips B o 7278 L registriert wurden. Diese Komposition bezeichnet Ellington „als einen Versuch, die Abbilder einiger Shakespeari- schen Gestalten in Miniatur zu untermalen — manchmal bis zur Karikatur“. Zu diesen 12 Miniaturen hat der 1932 geborene, in Frankreich von Martha Graham beeinflußte und an der Metropolitan Opera tätige Choreograph Pierre Lacotte Tanzszenen erdacht, die von ihm und seinen sechs jungen Tänzern ausgeführt werden und die die Shakespearischen Gestalten und Szenen ins Surreale, Witzig-Phantastische übersetzen — und gewissermaßen noch einmal „verfremden". Man machte das im Berliner Hebbel-Theater so, daß nach einem kurzen szenischen Vorspiel zwei großartige Shakespeare-Interpreten, Marianne Wimmer und Martin Held, die betreffenden Textstellen aus „Othello“, „Hamlet“, „Julius Cäsar“, „Antonius und Kleopatra". „Sturm“ usw. vorlasen, dann erhellte sich die Bühne, und es folgte die tänzerische Shakespeare-Interpretation zur vom Tonband wiedergegebenen Musik Duke Ellingtons. Zwar entstand auf diese Weise kein absolut geschlossener Eindruck, dafür aber hörte man die unvergänglich schönen Verse klug und witzig lesen, bewunderte die raffinierte Instrumentation eines großen Könners und sah sieben nette junge Leute ihr tänzerisches Allotria treiben. Das Ganze hat uns zwar nicht vollständig überzeugt, dafür aber sehr amüsiert. Auch das gibt’s in Berlin.