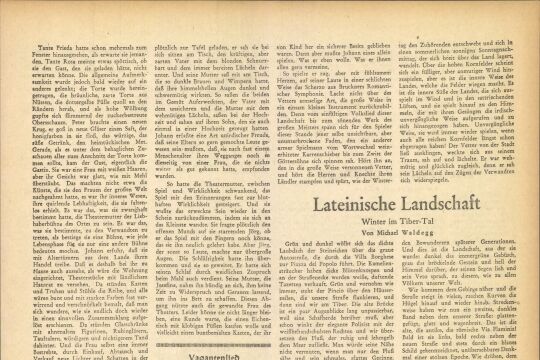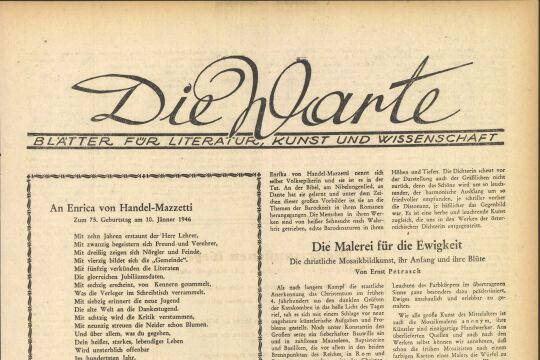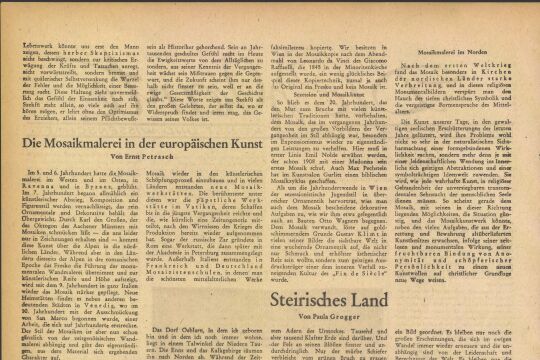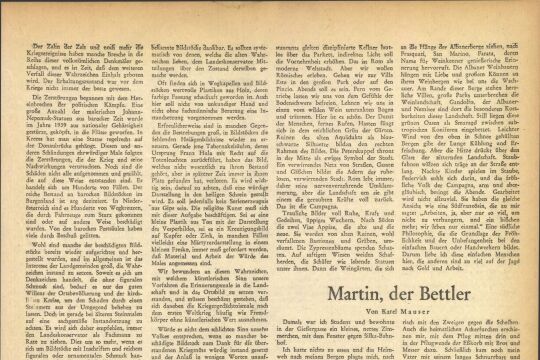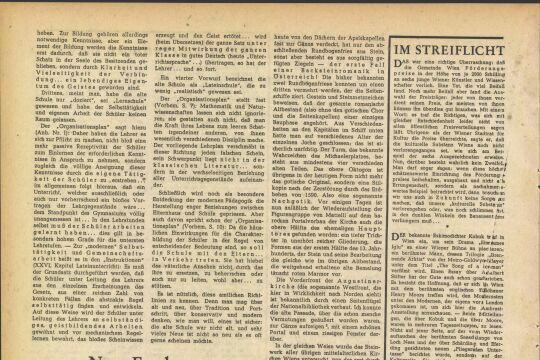Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Schatten des Ararat
Nach dem Alten Testament ist die Arche Noah, als sich die Sintflut zurückzog, auf dem Berg Ararat stehengeblieben. Dieser Glaube hat sich im armenischen Volk erhalten; Funde aus neuerer Zeit geben ihm Nahrung. Auch die beiden prunkvoll in Silber gerahmten Holzstücke, die im Kloster Etschmiadsin gezeigt werden, stammen angeblich von dem sagenhaften Floß. Jedenfalls ist der Ararat oder — wie er armenisch heißt — „Masis“, das heißt der Großartige (auf türkisch Agri-Dagh, auf persisch Koh-i-nuch), ein Berg von außergewöhnlicher Schönheit. ■ Hart an der Dreiländerecke Sowjetunion-Iran-Türkei gelegen, ist er das Wahrzeichen von Eriwan, der Hauptstadt der sowjetischen Republik Armenien, und beherrscht mit seinem 5160 Meter hohen, schnee- und eisgepanzerten Vulkankegel die ihm vorgelagerte, fast 1000 Meter hohe Ebene des Araxes. Eriwan heißt auf deutsch „sichtbar“. Diese Stelle soll Noah vom Ararat aus — der Ueberlieferung zufolge — zuerst als Land erblickt haben. Wenn man die jüngst erbaute Prachtstraße der Stadt, den Stalin-Prospekt, aufwärts über die anschließende Höhenstraße bis zum gigantischen Stalin-Monument (einer 18 Meter hohen Bronzeplastik auf riesigem Steinsockel), zum schönsten Aussichtspunkt der Stadt, fährt, breitet sich nach allen Seiten ein zauberhaftes Bild orientalischer Schönheit aus: in der Ebene, ins westliche Flußtal hinein, bis an die Hänge der umliegenden Hügel, die allmählich zum schneebedeckten Hochgebirge ansteigen, dehnt sich die Stadt. Wo noch vor wenigen Jahrzehnten nur einige Dörfer mit Holz- und Lehmhütten standen, steht heute eine moderne Großstadt mit 600.000 Einwohnern und Prunkbauten aus dem hier im Ueberfluß vorhandenen braunen Basalt und rosaroten Tuffstein. Wegen der Erdbebengefahr darf nicht über vier Stockwerke hinaus gebaut werden, landeseigene architektonische und ornamentale Motive sind überall geschmackvoll verwendet. Die letzten Reste der einstigen Hüttenstadt haben sich ans Ufer des Flusses Rasdan in malerischer Anordnung zurückgezogen; von hier führt auch eine reizende Liliputeisenbahn für Kinder, mit Bahnhöfen, Semaphorerr1 und allem, was dazu gehört, in das geologisch interessante, wild zerklüftete Flußtal hinein, das nach einigen Kilometern von einer noch im Bau befindlichen gigantischen Straßenbrücke von amerikanischer Kühnheit überspannt wird. Dieses Tal beginnt im nahen Hochgebirge im riesengroßen Sewän-See, der als Erholungs- und Ausflugsort wie als Wasser- und Energiequelle für das ganze Land wichtig ist.
Doch nicht ins Gebirge führt uns unser Weg, sondern aus der Stadt heraus aufs flache Land, wo wir in kaum halbstündiger Autofahrt, an kleinen Gehöften (nicht Kolchosen), Silberpappelalleen und hübschen Hecken, die zum Teil noch das Herbstlaub tragen, vorbei, eine durch künstliche Bewässerung in einen einzigen überaus fruchtbaren Obst- und Gemüsegarten verwandelte Landschaft antreffen. Manchmal sieht es aus wie in der Wachau: zu beiden Seiten Marillenbäume, Pfirsichkulturen und immer wieder Weingärten, die das Rohmaterial für die auf einem Hügel der Stadt thronende, wegen ihrer Herstellung von hervorragendem Spezialwein und Kognak berühmte Fabrik liefern. Beladene Esel traben an uns vorüber, auf den Feldern weiden dunkle Rinder und schwarze Schafe. Einmal müssen wir ein Stück neben der Straße fahren, weil auf dieser blütenweiße Baumwolle zum Trocknen in der südlichen Dezembersonne ausgebreitet liegt.
Wir kommen vorbei an einem an unsere romanischen Rundbauten erinnernden Kloster aus dem 7. Jahrhundert und an den Ruinen eines anderen Klosters aus der gleichen Zeit, das Erdbeben und Ueberfällen kriegerischer Nachbara zum Opfer gefallen ist. In antiker Schönheit türmen sich Säulen, wunderbar ornamentierte Kapitale und Mauerblöcke übereinander. Sehr schön erhalten sind das zentrale Taufbecken, zu dem man einige Stufen hinabsteigen muß, und die Grundmauern der Wohnungen der Geistlichen, deren Zimmeranordnung noch genau ersichtlich ist. Ein kleines Museum birgt köstliche Schätze aus jüngsten Grabungen und eine getreue Rekonstruktion des einst offenbar sehr imposanten sakralen Baues.
Wir setzen unsere Fahrt fort und^sind bald am Ziel: Ein Gittertor läßt uns in die stimmungsvolle, friedliche und harmonische Welt des Klostergartens von Etschmiadsin, mit regelmäßigen Rabatten, südlichen Bäumen und der herrlichen Kirche in der Mitte, ein. Wir stehen vor einem der ältesten christlichen Gotteshäuser. Im Jahre 301 begonnen, wenig später vollendet und in der Folge nur geringfügig baulich verändert (so war beispielsweise die Kuppel ursprünglich aus Holz), in den letzten Jahren mit staatlicher Hilfe mustergültig restauriert, tut sich vor uns ein Wunderwerk architektonischer und malerischer Schönheit aus den allerersten Anfängen unserer Kultur auf, das in seiner schlichten Ausdruckskraft selbst die überwältigenden Schönheiten der Kremlkathedralen beinahe übertrifft. Zwei Geistliche, mit Apostelgesichtern wie von Rubens gemalt, der eine von ihnen der 76jäh-rige, noch sehr rüstige stellvertretende Katholi-kos der armenisch-gregorianischen Kirche, führen uns. Sie tragen schwarze Talare mit weit über den Rücken herunterreichenden kapuzenartigen Kopfbedeckungen aus kostbarem schwarzem Seidenbrokat und große, schwere silberne Brustkreuze mit Rubinen, Saphiren und anderen Edelsteinen in den Kreuzbalken und bunten Emailmedaillons als Mittelstücke. Sie erklären uns in russischer Sprache die aus Pflanzenformen gewonnenen, stets wechselnden Ornamente der Außenarchitektur und die Freskenmalerei der fünf (früher sieben) Innenkapellen. Es handelt sich um einen typischen Zentralbau mit Kuppel auf quadratischer Basis und Konchen an den Seiten,, wie er später im ganzen Bereich der orthodoxen Kirche vorherrschend geworden ist. Die bei den Fresken verwendeten Farben sind so haltbar, daß das besonders schöne Apostelfries unter dem Hauptaltar durch all die Jahrhunderte dem inbrünstigen Ansturm von Millionen Lippen und Händen Gläubiger ohne Einbuße an Substanz und Leuchtkraft der Farben standgehalten hat. Seltene Kunstwerke und Reliquien birgt die kleine Schatzkammer des Klosters (ein durch ein starkes Tor abgeschlossener, Diamanten und andere außerordentliche Schätze enthaltender Raum blieb uns unzugänglich). Teppiche und Gobelins mit armenischen, persischen und indischen Mustern, prunkvolle Meßgewänder und Geräte füllen Wände und Vitrinen. Die schon erwähnten Reste der Arche Noah und daneben die Spitze der Lanze, mit der die Seite Christi am Kreuz von einem römischen Legionär durchbohrt worden sein soll, stellen, nach Art von Ikonen in Gold und Silber gerahmt, besonders verehrte Kostbarkeiten dieser Sammlung dar. Stilistische Unterschiede der einzelnen Stücke — die aus dem 4. bis 17. Jahrhundert stammen — treten in den Hintergrund. Zeitlos und ewig erscheint hier das Antlitz religiöser Kunst.
Anschließend besuchen wir das Handschriftenmuseum der Stadt mit prachtvollen Manuskripten aus dem 5., 8. und 9. Jahrhundert. Die frühesten sind auf Pergament, die späteren schon auf Papier geschrieben und mit märchenhaft schönen Miniaturmalereien geschmückt. Glanzstücke der Sammlung sind die Buchmalereien von Toroß aus dem 13. Jahrhundert, deren Schönheit ihresgleichen sucht. Besonders interessant ein „Rukapiß“ (Manuskript) aus dem 8. Jahrhundert mit äußerlich den abendländischen Neumen ähnlichen, aber doch von diesen dem System nach verschiedenen Noten. Schon im Jahre 402 wurde die armenische Schrift durch zwei Priester erfunden, die ältesten Handschriften sind Bibeln, geistliche Bücher, Ueber-setzungen griechischer Philosophen (darunter Aristoteles und Philo), Historiker wie Herodot, Mathematiker wie Euklid und der Kirchenväter. Manchmal ist das griechische Original verloren, wie zum Beispiel bei der Chronik des Eusebius, und der Wert der armenischen Kopie daher unermeßlich. Früher als anderswo war hier das Christentum Staatsreligion. Wir stehen an einer Quelle unserer Kultur.
Die Stille des Raumes, die Farben und Formen dieser uralten Zeugnisse gestaltgewordenen menschlichen Denkens und Erlebens entrücken uns in magischer Weise. Erst das Auto bringt uns wieder in die Wirklichkeit von heute zurück. Doch zu später Abendstunde rankt sich durch das halbgeöffnete Fenster meines Zimmers um die vertraute Melodie eines modernen Jazzschlagers die näselnde Arabeske eines fremden Volksinstruments mit den charakteristischen übermäßigen Tonschritten in monotoner, uralter Weise.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!