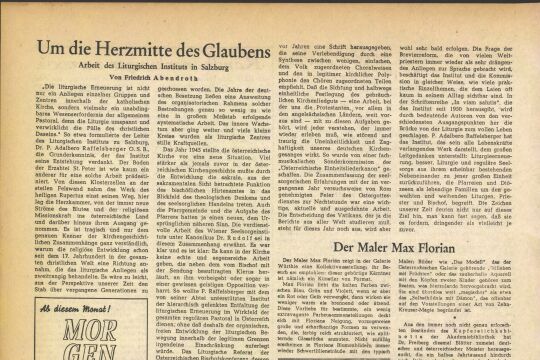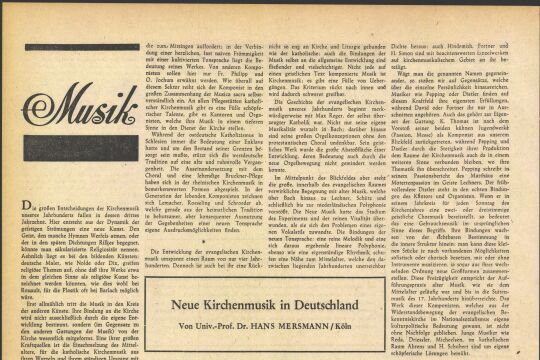Das Ideal des kirchenmusikalischen Schaffens der Jungen ist eine Musik, die in Voraussetzung und Wirkung dem Gregorianischen Choral möglichst nahekommt; die eine liturgische Funktion ausübt (nicht Dekoration), sich als liturgisches Gebet ihrer Funktion bewußt ist, dem Worte dient und es nicht als Vo-kalise mißbraucht. Daß damit keinem Puritanis-mus das Wort geredet ist, beweisen die melis-matischen Gesänge, Jubilationen usw. des Chorals. Dabei darf und soll die Kirchenmusik auch im Rahmen ihrer liturgischen Funktion mit allen gottgegebenen Mitteln, also auch mit den modernsten der Musik, Gott die Ehre geben, ohne das gebotene Maß der Ehrfurcht zu überschreiten und in uferloses Experimentieren auszuarten. Das ist ebensoviel Freiheit als Beschränkung, bedarf der Kühnheit ebensosehr als der Selbstzucht, der Bsrufung vor allem, die in religiöser Demut auf leicht zu erringende Vorteile verzichtet, denn die Kirchenmusik ist kein „lohnendes“ Geschäft.
Um so erfreulicher, daß bei allen Völkern aus der Gilde der Berufenen da und dort ein markantes Profil sich formt und der jungen Generation ein Neuland eröffnet wird, darin sie ihren eigenen musikliturgischen Ausdruck findet und weiterformt. Bei aller Vielfalt und Vielgestaltigkeit der Talente ist das eifrige Streben nach Unmittelbarkeit des liturgischen Ausdrucks in der Musik gemeinsam und ihre unbedingte Choral-bezogenheit als der alleinigen Quelle aller gottesdienstlichen Musik.
An der Spitze der jungen Sakralkomponisten dürfen wir den Wiener Anton Heiller nennen. In seinem Schaffen sind alle Komponenten der jungen Generation: Choralerlebnis, absolute Polyphonie, symbolische Ausdeutung des harmonischen Elements, das die tonale Be-zogenheit sehr weit spannt, aber nie ganz verläßt, Reihen- und Variationstechnik, bei alledem Durchsichtigkeit des Stimmgewebes usw. zu einem höchst persönlichen Stil geworden, der nirgends die Unmittelbarkeit sakralen Ausdrucks verliert und in oft epigrammatischer Kürze und Dichte sich, immer als Ganzes, mitteilt. Seine Tonsprache ist nie pathetisch, jedoch immer, auch in kleinster Form, groß, voll innerer Gewalt und Spannung. Ein solcher Stil stellt naturgemäß an Ausführende und ebenso an Aufnehmende (Zuhörer) seine Anforderungen. Er ist nicht leicht und macht es niemand leicht in der Erkenntnis, sakrale Erhebung, nicht Unterhai' tung zu sein. Getanzt wird nebenan. Die sakrale Deutung selbst seiner weltlichen Kompositionen wäre ein interessantes Studium. Die Choral-bezogenheit Heillers erschöpft sich keineswegs in Zitat oder Variation; von beiden ist in dem vielleicht „gregorianischesten“ aller jungen Komponisten wenig zu finden. Wenn Max Springer das gregorianische Thema romantisch harmonisierte, Joseph Lechthaler es in genialer Variationstechnik motivisch, gewissermaßen sogar leitmotivisch verwendete, ist bei Hei 1-ler die Erfindung von solch gregorianischem Geist, daß man oft geneigt ist, das (gar nicht existierende) thematische Vorbild zu suchen. Natürlich sind Erfindung und Ausdruck jeder Sentimentalität bar. Wo er nicht den A-cappella-Gesang als unmittelbarstes Ausdrucksmittel vorzieht (was zumeist der Fall ist), verwendet er im Instrumentalen in erster Linie die Orgel, auch sie in einer Art, die einerse'ts vom spröden Instrumentar der Strawinsky-Messe das Patriarchalisch-Hohe und irgendwie Fern“, anderseits von der oft im rein A!:kordlichen ruhenden geläuterten Subjektivität Frank Martins die .seelische Tiefe, wiederum zu höchst
persönlicher Note, verdichtet. Mehr als bei allen anderen jungen Sakralkomponisten, Oswald Jaeggi ausgenommen, sind bei Heiller Polyphonie und harmonische Bewegung, Architektur und sogar Besetzung allen Selbstzwecks enthoben und als Ganzes Mitteilung, die Form als integrierender Bestandteil des Inhalts. Der Kritik wird ein einmaliges Hören eines Heillerschen Werkes kein gültiges Urteil erlauben; dennoch waren alle bisherigen Aufführungen seiner Kompositionen große Erfolge, das Publikum empfand die Lauterkeit ■ und Unmittelbarkeit als Erlebnis — wieviel überzeugender ist diese Erscheinung als etwa die umgekehrte (soweit es sich um wirkliche Kunst handelt).
Stilistische Schlagworte werden durch eine Persönlichkeit von solcher Einmaligkeit ad absurdum geführt. Heiller ist ebenso barock als nicht, ebenso linear als romantisch, ebenso lyrisch als episch; alle Stilelemente der Tradition sind bei ihm zu neuer Substanz vereinigt, wobei eine herbe, klare Linearität vorherrscht. Wesentlich für seine Musik erscheint, daß sie, je mehr sie sich rundet, um so gTößer den Kreis zieht. Denn selbstverständlich ist bei aller fast somnambulen Sicherheit in der musikalischen Gestaltung eines Stoffes — auch des liturgischen — eine fortschreitende Entwicklung da, die verbessert, vereinfacht, lockert; mit anderen Worten: Heiller ist, trotz aller erreichten Höhe, weiter auf dem Wege zu sich selbst. Es ist sehr bezeichnend, wie schlecht er stets auf sein vor-
letztes Werk zu sprechen ist und sich nur allmählich mit ihm wieder aussöhnt. Einem großen Kreis von Schülern ebnet er die Wege in das Land, das sie „mit der Seele suchen“.
(Werke: Missa in Mixolydisch-G, Missa in Lydisch-F,' Missa brevis, Missa in nocte, Missa super „Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort“, Te Deum, Psalmenkantate, Tentatio Jesu, Francois Villon, Orgelkompositionen usw.)
In der Vollkraft seines Lebens und Schaffens, zehn Jahre älter als Heiller, steht der 1913 in Basel geborene Oswald Jaeggi. Von Natur und Temperament fast gegensätzlich veranlagt, teilt er mit Heiller die dominierende Hinwendung zur Musikliturgie und die absolute Choral-bezogenheit. Der klare und ordnende Sinn des Schweizers hat ihn im Aufnehmen und Verschmelzen dreier Kunstkreise vor allzu großen Umwegen bewahrt. Sein Melos hat die italienische Leichtigkeit und Logik, sein Kontrapunkt ist von Bachscher Dichte und Symbolik, und seine
Prägnanz mutet (auch rhythmisch) nicht selten französisch an. Aus einer geheimen Dosierung dieser Komponenten erwächst sein ausgeprägter persönlicher Stil, der analog seinem Priestertum bei aller Lebendigkeit etwas Mönchisch-Geläu-tertes hat (kein Mönchisch-Strenges, es sei denn die Konsequenz und Konzessionslosigkeit.) Jaeggi steht nicht in der Avantgarde, so eigenartig und im geistigen Sinne modern seine Musik ist. Die Unmittelbarkeit ihrer Wirkung ist fast greifbar, auch wenn die Ausweitung der Tonali-tät und die freie Linienführung engere Grenzen hat als bei Heiller. Unter den Avantgardisten der Kirchenmusik nimmt Jaeggi eine Art pale-strinensische Stellung ein, eine korrekte Wirkung des allzu Ausschweifenden, was man sich allerdings in keiner Weise als Enge vorstellen darf. Sein mehrstimmiges „Ave Maria“ beispielsweise kann nur, wenn das Wort erlaubt ist, als mehrstimmige Gregorianik bezeichnet werden. Das Latente in der Rhythmik der Stimmen, der sehr oft archaisch anmutende Fluß und Fall des Melos, die langen ineinandergreifenden Perioden sind dem Choral unmittelbar verschwistert, die Variationen von Choralthemen gehen über den thematischen Gedanken weit hinaus bis zu seiner symbolischen Deutung, ohne einer stilfremden Stütze je zu bedürfen. Jaeggis Musik ist ein einziges „Sursum corda“, sie beleidigt nie das Ohr des Hörers, aber sie bewegt und erschüttert sein Gemüt mit vitaler Kraft. Die Musik rinnt aus ihm wie ein Brunnen, ohne sich je zu wieder-
holen, in Schubertscher Fülle, allerdings nicht in Schubertscher Süße, sondern in herber helvetischer Schönheit. Sein Stil ist von allen hier angeführten Namen der Rundung zur Meisterschaft am nächsten, auch in diesem Sinne dem Mönchischen entsprechend. Dennoch ist seine Musik (und das ist kein Widerspruch, sondern hpjierer, Enjspruch des Mönchischen) im Grunde von fröhlicher Kraft und Freude und vermag den jungen Komponisten genug davon mitzugeben, um sie vor musikalischer Blutarmut zu bewahren.
(Werke: Missa Ancilla Domini, Bruder-Meinrad-Messe, Herz-Jesu-Messe, Motette „Fundata“ für zwei Chöre usw.)
*
Sind Heiller und Jaeggi scharf ausgeprägte Profile, deren Stil einer Rundung und Vervollkommnung zustrebt, aber kaum mehr wesentlich neue Züge annehmen dürfte, gilt die Arbeit der folgenden drei Komponisten noch in hohem
Maße der Bildung und Festigung des persönlichen Stiles, gleichsam der Klärung ihrer Handschrift. Unter ihnen am weitesten ist der Schweizer Ernst Pfiffner, geboren 1922 in Mosnang (St. Gallen). Schon in der Art seiner Musikstudien Kosmopolit — er studierte in Fryburg, Luzern, Rom, Basel, Regensburg und Paris, war Schüler von Burkhard und Nadja Boulanger —, tritt dieser gleichsam paneuropäische Zug auch in seinem Schaffen immer stärker hervor, das Beziehungen zu Strawinsky und Krenek ebenso aufweist als zur Gregorianik und den Vor-palestrinern, ohne einem davon das unbedingte Uebergewicht zu geben: die günstigste Voraussetzung für einen weltweiten und daher allgemeingültigen Stil. Dazu aber setzt Pfiffner immer sich selbst, Herz und Geist und Demut, voll ein. In einem seiner Briefe stehen die Sätze: „Nie möchte ich in der Musik die Ganzheit des Menschen missen, die auch die Fähigkeit der Muße, des nicht Faszinierenden in sich schließt. Was nützt die raffinierteste serielle Komposition, wenn sie nur den Intellekt berühren kann! Ich begrüße sie aber, wenn sie hinter musikalischem Ausdruck auch geistige Ordnungen entdecken läßt.“ Oder an anderer Stelle: „Nach langen Forschungen bekommen die Experten heraus, daß die grüne Farbe am beruhigendsten sei. Gott aber ließ Wiesen und Wälder von Anfang an grün wachsen. Alles Erfinden ist daher meist nur ein Finden, und es kann im Grunde nichts zu neu sein.“ Die substantielle Durchblutung seiner Musik aber kommt noch von einer anderen Komponente her: aus dem praktischen Verbundensein mit dem kirchlichen Volksgesang. „Ich sehe im Choral eine Analogie zur philosophia perennis“, ist seine Erklärung, aber er übt die „philosophia“ mit Chor und Pfarrgemeinde und holt hieraus die zweifellos stärksten Anregungen für sein Komponieren, dessen Produkte* sehr häufig sofort die praktische Wertprobe zu bestehen haben.
Pfiffner lebt in Basel. Wo auch könnte sein „europäischer“ Stil sich leichter und gleichsam bodenständiger entwickeln als in dieser weltoffenen musischen Schweizer Stadt?
(Werke: Piusmesse, Deutsche und lateinische
Propriumsgesänge, Psalmen, Orgelkompositionen
usw.)
*
Vor allem durch seine Missa brevis ist der 1928 in Glogau, Schlesien, geborene Heimo Schubert weiteren Kirchenmusikkreisen bekannt geworden. Inzwischen aber hat sein sakralmusikalisches Schaffen bereits reichlich Früchte getragen und eine Persönlichkeit von bedeutenden Anlagen und klarem Willen entwickelt, deren weitere Entfaltung der neuen Sakralmusik Impulse geben dürfte. Was besonders auffällt: einer komplizierten, verästelten, der Sprachbetonung entspringenden Rhythmik steht ein verhältnismäßig einfaches harmonisches und kontrapunktisches Gebäude gegenüber. Die Zeit des tonalen und atonalen Experimentierens scheint in Schubert überwunden. Die Einfachheit des Satzes aber ist hier nicht aus Epigonie, sondern aus meisterhafter Satztechnik heraus erwachsen, die sich in den liturgischen Dienst stellt, um zu dienen. Auch hier sprechen die Worte des Komponisten für sich selbst: „Eine kirchenmusikalische kompositorische Arbeit ist ohne gründliche musikalisch-geistige Auseinandersetzung mit der Welt des Gregorianischen Chorals nicht denkbar. Das sollte von selbst ergeben: einerseits eine rechte Ordnung im sakralen und liturgischen Raum, anderseits aber auch eine echte, persönliche Auseinandersetzung mit der Musik unserer Tage, mit handwerklich und künstlerisch befriedigenden Ergebnissen.“ Heimo Schubert hat mit diesen Worten die kürzeste Formel für das Streben aller jungen Sakralkomponisten, soweit sie berufen sind, gefunden. Die Unmittelbarkeit und Lauterkeit seiner Sakralmusik dürfte der beste Beweis für die Richtigkeit seines Weges sein. (Werke: Missa brevis in E, Missa canonica,
Missa Dona nobis pacem, Deutsches Proprium zum
Dreifaltigkeitssonntag, Drei Motetten zum Fest
Christi Himmelfahrt usw.)
Als Jüngster in der Reihe der Jungen, die auf diesem engen Raum genannt seien, ist Hans Zender, geboren 1936 in Wiesbaden, zu erwähnen. Trotz seiner Jugend zeichnet sich in seinen Kompositionen ein sehr eigenwilliges Profil'bereits ab. Die formale Lösung von Proprium-und Ordinariumsgesängen ist sein Bemühen, ein Problem, das ein ganzes Leben ausfüllen kann, denn mit Ausnahme des Gregorianischen Chorals hat kein Stil diese Lösung gefunden. Aber „wer immer strebend sich bemüht“ — findet seine Erfüllung. Die Frische und zupackende Kraft Zen-ders, der eine glückliche Selbstdisziplin nicht fehlt, wird der neuen Sakralmusik viel Gesundes und Wertvolles geben können, wenn ihre Entwicklung in der sich bereits abzeichnenden Weise, ohne große Ablenkungen, vor sich gehen können wird.
(Werke: Proprium Missae in Dedicatione Eccle-
siae, Fünf geistliche Hymnen für gemischten Chor,
Orgelwerke u. a.)