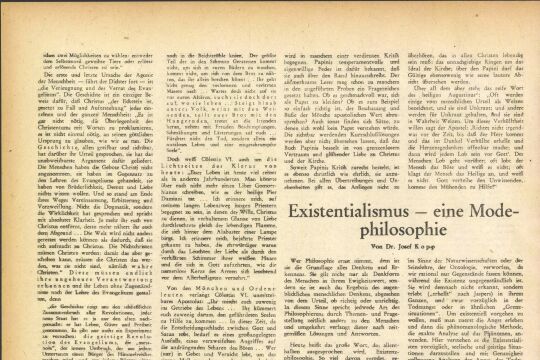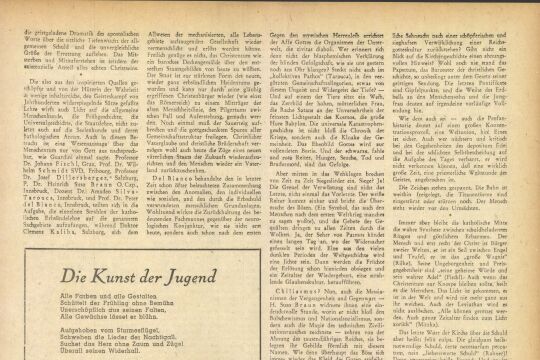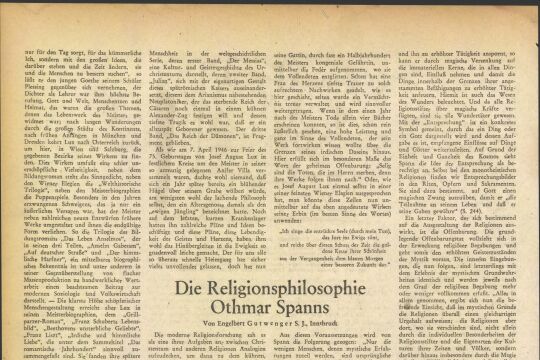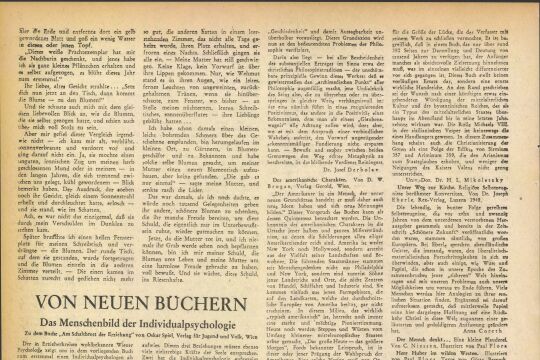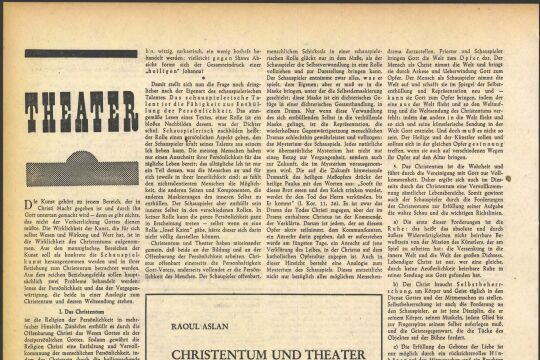Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mensch und kosmische Ordnung
DAS CHINESISCHE DENKEN. Von Marcel Granet. Herausgegeben und übersetzt von Manfred P o r k e r t, mit Vorwort von Herbert Franke. Piper-Verlag, München, 1963. 405 Seiten. Preis 12.80 DM.
Das Denken wird von der Sprache und die chinesische Sprache von der Schrift in Ideogrammen beherrscht. Diese sind Sinnzeichen, manchmal auch direkt Bilder einer konkreten, phänomenalen Gegebenheit. Phänomene sind nie erstarrt, und so versuchen die Schriftzeichen, symbolisch den Akt und das Funktionieren von Erscheinungen festzuhalten und wiederzugeben. Selbst das Substantiv bleibt Verbum, Ausdruck eines Tuns oder Aufforderung zu einer Handlung. Da aber nicht jedes Erscheinungsmoment zu einem neuen Zeichen führen kann, repräsentiert ein Akt, ein Bild das lebendige Zusammenspiel eines Wesens mit seiner Umwelt. Diese Funktion des chinesischen Schriftzeichens, das erst im Satzzusammenhang seinen Sinn erhält, findet seine Erweiterung im Stil der chinesischen Literatur.
Eine kleine Anzahl von Sentenzen, Sprichwörtern und gleichbleibenden Erzählungen (Parabeln) stehen für bestimmte konkrete Situationen, drücken einen bestimmten Sachzusammenhang aus; so gilt das Bild der Ernte oder das Verfärben der Blätter für Herbst. In der Literatur tauchen immer wieder, in gleicher Zusammenstellung, die nämlichen Bilder auf. aber die Eigenart und der Reiz der chinesischen Texte liegt in der immer wieder neuartigen Verbindung mit anderen Motiven. Es sollen Embleme und Metaphern so verbunden werden, daB sie einen erweiterten Sinn der Wirklichkeit aufdecken und erahnen lassen. Dies gibt vielfach der alten chinesischen Literatur den Anschein von weisen Rätselsprüchen. Nichts wird direkt ausgesprochen; seit Jahrtausenden bemüht man sich, seine Gedanken und auch seine Befehle in stereotypen Bildern anzudeuten. Nirgends gibt es dazu Regeln und Gesetze, sondern Stil und Rhythmik der Sprache müssen ebenso erfahren werden, wie man Naturphänomene erst wirklich kennt, wenn man sie erlebt hat.
Es gibt für das chinesische Denken keine abstrakte Gesetzlichkeit der Logik und keine isolierenden, mechanistischen Weltvorstellungen. Der Chinese ist bemüht, das Ganze in seinem Zusammen- spiel aufzunehmen und zu erfassen, und ein Ganzes kann nicht in Teile zerfallen, sondern lebt, wirkt und ist so umfassend, daß es das Denken und Handeln aller Menschen schon mit in sich einbezieht.
Bereits in den frühesten Anfängen chinesischer Kultur finden wir dieses Weltbild — das übrigens in der Zeit des Mythos weit verbreitet war und in mannigfaltigen Abänderungen auch im europäischen Raum nachweisbar ist — einer kosmischen Harmonie, die sich im ewig gleichbleibenden Umschwung der Gestirne um den himmlischen Pol (Polarstern), dem Sitz der Heiligkeit und der Weisheit manifestiert. Von dieser Mitte, die sich allein durch sich selbst erzeugt und bewegt (sheng sheng = das Erzeugte erzeugt das Erzeugende), geht alles Leben und Wirken aus. Alle Gegensätze (Yin und Yang), wie das Weibliche und das Männliche, das Dunkle und das Helle, Kaltes und Warmes, Wasser und Feuer, die sein müssen, um den Bestand der Welt zu gewährleisten, können doch nie zu Gegenteilen und Widersprüchen ausarten, denn sie werden durch die Mitte, um die sie in ihrer rechten Bahn kreisen, in kosmischem Gleichgewicht, dem T’ien-Tao (der himmlischen Ordnung), erhalten. So aber, wie es ein T’ien-Tao gibt, existiert auch ein irdisches Gleichgewicht in der menschlichen Gesellschaft, das Wang-Tao. Das soziale Geschehen findet seinen Mittelpunkt im König, dem Edelsten unter den Menschen. So wie der Weltenbaum sich senkrecht nach Norden zum höchsten First des Himmels erhebt, so steht der Herrscher aufrecht, um die Ordnung im Staate zu gewährleisten. Staatsordung und Ordnung des Kosmos leben aus dem gleichen Prinzip, dem gleichen Tao; sie zentrieren um die gleiche Weltachse, wie es symbolisch und doch auch voll von phänomenalen Bezügen im Mythos geschildert wurde.
Dem Mythischen entkleidet, hat sich diese Anschauung der einheitlichen und ewigen Ordnung durch die gesamte philosophische und politische Tradition Chinas erhalten.
Auch die europäische Philosophie und Wissenschaft erwuchs aus einem ähnlichen mythisch-phänomenalen Weltbild. Die Parallelen zur griechischen Frühphilosophie sind wohl kaum historisch zu erklären. Es sei nur an jene großartigen philosophischen Gedanken des Aristoteles erinnert, wo er vom Höchsten, dem sich selbst denkenden Gott, dem sich denkenden Gedanken spricht, der durch seiner in sich verharrenden Bewegung, ohne anderes zu berühren, den gesamten Himmelsumschwung in ewigem Kreislauf erhält und somit die Ordnung des gesamten Kosmos, alles Leben auf Erden „verursacht und betreibt”, ohne Ursache und Erhalter zu sein. Aber dieser Gedanke einer ewigen Ordnung erfuhr bald im europäischen Denken einen Riß; menschliche Gesellschaft und kosmische Ordnung bildeten nie jene Einheit, wie sie von den Chinesen immer gesehen wurde.
Um so erstaunlicher ist es, zu sehen — und das konnte Marcel Granet, der 1940 verstarb, natürlich noch nicht erahnen —, wie heute im altchinesischen Gewände eine europäische Ideologie, ein hier mißglückter philosophischer Gedanke uns entgegentritt. Das große kosmische Gesetz, das ewige Zusammenspiel von Gegensätzen im dialektischen Materialismus, umgreift auch die menschliche Gesellschaft. Auch die menschlichen Beziehungen müssen sich in der nämlichen Ordnung vollziehen, in der alles Leben abläuft. Aber dies gilt auch umgekehrt: Nur wenn sich die menschlichen Beziehungen, das soziale Leben, nach’ der Ordnung vollziehen, und indem jeder einzelne darauf hinwirkt, bleibt auch alles andere an seiner Stelle im Gesamtplan. Das Verlangen, daß alle privaten Interessen dem gemeinsamen Ziel eines Wcltkommunismus unterstellt werden, ist mehr als eine politische Erwägung; es ist absolute Notwendigkeit für die Erhaltung der gesamten Wcltordnung. Gegenüber dieser obersten Notwendigkeit nehmen sich die Gefahren eines Atomkrieges wie „Papiertiger” aus.
Was uns vom chinesischen Denken trennt, ist nicht sein Bemühen um eine Einheit und lebendige Ganzheit, in der auch unser gesellschaftliches Leben eingeordnet gehört, denn auch die europäische Philosophie bemühte und bemüht sich, von der Primitivität mechanistischer Isolationen, wie sie nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch heute von der Soziologie produziert werden, loszukom- men. Es gibt keinen Zweifel, daß auch das menschliche Leben in die Gesamt- Ordnung der Welt eingebaut ist. Was uns also trennt, ist das Fehlen des Wissens von individueller Freiheit und der Geschichtlichkeit menschlichen Handelns. Für uns sind die Beziehungen der Menschen untereinander nicht nur in einen gleichbleibenden, ewigen Plan zyklischer Harmonie von Geburt, Wachstum und Tod eingegliedert, sondern haben auch ihre einzigartige Eigengeschichtlichkeit, und hierin liegt der Anspruch und Appell an jeden, frei zu handeln, jede Handlung bedeutet für uns eine Entscheidung, die aus einer bestimmten Vergangenheit erwächst und auf ein bestimmtes Zukünftiges abzielt. Hierin besteht die von niemandem abnehmbare Verantwortung für Entscheidung und Tat. Mit dieser Überzeugung konnte das Abendland sich den Glauben an einen persönlichen Gott bewahren.
Der sich seiner Freiheit und Geschichtlichkeit bewußte Mensch ist mehr als nur das Gattungswesen Mensch, das in und für die kosmische Ordnung wirkt; er lebt nicht nur für die ewige Harmonie, sondern auch in einem unwiederbringlichen existentiellen Augenblick, für den er Verantwortung trägt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!