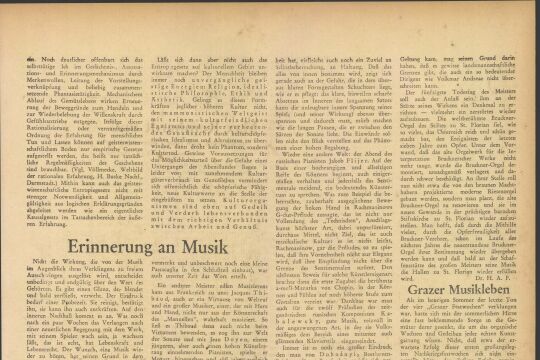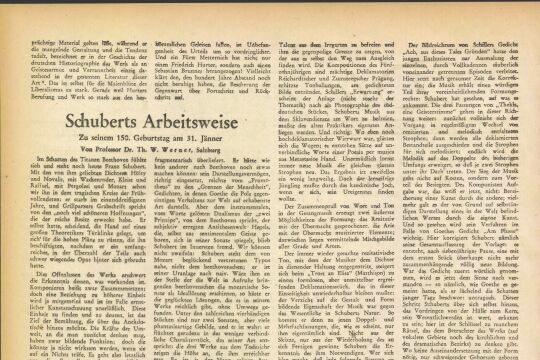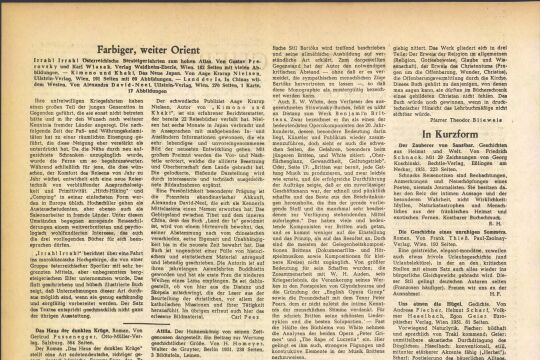Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Moderne“ von gestern
Das Zeitalter des Fortschritts, der Perfektion der Technik und der Mobilisierung der Massen bescherte uns auf musikalischem Gebiet neben anderen zweifelhaften Dingen auch die symphonische Dichtung. Wohl gab es auch in früheren Jahrhunderten Programmusik und Tonmalerei, aber ihr Gebiet war begrenzt und das Verhältnis zwischen Gehalt und Klanggestalt ein künstlerisch-angemessenes. Vor allem aber war die musikalische Substanz so stark, daß diese Kompositionen auch ohne das Programm Eigenwert und Leben hatten. Erst etwa seit Liszt, dem Vater der „neudeutschen Schule“, verschieben sich die Verhältnisse zu ungunsten des Reinmusikalischen. Hand in Hand mit der Wahllosigkeit im Thematischen geht eine beängstigende Aufschwellung des Klangapparats, der schließlich hundert und mehr Spieler umfaßt. Der glänzend-erfolgreiche Repräsentant dieser Gattung war und ist Richard Strauß. Jede Aufführung einer seiner neuen symphonischen Dichtungen, von „Macbeth“ und „Don Juan“ 1S89 bis zur „Sinfonia dome- stica“ 1904 bedeutete eine Sensation und „einen Schritt nach vorwärts“. Und in der Tat ist in diesen Werken eine Gegenständlichkeit der Schilderung und eine Meisterschaft der Instrumentationskunst erreicht, die ihresgleichen nicht hatte. Von Strauß stammt auch das sehr merkwürdige Wort, daß er, was Instrumentation und Technik betrifft, jetzt alles könne. Und noch eine andere Äußerung wird überliefert, die nicht weniger aufschlußreich ist: daß es auch möglich sein müsse, einen Suppenlöffel zu komponieren, so daß jeder das Klangsymbol dafür sofort erkennt. Auch wenn diese Aussprüche nicht wörtlich so getan sein sollten: die Kunstgesinnung, die daraus spricht, findet in einigen- seiner Werke ihr genaues Äquivalent. — Zwischen dem letzten der genannten Tongemälde und der „Alpensymphonie“ liegen zehn Jahre. Wurde bereits in der „Domestica“ zur Schilderung häuslicher Verhältnisse ein Orchester in Bewegung gesetzt, mit dem man einen Weltuntergang instrumentieren könnte, so ist der Apparat der „Alpensymphönie“ vollends ins Gigantische gesteigert. Der Stoff: ein Tag in den Alpen, von der Nacht und Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; vollendet im zweiten Jahr des ersten großen Krieges. Man wende nicht ein, daß dies Werk auch ohne Programm, rein als musikalischer Ablauf zu begreifen sei und daß es sich letzten Endes nicht um Landschaftsschilderei, sondern um die Spiegelung des Naturerlebens in der Seele eines empfindsamen Künstlers handle. Denn wer’ Wind- und Donnermaschinen in Bewegung setzt und Herdenglocken läuten läßt, der meint es so, wie es in der Partitur steht. Natürlich enthält das große Werk auch eine Reihe von rein musikalischen Einzelschönheiten. Aber das genügt nicht. Wir brauchen nicht mehr 12 Hörner, 2 Trompeten und 2 Posaunen — zusätzlich — in der Ferne, um zu erfahren, daß wir jetzt im Walde sind. In diesem Werk dokumentiert sich eine Kunstauffassung, die nicht mehr die unsere ist und die auch seinerzeit bei der Uraufführung 1915 keine Gültigkeit mehr hatte.
Auch Ottorino Respighi hat der Programmusik seinen’Tribut gezollt. Mit den vier symphonischen Impressionen der „Kirchenfenster“ ist ihm jedoch ein schönes, gültiges Werk gelungen, das dem Vorwurf angemessen ist und auch als reine Musik voll befriedigt. „Die Flucht aus Ägypten“, „Der Erzengel Michael", „Die Frühmette der heiligen Klara“ und „Sanctus Gregorius Magnus" heißen die vier Sätze, in welchen sich trotz strenger Stilisierung der klangfreudige Impressionist romanischer Herkunft nicht verleugnet. Zu diesem Werk mit seiner gregorianischen Melodik und dem kirchentönig gefärbten Moll, wie auch Pfitzner es liebt, brauchte es keinen Kommentar. Denn die kirchliche Sphäre ist in jedem Detail lebendig und spürbar. Die Wiener Symphoniker unter Karl Böhm boten eine heroische Leistung und blieben den Werken nichts schuldig. Ob es eine glückliche Idee war, den Zyklus „Die große Symphonie“ gerade mit dem Alpenpanorama von Strauß anfangen zu lassen, ist eine andere Frage. Jedenfalls war das Konzert lehrreich’ wie nur selten eines.
Auch die Aufführung des „P i e r r o t L u n a i r e“ von Schönberg durch die Accademia Filarmonica Romana und Annemarie Hegner als Rezitatorin möchten wir eher als ein Exem-plum und eine aufschlußreiche Demonstration denn als Kunstgenuß werten. Diese dreimal sieben Gedichte von Albert Giraud mit ihrer Mischung von Erotik und Mystik, Fin-de-siecle-Parfüm, Salon und Chanson entstammen einer Welt, in die aus der unseren keine Brücken mehr führen. „Ich liebe die hektischen, schlanken Narzissen mit blutrotem Mund“, deklamierte einst Felix Dörmann in seinen „Tuberosen“, und das war einmal dernier cri. — Es ist immerhin erstaunlich, daß ein Musiker vom Format Schönbergs noch 1912 an ein so zweifelhaftes literarisches Produkt wie Girauds Gedichte seine Arbeit verschwendete. Die entwicklungsgeschichtliche Bedeutung dieses Werkes mit seiner in die Zukunft weisenden Kammerbesetzung ist unbestritten. Doch ist es kein gutes Zeichen für die Gültigkeit dieser Musik, daß wir ihr heute ebenso fremd gegenüberstehen wie das Publikum vor 35 Jahren. Die Anzeichen mehren sich, daß Schönberg in seiner mittleren Phase — seine letzten Werke kennen wir noch nicht — auf einem toten Geleise rangierte. Sollte ein Großteil auch seiner Kompositionen einmal zu einer sensationsumwitterten, aber sehr kurzlebigen „Moderne von gestern“ gezählt werden?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!