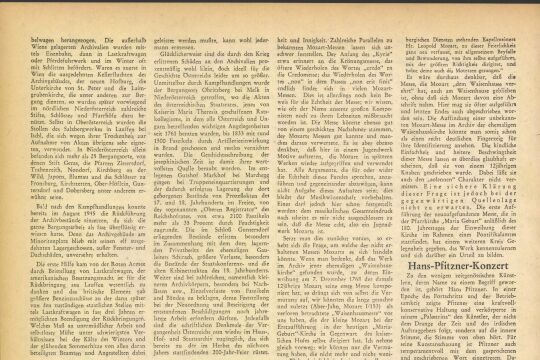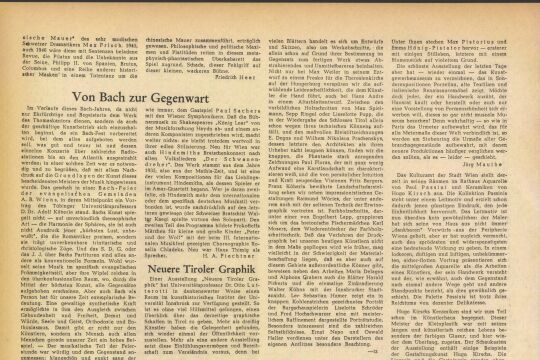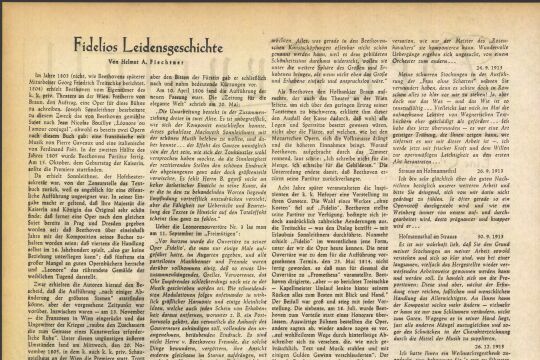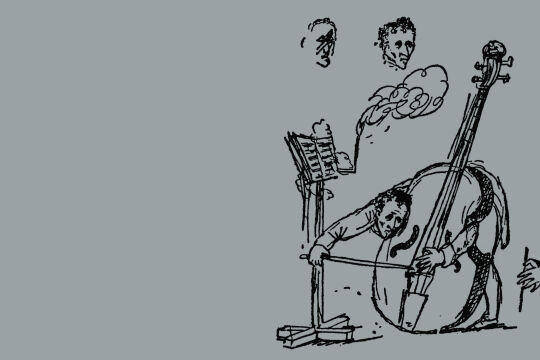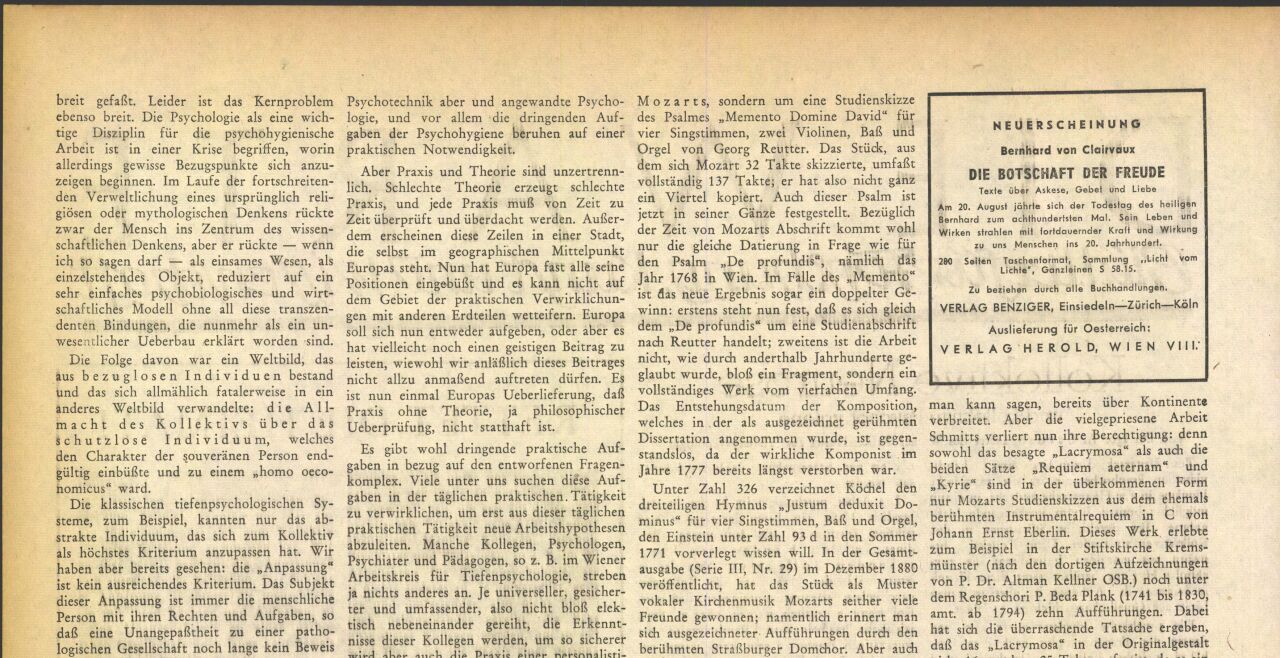
Das Leben und Schaffen großer Meister stellen sich viele Leute oft recht wirklich-keistfern vor. Wohl werden jedem Menschen gewisse Anlagen sozusagen in die Wiege gelegt, was namentlich bei künstlerischen Dispositionen von eminenter Bedeutung ist; aber auch sie müssen erst geweckt werden und können meist nur durch hingebungsvollen Fleiß zur Entfaltung gelangen. So mancher Kritiker oder Biograph würde vor Scham erröten, wenn ihm die Arbeitspensa bekannt wären, die das eine oder andere vielbewunderte Genie zu bewältigen hatte. Dabei wäre noch zu bedenken, daß wirkliche Künstler in ausgewogener Bescheidenheit sich zunächst überhaupt nur als Glieder des Schaffensprozesses ihrer Zeit gefühlt haben und daß sie darum in pietätvoller Weise an die Tradition anknüpfen mußten.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 bis 1791) hat in der kurzen Zeit seines Lebens nicht nur überdurchschnittlich viel geschaffen, er hat immer auch fleißig studiert und sich aus den Werken seiner Vorgänger und Zeitgenossen jene soliden Grundlagen erarbeitet, die ihn erst zum wahren Künstler befähigten.
Da befindet sich unter seinen Kirchenwerken der Psalm „De profundis“ für vier Singstimmen und Orgel, Köch.-Verz. 93, als dessen Entstehungszeit gewöhnlich die Jahre 1770 bis 1771 in Salzburg angenommen wurden. Diese Datierung beruht auf einer Approximativschätzung, welche sich seit dem 19. Jahrhundert eingebürgert hat. Ein Liniensystem des im British Museum (Add. Ms. 31.748/1) verwahrten Autographs ist für zwei Violinen freigelassen, wodurch Alfred Einstein in der dritten Auflage von Köcheis „Chronologisch-thematischem Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts“ (Breitkopf & Härtel, Leipzig 1937) zu der Bemerkung veranlaßt wurde: „ ... streng genommen gehört das Werk also nicht zu den vollendeten Kompositionen.“ Der Gelehrte hat aber noch weiter kombiniert: die Anlage entspreche genau einigen der Motetten von Eberlin und Michael Haydn, die sich Mozart im Frühjahr oder Sommer 1773 kopiert habe. Auf jeden Fall wurde das „De profundis“ zu allen Zeiten als Perle Mozartscher Kirchenmusik gewertet und wiederholt gedruckt, so bei Porro in Paris, bei Trautwein in Berlin, bei Litolff in Braunschweig und im Dezember 1880 in der kritisch durchgesehenen Gesamtausgabe der Werke Mozarts (Verlag Breitkopf & Härtel, Leipzig), Serie III, Nr. 19. Ja Alfred Einstein meint in der Mozart-Biographie (Hermann-Fischer-Verlag, Stockholm, 1947, Seite 435 f.) unter Hinweis auf das „De profundis“ von
Christoph Willibald Gluck (1714 bis 1787), der Knabe Mozart habe mit seiner Komposition das analoge Werk des alten Riesen weit geschlagen. In Wirklichkeit aber ist alles unrichtig, was da vermutet und behauptet wurde; das Mozartsche Manuskript ist nichts anderes als ein Continuo-Auszug des „De profundis“ von Georg Reutter (1708 bis 1772), das in voller Besetzung für vier Singstimmen, zwei Violinen, Baß und Orgel geschrieben ist und nun vollständig vorliegt. Diese Umstände machen auch die bisher unsichere Datierung von Mozarts Niederschrift eindeutig: sie kann nur im Jahre 1768 in Wien erfolgt sein, als der zwölfjährige Künstler mit seinen Eltern und seiner Schwester in der Kaiserstadt lebte und eine Reihe von Kirchenkompositionen für das von Pater Ignaz Parhamer (1715 bis 1786) geleitete Waisenhaus zu komponieren hatte. Damals mußte er sich unter Anleitung seines Vaters und wohlgesinnter Kunstfreunde in den Stil der Wiener Kirchenmusik hineinarbeiten, um Werke im Sinne des örtlich überkommenen Geschmacks schreiben zu können; und an erster Stelle der Wiener Kirchenkomponisten stand der später vielkritisierte, aber äußerst fruchtbare und einflußreiche Reutter, mit dem die Familie Mozart auch Fühlung hatte.
Aehnlich liegen die Dinge bei dem Fragment des Psalmes „Memento Domine David“ in F-dur (Andante, 3A). Constanze Mozart (1763 bis 1842) hat durch Schreiben vom 1. März 1800 der Firma Breitkopf 8c Härtel in Leipzig die vorgefundenen Musikfragmente ihres verewigten Gatten in Uebersicht bekanntgegeben. Unter Zahl IX der „Singmusik“ führt sie dabei an: „Ein unvollendeter Psalm: Memento domirie David, vierstimmig; 32 Tacte in F-dur.“ Auch bei Georg Nikolaus von Nissen (1765 bis 1826) wird die Skizze im Anhange der Mozart-Biographie (Leipzig, 1828, Seite 18) in ähnlicher Weise zitiert. Ludwig Ritter von Kochel (1800 bis 1877) hat das Stück im Anhange seines thematischen Verzeichnisses unter „Angefangene Werke“, Zahl 22, angegeben. In der Dissertation „Die Salzburger Mozartfragmente“ (Bonn, 1926) vermutet Mena Blaschitz aus stilistischen Gründen, daß die skizzierte Komposition im Jahre 1777 entstanden sei. Alfred Einstein hat die liturgische Zusammengehörigkeit mit dem „De profundis“ erkannt und aus diesem Grunde das Fragment in den Hauptteil des Verzeichnisses unter Zahl 93 a aufgenommen, wobei er die vermutliche Entstehungszeit mit „Sommer 1771“ angab. Mozarts Niederschrift befindet sich im Salzburger Mozarteum und umfaßt tatsächlich 32 Takte; das für die beiden Violinen vorgesehene System ist nicht beschrieben; es finden sich dort nur Andeutungen vor. Nun handelt es sich auch in diesem Fall um keine Komposition
Mozarts, sondern um eine Studienskizze des Psalmes „Memento Domine David“ für vier Singstimmen, zwei Violinen, Baß und Orgel von Georg Reutter. Das Stück, aus dem sich Mozart 32 Takte skizzierte, umfaßt vollständig 137 Takte; er hat also nicht ganz ein Viertel kopiert. Auch dieser Psalm ist jetzt in seiner Gänze festgestellt. Bezüglich der Zeit von Mozarts Abschrift kommt wohl nur die gleiche Datierung in Frage wie für den Psalm „De profundis“, nämlich das Jahr 1768 in Wien. Im Falle des „Memento“ ist das neue Ergebnis sogar ein doppelter Gewinn: erstens steht nun fest, daß es sich gleich dem „De profundis“ um eine Studienabschrift nach Reutter handelt; zweitens ist die Arbeit nicht, wie durch anderthalb Jahrhunderte geglaubt wurde, bloß ein Fragment, sondern ein vollständiges Werk vom vierfachen Umfang. Das Entstehungsdatum der Komposition, welches in der als ausgezeichnet gerühmten Dissertation angenommen wurde, ist gegenstandslos, da der wirkliche Komponist im Jahre 1777 bereits längst verstorben war.
Unter Zahl 326 verzeichnet Kochel den dreiteiligen Hymnus „Justum deduxit Dominus“ für vier Singstimmen, Baß und Orgel, den Einstein unter Zahl 93 d in den Sommer 1771 vorverlegt wissen will. In der Gesamtausgabe (Serie III, Nr. 29) im Dezember 1880 veröffentlicht, hat das Stück als Muster vokaler Kirchenmusik Mozarts seither viele Freunde gewonnen; namentlich erinnert man sich ausgezeichneter Aufführungen durch den berühmten Straßburger Domchor. Aber auch diese Komposition stammt nicht von Mozart, sondern ist auf Grund des überlieferten Manuskripts eine Studienabschrift des Offertoriums „pro Festo Confessoris“ von Johann Ernst Eberlin (1702 bis 1762). Das Werk ist instrumental besetzt und weist in der vollkommenen Gestalt nicht nur drei, sondern sogar vier Teile auf; denn an eigentlich zVeiter Stelle begegnet eine Sopran-Arie über den Text: „Exultate Filii Adae in hac Sancti gloria; hic defendit nos a clade in hac nostra victoria.“ Die Arie (G-dur, 4/4) umfaßt 33 Takte; um den Gesang des Soprans bewegen sich die Violinen in reicher Figura-tion. Mozart hat diese Partie in seinen Con-tinuoauszug überhaupt nicht aufgenommen, da sie ihm aus den Erwägungen musikalischer Satzkunde wahrscheinlich als unwesentlich erschien, zumal es sich dabei um Figuralmusik von ausgesprochen konventionellem Gepräge handelt.
Auf Mozarts Autograph des „Kyrie“ in C-dur, Köch.-Verz. 221 (= Köchel-Einstein 93 b), befinden sich noch zwei weitere Skizzen
von seiner Hand: ein 16 Takte umfassendes Sätzchen „Requiem aeternam“ (Köchel-Einstein 93 c, zweite Verzeichnung) und ein ebenfalls 16 Takte enthaltendes „Lacrymosa“ (Köch.-Verz., Anhang 21 = Köchel-Einstein 93 c). Die drei Stücke sind in vokaler Besetzung überliefert; ihre Vertonung durch Mozart hat die Musikwissenschaft an den Beginn der siebziger Jahre des 18. Jahrhunderts gesetzt. Das „Kyrie“ liegt in der Gesamtausgabe, Serie 24, Nr. 34 (Februar 1885), das „Lacrymosa“ in der gleichen Serie, Nr. 30 (ebenfalls Februar 1885), veröffentlicht vor. Eine geradezu berühmt gewordene Verwendung hat das „Lacrymosa“ erhalten: als Alois Schmitt (1827 bis 1902) im Jahre 1900 Mozarts große Messe in c-moll, Köch.-Verz. 427 (= Köchel-Einstein 417 a), die als Fragment auf uns gekommen ist, zu ergänzen suchte, instrumentierte er das weihevolle Sätzchen und verwendete es mit entsprechender Textunterlegung an Stelle des fehlenden „Crucifixus“. Schmitts Vollendung des Mozartschen Riesen torsos hat auch bei Breitkopf Sc Härtel in Leipzig Eingang gefunden und ist jetzt,
man kann sagen, bereits über Kontinente verbreitet. Aber die vielgepriesene Arbeit Schmitts verliert nun ihre Berechtigung: denn sowohl das besagte „Lacrymosa“ als auch die beiden Sätze „Requiem aeternam“ und „Kyrie“ sind in der überkommenen Form nur Mozarts Studienskizzen aus dem ehemals berühmten Instrumentalrequiem in C von Johann Ernst Eberlin. Dieses Werk erlebte zum Beispiel in der Stiftskirche Kremsmünster (nach den dortigen Aufzeichnungen von P. Dr. Altman Kellner OSB.) noch unter dem Regenschori P. Beda Plank (1741 bis 1830, amt. ab 1794) zehn Aufführungen. Dabei hat sich die überraschende Tatsache ergeben, daß das „Lacrymosa“ in der Originalgestalt nicht 16, sondern 25 Takte aufweist, da es ein neuntaktiges Orchestervorspiel enthält. Wenn Alois Schmitt d a s geahnt hätte! Mozart hat in allen Fällen nur einen Continuoauszug skizziert; ein Beweis dafür, daß er seine Studienarbeit auf der Grundlage des altehrwürdigen Generalbasses ausführte und durch den Partitureindruck des vokalen Stimmengeflechts die wahre Substanz echten Kirchenstiles zu begreifen suchte.
Wenn die dargestellten Sachverhalte auch nur einen ersten Schritt bedeuten können, den gesamten Kanon Mozartscher Werke von neuer Warte aus einer kritischen Beleuchtung zu unterwerfen, so erhellt aus den bisherigen Ergebnissen ganz sinnfällig, daß subtilstes Vorgehen künftig erforderlich sein wird, um auch in weiteren, nicht ganz gesicherten Fällen eine unverrückbare Basis für das Mozart-Bild zu gewinnen. Alfred Einstein hat im Verlaufe seiner weltberühmten Arbeit erklärt, er habe die ganze Problematik nicht vom Standpunkt des Kenners der Autographen, sondern von dem der Werke untersucht und gelöst. Er
hat damit auch die Mängel unbewußt zugegeben: denn über beiden Standpunkten muß der Forscher mit weitreichender Literaturkenntnis und objektiver Einfühlung walten und mit unbeirrbarer Akribie und Präzision an die Keimzelle eines jeden Schaffensprozesses lebensnah herangelangen. Er muß wissen, daß vor Entstehung eines Manuskripts, als dessen Blickkenner er aufzutreten hat, und vor dem zu analysierenden Werk die intuitive Absicht der schöpferischen Persönlichkeit liegt, die, wie in den nun erstmalig festgestellten Fällen, von reproduzierenden Studieninteressen geleitet sein kann.
Mozart hat kopiert! Er hat es getan, weil jede wahre Kunst auch eine formale Seite hat und auf den Errungenschaften der Tradition aufbauen muß; er hat es aber auch getan, weil er vorerst nichts anderes tun konnte und wollte als arbeiten und seine Pflicht erfüllen. So war er befähigt und begnadet, kraft seiner Anlagen und Vorzüge der Menschheit jene Werke zu schenken, die ein Quell der Läuterung und Erhebung bleiben, solange ein Funke wahren Menschentums auf Erden pulsiert.