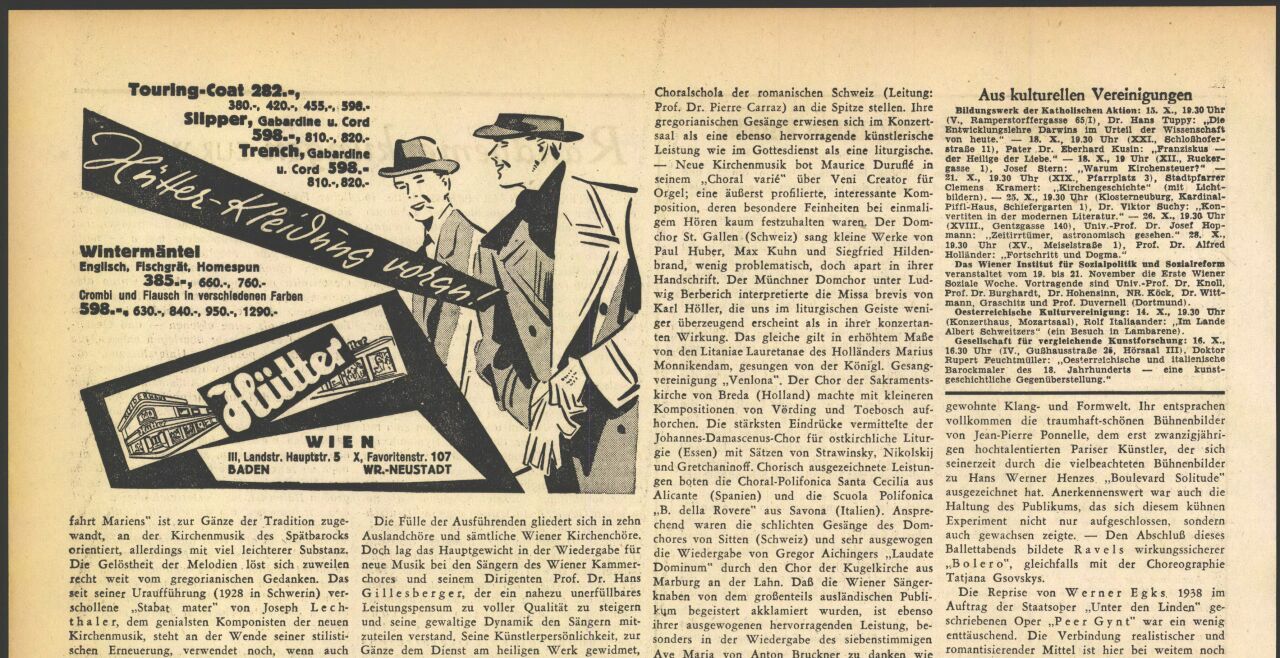
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Neue Wege des musikalischen Theaters
Berlin, Anfang Oktober
Der stürmische Flug München—Berlin, zweieinhalbtausend Meter über der Erde und einige hundert Meter über ausgedehnten Wolkenfeldern, war eine gute Vorbereitung für das Klima, das der Ankömmling am Ziel seiner Reise vorfindet und an das er sich zunächst gewöhnen muß. Denn schon wieder — oder immer noch — weht hier jene strenge geistige Luft, in der das Mittelmäßige erfriert und Kühnes, Neues gedeiht. Die besonderen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse Berlins sind so oft beschrieben und analysiert worden, daß wir unsere Aufmerksamkeit während eines einwöchigen Aufenthalts in erster Linie den künstlerischen Manifestationen zugewendet haben. Die Fülle der Veranstaltungen während der Berliner Festwochen zwingt den Besucher überdies dazu, sich auf bestimmte Gebiete zu beschränken. Denn außer den einheimischen Theatern und Orchestern beteiligten sich auch zahlreiche ausländische Ensembles an den Berliner Festwochen: die Glyndebourne Festival Opera mit Rossinis „La Cenerentola", das Grand Ballet du Marquis de Cuevas aus Monte Carlo, das von den Edinburger Festspielen bekannte Ensemble Tyrone Guthrie (mit „The Matchmaker" nach Nestroys ,(Einen Jux will er sich machen"), das Mailänder Teatro delle Novitä di prosą (mit einer Commedia dell’arte), die Gruppe Jean Soubeyran aus Düsseldorf und „Die Gaukler" aus Stuttgart mit modernen Pantomimen, das Wiener „Kaleidoskop" mit Büchners „Leonce und Lena" (leider ein Versager und eine Enttäuschung, die im nächsten Jahr womöglich durch ein Gastspiel des Burgtheaters ausgeglichen werden sollte), ferner gab es zahlreiche Solistenabende, von der Tanzmatinee des Japaners Yoshio Aoyama bis zu den Liederabenden von Souzay und Fischer-Dieskau.
Das Theater „Tribüne" zeigte drei Stücke, die schwer unter einen Nenner zu bringen sind, trotzdem sie Wesentliches gemeinsam haben und etwa als Ballettpantomimen bezeichnet werden können. („Die Vögel", eine Bearbeitung des Aristophanes durch Goethe in der Art der Commedia dell’arte mit einer originellen Musik von Klaus Jungk, Prokofieffs Märchen für Kinder und Erwachsene „Peter und der Wolf" und Igor Strawinskys „Renard" nach einer russischen Volkserzählung.) Im Programmheft der „Tribüne" wird der Grundgedanke nicht nur dieser drei Stücke, sondern auch der wuchtigsten und interessantesten übrigen Bühnenwerke der Berliner Festwochen ausgesprochen, nämlich: den Zusammenhang von
Musik, Bewegung und Wort erneut zu erproben.
Dies geschah auch — um mit den kleinen Formen zu beginnen — in dem „Bilderbogen aus Amerika”, den Ernst Josef Aufricht in der Komödie am Kurfürstendamm zeigte und der aus drei Ballett-Balladen von John La- touche besteht. Die Form, welche hier gefunden wurde, ist wirklich originell, wenn auch die Herkunft ihrer einzelnen Elemente aus den zwanziger Jahren deutlich ist. Nicht umsonst war Aufricht seit 1927 Leiter des Theaters am Schiffbauerdamm, der wichtigsten Versuchsbühne Berlins, von wo aus die „Dreigroschenoper" ihren Triumphzug durch die Welt angetreten hat. Wie dort, im „epischen Theater", werden Text, Musik und Tanz nicht zum Gesamtkunstwerk addiert, sondern behalten ihren Eigenwert. In keinem der drei Stücke gibt es Dialoge und nur ganz selten direkte Rede. Der Sänger und der Chor figurieren als Erzähler, während die direkte Wiedergabe der Handlung den Tänzern und den stummen Pantomimen überlassen ist. Die Musik von Jerome Moross, eine Art Zwölftonjazz, verrät ihre Herkunft vom amerikanischen Musical. Amerikanisch ist auch die naive Parodie bekannter „klassischer Motive" (Susanna und Märchen vom Rotkäppchen), welche das Kernstück, die Wunschbildillusionen eines Träumers, flankieren. Sehr bezeichnend ,für den aggressiven und kecken Geist dieser Produktion, daß George Grosz — seit mehr als zwanzig Jahren zum ersten Male wieder auftauchend — die Figurinen zu den drei Stücken schuf.
Einer der Höhepunkte der heurigen Berliner Festwochen wurde auf dem Gebiet des Balletts gesetzt: in einem großen Abend in der Städtischen Oper. Die beiden uraufgeführten Werke verdanken ihre Entstehung einem Kompositionsauftrag, der durch den von Gerhart von Westerman präsidierten Programmausschuß der Festwochen vergeben wurde und zu interessanten und erfreulichen Ergebnissen geführt hat. Freilich stand den beiden jungen Komponisten eine der erfahrensten und bedeutendsten Choreographinnen der Gegenwart zur Seite, T a t j a n a Gsovsky.
Zu ihrem Szenar, frei nach Maeterlinck, schrieb der 1917 in Oberfranken geborene und derzeit als Dozent an der Hochschule für Musik in Berlin tätige Max Baumann eine Musik, die aus der Sphäre des Impressionismus kommt, mit Glissandi der Streicher, langen Trillerketten der Bläser und dem Geläute der Röhrenglocken eine eigene Klangfarbe besitzt und sich zu intensiven Stimmungen verdichtet. Die bekannte Handlung von „Pellėas et Mėlisande" (bekanntlich auch von Debussy vertont) wird auf zwei Ebenen dargestellt: einer realen und einer symbolisch-seelischen, Besonders eindrucksvoll ist der in ein modernes Milieu transponierte Anfang des Stückes mit.seiner schwer definierbaren Stimmung lähmender Alltäglichkeit. Den eingeschobenen Visionen entspricht die — gleichfalls vom Original abweichende — Szene eines „Gerichtshofes", mit dem das Stück schließt. (In den Hauptpartien: Suse Freisser und Reinhard Köchermann als körperliche Gestalten, die bildschöne Gisela Deege und Gert Reinhold als seelische Gestalten.) Die Musik zum zweiten Ballett („Der rote Mantel" nach Garcia Lorca) schrieb der blutjunge Italiener Luigi Nono. Seine Partitur, die auf der Reihentechnik basiert, zeigt ein kaleidoskopisch wechselndes Klangbild, das zuweilen an Berg und Webern erinnert. Diese Partitur fordert von der Choreographin und von den Tänzern ein Höchstmaß von Musikalität, Konzentration und Einfühlungsvermögen in eine völlig neue und un-
gewohnte Klang- und Formwelt. Ihr entsprachen vollkommen die traumhaft-schönen Bühnenbilder von Jean-Pierre Ponnelle, dem erst zwanzigjährigen hochtalentierten Pariser Künstler, der sich seinerzeit durch die vielbeachteten Bühnenbilder zu Hans Werner Henzes „Boulevard Solitude" ausgezeichnet hat. Anerkennenswert war auch die Haltung des Publikums, das sich diesem kühnen Experiment nicht nur aufgeschlossen, sondern auch gewachsen zeigte. — Den Abschluß dieses Ballettabends bildete Ravels wirkungssicherer „Bo ler o", gleichfalls mit der Choreographie Tatjana Gsovskys.
Die Reprise von Werner Egks. 1938 im Auftrag der Staatsoper „Unter den Linden" geschriebenen Oper „Peer G y n t" war ein wenig enttäuschend. Die Verbindung realistischer und romantisierender Mittel ist hier bei weitem noch nicht so gut gelungen wie in Egks späteren Werken, etwa in „Circe" oder im „Abraxas”-Ballett. Ein wenig grob geriet auch die szenische und musikalische Realisierung.
Abschluß und Höhepunkt der Festwochen-Veran- staltungen bildete die deutsche Erstaufführung von Paul Claudels „Buch von Christoph Columbus" mit einer völlig neuen Musik von Darius Milhaud. Im Auftrag der Berliner Staatsoper hatten die beiden Autoren bereits vor etwa fünfundzwanzig Jahren ihre erste große Oper „Christophe Colombe" geschrieben, die unter Erich Kleiber uraufgeführt wurde. 1953 fand bei den Festspielen in Bordeaux die Uraufführung des Werkes mit der neuen, auf dreizehn Instrumente reduzierten Partitur Milhauds statt. Claudel begründet diese Neufassung mit der Abwandlung eines Wortes von Pascal („Dauernde Beredsamkeit ist langweilig"), indem er meint: dauernde Musik langweile ebenso wie dauernde Poesie. Das gelte vom Zuschauer und Zuhörer wie auch vom Schauspieler. Von Zeit zu Zeit müsse man wieder festen Boden unter den Füßen fühlen, um zu einem neuen Sprung ansetzen zu können. Das Stück ist aus dem Wunsch der beiden Autoren geboren, -weder für Auge noch Ohr eine Trennungswand zu akzeptieren. „Wir -wollten uns nicht mit einem fertigen Schauspiel abfinden, wir wollten vielmehr unsere Musik und unsere Vorstellung einer Dekoration aus uns herauslocken, um auf sie die magischen Wellen zu projizieren, die im Inneren des Zauberhauses, das uns für einige Zeit beherbergt, entstehen... Warum lassen wir nicht die Bilder, die durch Poesie und Klang beschworen werden, wie Rauch aus uns aufsteigen, damit sie sich einen Augenblick lang auf der Leinwand abzeichnen können, um, nach und nach verlöschend, anderen Traumbildern Platz zu machen?" Das gleiche gilt für die Musik, die nicht nur im Zustand der fertigen Ausführung, sondern gewissermaßen in ihrem Geburtszustand gezeigt werden soll, als das zum Klingen gebrachte Zauberbuch des Textes und der Partitur. Die Darbietung dieses Werkes stellt allerhöchste Anforderungen, nicht nur an das Können, sondern vor allem an die Phantasie aller Ausführenden. Das riesige Ensemble, bestehend aus etwa fünfzig auf der Bühne agierenden Personen nebst Gruppen von Tänzern und Tänzerinnen sowie einem großen Chor, erfordert die starke Hand eines zielbewußten Regisseurs. (Inszenierung: Hans Lietzau, Bühne und Kostüme: Leni Bauer-Escy; musikalische Leitung: Kairi Gorwin; Choreographie: Ilse Meudtner.) Auch bei dieser Aufführung war die Flaltung des Publikums in dem bis auf den letzten Platz gefüllten neuen Schiller-Theater bemerkenswert. Denn dieses barocke und mystische Weltgedicht um Christoph Columbus von dem großen katholischen Dichter Paul Claudel war hier gewissermaßen in ein etwas fremdes Milieu verpflanzt. Ob es als Ganzes und in seiner Grundhaltung verstanden und akzeptiert wurde oder ob es lediglich einen exotischen Reiz ausübte: die Wirkung war stark und der Beifall enthusiastisch.
Von den vielen Konzerten, die während der Festwochen stattfanden (unter Klemperer, Furtwängler, Karajan u. a.), war das weitaus interessanteste ein der „Berliner Musik des 2 0. Jahrhunderts" gewidmeter Abend des Berliner Philharmonischen Orchesters unter der Leitung von Richard Kraus. Man spielte Busonis Lustspielouvertüre, Schönbergs „Pierrot ,Lunaire" (mit Jeanne Hėricard), toris Blachers Klavierkonzert Nr. 1 (Solistin: Gerty Herzog), drei Songs aus Kurt Weills „Silbersee" und zum Abschluß Hindemiths Ouvertüre zu „Neues vom Tage". Alle diese Komponisten sind so wenig Berliner wie etwa Brahms, Hugo Wolf oder Gustav Mahler gebürtige Wiener waren. Aber sie konnten in dieser Stadt frei wirken und sich entfalten. Und von ihrem Schaffen sind Impulse ausgegangen, die das geistige Leben dieser Stadt immer aufs neue bestätigen und bezeugen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































