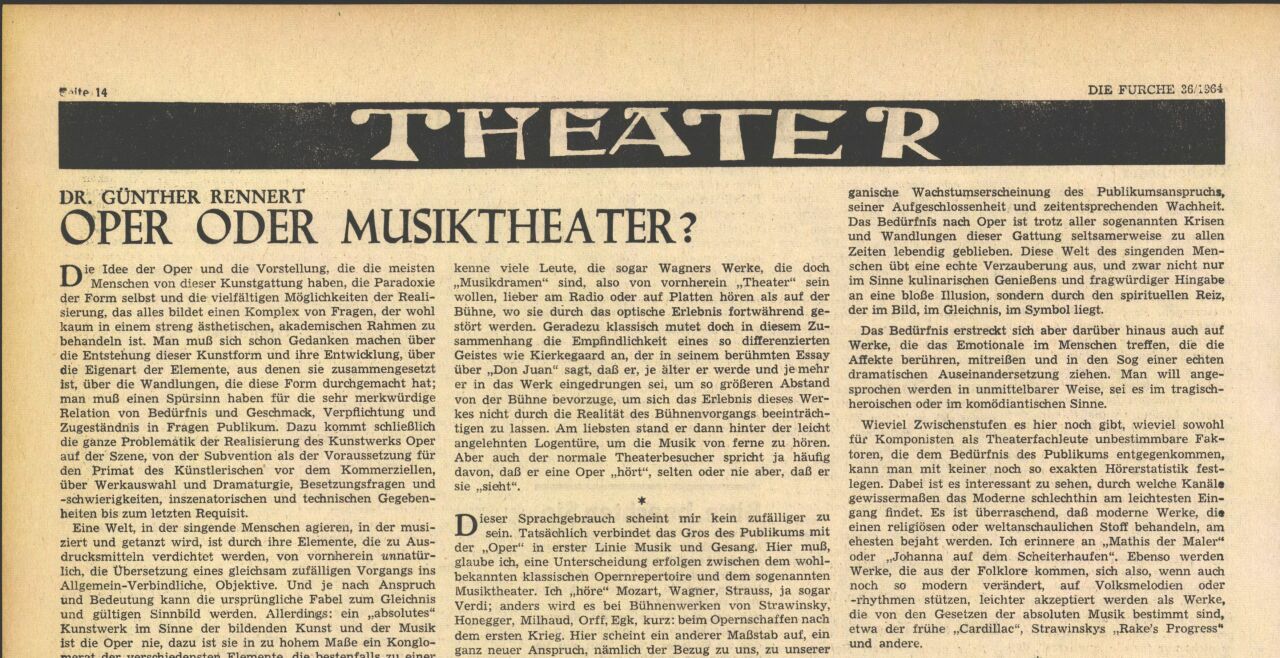
Die Idee der Oper und die Vorstellung, die die meisten Menschen von dieser Kunstgattung haben, die Paradoxie der Form selbst und die vielfältigen Möglichkeiten der Realisierung, das alles bildet einen Komplex von Fragen, der wohl kaum in einem streng ästhetischen, akademischen Rahmen zu behandeln ist. Man muß sich schon Gedanken machen über die Entstehung dieser Kunstform und ihre Entwicklung, über die Eigenart der Elemente, aus denen sie zusammengesetzt ist, über die Wandlungen, die diese Form durchgemacht hat; man muß einen Spürsinn haben für die sehr merkwürdige Relation von Bedürfnis und Geschmack, Verpflichtung und Zugeständnis in Fragen Publikum. Dazu kommt schließlich die ganze Problematik der Realisierung des Kunstwerks Oper auf der Szene, von der Subvention als der Voraussetzung für den Primat des Künstlerischen vor dem Kommerziellen, über Werkauswahl und Dramaturgie, Besetzungsfragen und -Schwierigkeiten, inszenatorischen und technischen Gegebenheiten bis zum letzten Requisit.
Eine Welt, in der singende Menschen agieren, in der musiziert und getanzt wird, ist durch ihre Elemente, die zu Ausdrucksmitteln verdichtet werden, von vornherein unnatürlich, die Übersetzung eines gleichsam zufälligen Vorgangs ins Allgemein-Verbindliche, Objektive. Und je nach Anspruch und Bedeutung kann die ursprüngliche Fabel zum Gleichnis und gültigen Sinnbild werden. Allerdings: ein „absolutes” Kunstwerk im Sinne der bildenden Kunst und der Musik ist die Oper nie, dazu ist sie in zu hohem Maße ein Konglomerat der verschiedensten Elemente, die bestenfalls zu einer Synthese geführt werden können. Aber welche hohen Reize, welche dynamischen Möglichkeiten liegen in diesen Elementen: der singenden Stimme, dem musikalisch deklamierten Wort, dem schauspielerischen Ausdruck, dem Orchesterklang, der Bewegung auf der Szene — vom einfachen Gang bis zum choreographisch durchgearbeiteten Tanz, dem Licht, der Farbe, dem Bild, dem Raum, schließlich dem Spannungsfeld innerhalb dieser Ausdrucksmittel!
Für uns hat sich der Schwerpunkt von der Oper auf das sogenannte Musiktheater verlagert. Das bedeutet a priori nicht etwa eine Abart der traditionellen Oper, eine neue Form, es bedeutet eigentlich nur, daß der Standort gewechselt hat und daß man das, was auf der Bühne geschieht, neu sieht, neu empfindet, neu gestaltet. Daß der „Figaro” zum Beispiel nicht eine heiter-unverbindliche Rokoko-Oper ist, sondern eine ernste, menschliche Komödie — die uns Heutige durchaus angeht. Wenn also „Musiktheater” zunächst ein neuer Blickpunkt war aus unserer Geisteshaltung heraus, und zwar auf die moderne, vom Schauspiel bereits entwickelte Szene, so bildeten sich bei den zeitgenössischen Komponisten Formen aus, die diesem neuen Gefühl für musikalisches Theater entspringen.. Mancher neue Gesichtspunkt ist dadurch gewonnen worden, v’dr allem die’’Hin- wendung zum literarischen Text. Debussys „Pellėas et Mėlisande” z. B. stellt, obwohl dieses Werk musikalische Elemente der Wagnerschen Tonsprache übernimmt, eine Abkehr von Wagner dar. Der Akzent liegt nicht mehr im Dramatischen, sondern im Atmosphärischen und in der seelischen Differenzierung. Das lyrische Drama Maeterlincks bildete die Grundlage dieser ersten neuen Oper.
Strauss folgte mit der Vertonung von Oscar Wildes „Salome”. Später stand ihm Hofmannsthal als Dichter zur Seite und gab den geistigen Grund- und Aufriß, den die Musik nur auszufüllen brauchte. Es ist bekannt, daß Alban Berg Texte von Büchner und Wedekind vertonte, daß Cocteau für Strawinsky und Honegger schrieb, ebenso wie Claudel für Honegger und Milhaud. Von Einem entschied sich für Büchner, Kafka und Nestroy. Und von den Komponisten, die sich ihre Texte selbst schreiben (Krenek, Orff, Egk) weiß man, auf welch hohem literarischen Niveau sie größtenteils stehen. Orffs für das moderne Musiktheater geschaffenes Werk z. B. greift mit „Antigonae” und „König Oedipus” auf die antike Tragödie zurück, mit der „Klugen” und dem „Mond” auf das Rüpelspiel und das deutsche Märchen. In „Carmina burana”, „Catulli carmina” und „Trionfo di Afrodite” bezieht er aber auch lateinische, griechische Liebeslyrik und mittelalterliche Vagantenpoesie ein.
Hier haben wir Werke, die Orff mit einer großartig elementaren und zugleich vergeistigten Theaterphantasie als neue, durchaus maßstäbliche Formen des Musiktheaters hinstellt. Aber diese Formen, vor allem eben die szenische Kantate, die komödiantischen Spiele und die antike Tragödie, sind nicht die einzigen. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von Werken, die den Vorwurf der Unfruchtbarkeit und Stagnation der Oper, der heute manchmal von berufener und unberufener Seite erhoben wird, durchaus widerlegen. Vom szenischen Oratorium — ich erinnere nur an Strawinskys „Oedipus Rex”, wo der Chor, und an Honeggers „Johanna auf dem Scheiterhaufen”, wo dazu auch noch der Tanz als wesentliche Faktoren einbezogen werden — bis zum Musical amerikanischer Herkunft umfaßt das heutige Musiktheater eine sehr differenzierte Fülle von Möglichkeiten. Die Elemente des Szenischen, Literarischen, Komödiantischen, Tänzerischen erhalten neben dem Musikalischen eine neue, wenn auch unterschiedlich hervortretende Bedeutung.
Aber hiermit sind wir schon mitten im Fragenkomplex „Oper und Gegenwart”. Es liegt wohl im Wesen dieser Kunstform, daß sie von jeher in ihrer Paradoxität, ihrem offenbaren Widersinn, ihrer absoluten Künstlichkeit ein ausgesprochener Luxusartikel gewesen ist. Erst das 20. Jahrhundert ist mit dem Meißel der Vernunft der Oper zu Leibe gerückt, hat sie sozusagen rationalisiert und versucht, ihr über den bisherigen Rahmen hinaus eine Bedeutung zu geben, einen Anspruch an Inhalt und Aussage und ihr dementsprechend ein Publikum zuzudiktieren, das von ihr mehr verlangt als nur reinen Ohrenschmaus und den Genuß einer mehr oder weniger in Musik gesetzten bekannten „story”. Ich kenne viele Leute, die sogar Wagners Werke, die doch „Musikdramen” sind, also von vornherein „Theater” sein wollen, lieber am Radio oder auf Platten hören als auf der Bühne, wo sie durch das optische Erlebnis fortwährend gestört werden. Geradezu klassisch mutet doch in diesem Zusammenhang die Empfindlichkeit eines so differenzierten Geistes wie Kierkegaard an, der in seinem berühmten Essay über „Don Juan” sagt, daß er, je älter er werde und je mehr er in das Werk eingedrungen sei, um so größeren Abstand von der Bühne bevorzuge, um sich das Erlebnis dieses Werkes nicht durch die Realität des Bühnenvorgangs beeinträchtigen zu lassen. Am liebsten stand er dann hinter der leicht angelehnten Logentüre, um die Musik von ferne zu hören. Aber auch der normale Theaterbesucher spricht ja häufig davon, daß er eine Oper „hört”, selten oder nie aber, daß er sie „sieht”.
Dieser Sprachgebrauch scheint mir kein zufälliger zu sein. Tatsächlich verbindet das Gros des Publikums mit der „Oper” in erster Linie Musik und Gesang. Hier muß, glaube ich, eine Unterscheidung erfolgen zwischen dem wohl- bekannten klassischen Opernrepertoire und dem sogenannten Musiktheater. Ich „höre” Mozart, Wagner, Strauss, ja sogar Verdi; anders wird es bei Bühnenwerken von Strawinsky, Honegger, Milhaud, Orff, Egk, kurz: beim Opernschaffen nach dem ersten Krieg. Hier scheint ein anderer Maßstab auf, ein ganz neuer Anspruch, nämlich der Bezug zu uns, zu unserer Zeit. Jenseits aller rein kompositorischen Belange wird in verstärkter Form die geistig-künstlerische Konzeption eines Werkes, nämlich die Frage nach der Qualität des Librettos, wichtig. Keine noch so schöne Musik kann heute einen schlechten Text retten. Es muß kein literarischer, kein dichterischer Text sein, aber er muß eine Diktion haben und wert sein, durch die Musik überhöht, wenn möglich zum Gleichnis verwandelt zu werden. Man denke an Oscar Wildes „Salome”, an Hofmannsthals „Rosenkavalier”, Johnson-Stefan Zweigs „Schweigsame Frau”, an Büchners „Wozzeck”, an Claudels „Johanna auf dem Scheiterhaufen”, an Cocteaus „Oedipe”.
Hier betreten wir die Ebene des Musiktheaters, und da ist aufs neue die Frage des Publikums, des echten Bedarfs, des Erfolges aufzuwerfen. Doch die Größe X, das Publikum nämlich, setzt sich ja aus unendlich vielen Mentalitäten zusammen, von denen jede eine andere Kapazität des Hörens, Sehens und Denkens mitbringt. Und doch steht das Theater in einem ganz anderen Maße als beispielsweise die bildenden Künste und die absolute Musik in einer ständigen Relation zum Publikum, fragt das Theater ständig nach dem Sinn und der Notwendigkeit seiner Existenz. Zwar ist es, Gott sei Dank, nicht so, daß die modernen Komponisten das anbįęteo, wonach gefragt wird, und auch die Theater werden es nur bedingt und mit künstlerischem Verantwortungsbewußtsein tun. Bei einer Umfrage würde zweifellos der größte Teil des Publikums die klassische und romantische Oper, das Wag- nersche Musikdrama und die komische Oper wählen. Aber auch Strauss, der noch vor 30 Jahren als Neutöner angefeindet wurde, würde auf eine bedeutende Gemeinde zählen können. Selbst Orff und Egk haben heute schon eine gewisse Breitenwirkung — und in einer packenden Aufführung kann auch ein Strawinsky-Abend mit „König Oedipus”, der „Geschichte vom Soldaten” und dem „Renard” ausverkaufte Häuser bringen.
Das Phänomen eines solchen Erfolges ist weniger eine Frage des Kampfes der zeitgenössischen Oper um ihr Publikum, sondern eine ganz selbstverständliche, ja or ganische Wachsturnserscheinung des Publikumsanspruchs, seiner Aufgeschlossenheit und zeitentsprechenden Wachheit. Das Bedürfnis nach Oper ist trotz aller sogenannten Krisen und Wandlungen dieser Gattung seltsamerweise zu allen Zeiten lebendig geblieben. Diese Welt des singenden Menschen übt eine echte Verzauberung aus, und zwar nicht nur im Sinne kulinarischen Genießens und fragwürdiger Hingabe an eine bloße Illusion, sondern durch den spirituellen Reiz, der im Bild, im Gleichnis, im Symbol liegt.
Das Bedürfnis erstredet sich aber darüber hinaus auch auf Werke, die das Emotionale im Menschen treffen, die die Affekte berühren, mitreißen und in den Sog einer echten dramatischen Auseinandersetzung ziehen. Man will angesprochen werden in unmittelbarer Weise, sei es im tragisch- heroischen oder im komödiantischen Sinne.
Wieviel Zwischenstufen es hier noch gibt, wieviel sowohl für Komponisten als Theaterfachleute unbestimmbare Faktoren, die dem Bedürfnis des Publikums entgegenkommen, kann man mit keiner noch so exakten Hörerstatistik festlegen. Dabei ist es interessant zu sehen, durch welche Kanal gewissermaßen das Moderne schlechthin am leichtesten Eingang findet. Es ist überraschend, daß moderne Werke, di einen religiösen oder weltanschaulichen Stoff behandeln, am ehesten bejaht werden. Ich erinnere an „Mathis der Maler” oder „Johanna auf dem Scheiterhaufen”. Ebenso werden Werke, die aus der Folklore kommen, sich also, wenn auch noch so modern verändert, auf Volksmelodien oder -rhythmen stützen, leichter akzeptiert werden als Werke, die von den Gesetzen der absoluten Musik bestimmt sind, etwa der frühe „Cardillac”, Strawinskys „Rake’s Progress und andere.
Bei alldem ist eines sicher: das Interesse wird heute bei der Oper sehr vom Szenischen, das heißt vom Optischen, mitbestimmt, und wir müssen als Regisseure und Theaterleiter auf dieses Bedürfnis Rücksicht nehmen. Im übrigen gilt es aber, sich frei zu machen von den allzu servilen Bindungen an den Publikumsgeschmack, der, wie wir wissen, sehr oft von Publicity und Mode bestimmt wird. Garcia Lorca sagt einmal: „Das Theater muß sich beim Publikum durchsetzen und nicht das Publikum beim Theater. Um das zu erreichen, haben sich Autor und Darsteller eine große Autorität anzueignen, koste es, was es wolle.”
Natürlich war die Oper immer gebunden an gewisse Schichten, nur daß es zu allen Zeiten andere waren. Zu Beginn — um 1600 — war es eine dünne Schicht ästhetischer Literaten. Die erste venezianische Oper um 1650 war eine reine Volksoper, die alle Schichten erfaßte. Im Wien Leopolds I. war es die höfische Schicht, die die Oper trug, etwas später in Hamburg war es das gebildete Bürgertum, das sich 1678 die erste stehende deutsche Oper baute usw. Das heutige Publikum, das — soziologisch gesehen — aus allen Schichten besteht, findet,, wie schon gesagt, sein Spiegelbild in der Verschiedenartigkeit des Spielplans. Es ist ein altes Vorurteil, daß die Oper notwendigerweise immer gegenwartsfern und traditionsverhaftet sei, daß sie — da angesiedelt im Niemandsland zwischen Trauminsel und Klangrausch — eigentlich gar keine rechte Beziehung zu einer wie auch immer gearteten geistigen Realität habe. Überall ist eine Umschichtung zu spüren. Ein Teil der Leute, die heute in die Oper gehen, dachte früher nicht daran. Radio, Schallplatten, die Volksbildungsbewegung haben großen Anteil an dieser Wandlung. Eine eindeutige Aufgeschlossenheit ist festzustellen. Wie Ausstellungen von Picasso, Chagall und Klee überfüllt sind, wie es überall Vereinigungen und Veranstaltungen für Neue Musik gibt, so gewinnt auch der unpopuläre Spielplan an Publikum. — Bei interessanten Werken und interessanten Inszenierungen geht auch der Kreis in die Oper, der sich sonst im Schauspiel bei Sartre und Elioit, bei Giraudoux und Brecht trifft.



































































































