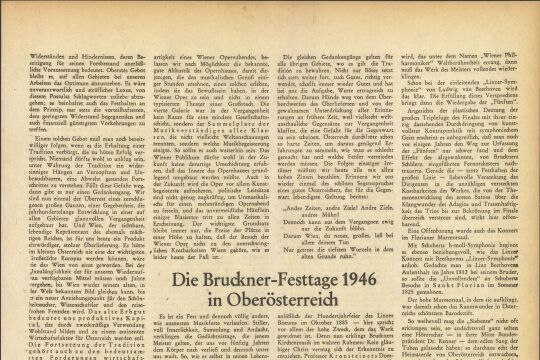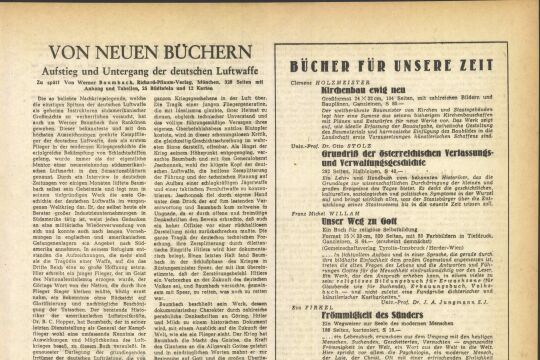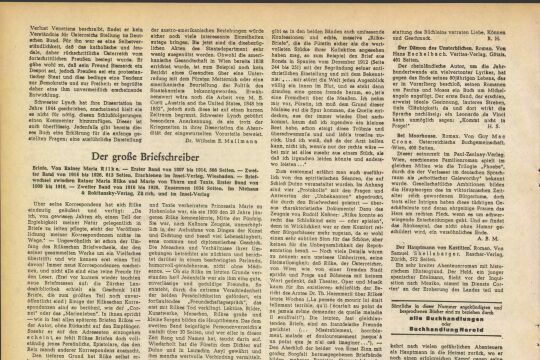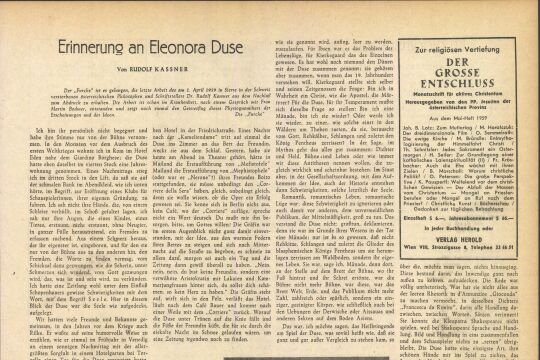Die schicksalhafte Parallele vom Leben und Schaffen des Dichters Rainer Maria Rilke ist ebenso eine Tatsache wie der schicksalhafte Einfluß der bildenden Kunst auf dieses Schaffen, das von Anfang an in einem unbeirrbaren organischen Wachstum begriffen, in steiler Kurve seiner Höhe zugeht und damit auch abklingt, ohne herabzusinken. Nach den ersten, für den Dichter später höchst unbefriedigenden dichterischen Ergebnissen gelangte dieser in die Malerkolonie Worpswede, in der er durch das Medium der Malerei zur Gestaltung der Landschaft in seiner Diditung kommt. Mit einer Intensität sondergleichen beschreibt er in dem längst vergriffenen Werk über die Worpsweder Maler, das ein Auftrag des Verlages Velhagen und Kissing für ihn war, deren Bildgestaltungen und daneben seine immer enger werdende Bindung zur Landschaft, zu dem großen, offenen Himmel, der sich wie eine Glasglocke über der Ebene wölbt, wie zur Natur überhaupt. Rilke beginnt bewußt mit dem Pinsel ausgeführte Bildinhalte nachzuformen und zu Ende zu denken. Noch spricht er in seinem Gedicht die Natur selbst nicht unmittelbar an, noch kann er besser aussagen, was ein anderer aus einem anderen Formgefühl heraus gestaltet hat, noch ist er nicht frei geworden für das eigene Gedicht, für den eigenen sublimen und ausgeprägten Sprachklang seiner mittleren und späten Dichtung. Als er 1902, wieder einem Auftrag eines deutschen Verlages folgend, zu dem Bildhauer Auguste Rodin nach Paris ging, war das Erlebnis Worpswede längst abgeschlossen und wurde fast unwillig zur Seite geschoben. Er hatte das Empfinden, innerlich zerstört zu sein, nicht gesammelt genug, um die ihm einzig entsprechende Form seines Gedichtes zu finden.
Schon 1901 war in ihm der Plan aufgetaucht, zu Rodin zu gehen, weil er durch seine Gattin, die heute noch schaffende Bildhauerin Clara Westhoff, die einige Zeit bei dem französischen Bildhauer gearbeitet hatte, die Anregung dazu bekam. Richard Muther, der bekannte deutsche Kunsthistoriker, veranlaßte ihn schließlich, für die von ihm herausgegebenen „Monographien der Kunst“ eine solche über Rodin zu schreiben. Noch bevor Rilke Rodin begegnet war, schrieb er an diesen, überwältigt von dem Eindruck seiner Skulpturen: „Ihre Kunst ist so groß (ich habe das seit langem gefühlt), daß sie Brot und Gold den Malern, den Dichtern, den Bildhauern, ja all denjenigen Künstlern zu geben vermag, die nichts anderes wollen als diesen Strahl der Ewigkeit, der das letzte Ziel des schöpferischen Lebens ist.“
So hatte Rilke, schon bevor er dem Bildhauer persönlich begegnete, sich diesem mit Leib und Seele verschworen. Dafür war noch ein anderes maßgeblich: der dänische Dichter Jens Peter Jacobsen war gestorben. In ihm wollte Rilke seinen Lehrmeister suchen. Als er erfahren hatte, daß dieser tot war, wandte er seine ganze schöpferische Intensität Auguste Rodin zu. Die ersten Tage in Meudon bei Paris, wo er Rodin in dessen engstem Schaffensbereich antraf, waren für ihn eine Erschütterung sondergleichen. Und die Briefe aus den Jahren 1902 bis 1906 sind erfüllt von innerem Glück und einer unerschütterlichen Begeisterung für jedes Detail im Hause Rodin. Rilke glaubt zuerst, von dem Bildhauer Lebens- und Schaffensregel erhalten zu haben, weil dieser ihm riet, nach seinem Beispiel unaufhörlich und mit der gleichen Intensität, wie er es tat, zu arbeiten. Rilke griff diesen Gedanken bereitwilligst auf, bevor er die wesentliche Unterschiedlichkeit in der Schaffensmethode beider Künste, der Dichtkunst und der Bildhauerei, vollkommen übersah. Ihm fehlte zu dieser Zeit
jeder Abstand und jede Objektivität dafür. Wieder bekennt er aus seiner stürmischen Ergriffenheit im September 1902: „Ich bin nicht allein darum gekommen, um eine Studie zu machen. ... Ich komme, um Sie zu fragen: Wie muß man leben? Und Sic haben mir geantwortet: Indem man arbeitet. . ..“
Da er nun Rodin hatte, glaubte Rilke, daß alles für ihn geregelt sei, daß er nicht wie vorher unter dem langen Aussetzen der Inspiration leiden müsse, sondern daß er diese allein durch seine regelmäßige Arbeit herbeizwingen könne. Aber nur allzu bald sah er sich, wie das nicht anders zu erwarten war, neuen Hemmungen und Abhaltungen in der geplanten Arbeit gegenüber. Unruhe ergriff ihn. Mitte März 1903 flieht er aus Paris nach Italien und schreibt von dort an die Freundin, die Schriftstellerin Ellen Key: „ . .. solle man sich vielleicht zu einem ruhigen Handwerk retten und nicht bange sein, um das, was an Frucht tief in einem reift, hinter allem Rühren und Regen?“ Er atmet in Italien von einem großen Druck, dessen Ursache er damals noch nicht erkannte, befreit auf. Die neue Umgebung, das Baden im Meer geben ihm frische Lebensimpulse.
Trotzdem ist der Begriff Rodin von. seinem Leben, seinem ganzen Tun und Lassen, seiner Arbeit vor allem, nicht mehr loszulösen. Wieder sucht er sich aus dem Schaffen des Bildhauers eine neue Regel zu bilden. Nicht im bildhauerlichen Umgestalten seines Schaffens, aber in der inneren Anordnung des künstlerischen Prozesses; nicht bilden müsse er lernen von ihm, aber tiefes Gesammeltsein um des Bildes willen. Er quält sich unsäglich und sucht nun schließlich genau wie Rodin nach einem geradezu manuellen Werkzeug für seine Arbeit. (Brief an Lou Andreas Salome, 1903): „. . . dazu tut es mir so furchtbar not, das Werkzeug meiner Kunst zu finden, den Hammer, meinen Hammer, daß er Herr werde und wachse über alle Geräusche. Es muß ein Handwerk stehen, auch unter dieser Kunst, eine treue tägliche Arbeit, die alles verwendet, muß doch auch hier möglich sein! ... Irgendwie muß auch ich dazukommen, Dinge zu machen, nicht plastische, geschriebene Dinge — Wirklichkeiten, die aus dem Handwerk hervorgehen. . . .“ Obwohl er zu dieser Zeit noch ganz im Unbewußten schwebte, begannen sich im Dichter leise Zweifel zu regen. Er konnte im Dichterischen die Entsprechung für das handwerklich Bildhauerische nicht finden. Erst viel später sah er die Unmöglichkeit
seines hartnäckigen Vorhabens ein. Damals aber ließ er lange nicht davon ab, sie möglich zu machen und den Schlüssel für die Erfüllung seines Wunsches zu finden. In dem gleichen Brief an Lou Andreas Salome fragt er ah anderer Stelle: „Liegt das Handwerk vielleicht in der Sprache selbst, in einem besseren Erkennen ihres inneren Lebens und Wollens, ihrer Entwicklung und Vergangenheit? (Das große Grimmsche Wörterbuch, welches ich einmal in Paris sah, brachte mich auf diese Möglichkeit).“ Und er beginnt wirklich im Grimmschen Wörterbuch zu lesen (1904). Auch sucht er in den Dichtern des frühen und späten Mittelalters neues Brauchbares für seine
Arbeit zu finden, stets bemüht, sein Wissen zu vertiefen und seinen Gesichtskreis zu erweitern.
Die Bewunderung Rilkes für Rodin nahm kein Ende, und mit dieser und dem Nicht-finden der vermeintlichen Formel setzt die Unruhe von neuem bei ihm ein. Er reist nach Rom, er reist nach Kopenhagen, aber wo immer er sich befindet, zieht ihn der Magnet Rodin nach Paris. Am 22. Juni dieses Jahres sdireibt er an den Meister: „Ihr Werk ist die Heimat für uns, das Geburtsland. ...“ Um sich zu einem regelmäßigen Arbeitsvorgang zu zwingen, den ihm sein Vorbild auferlegt, entwirft Rilke Arbeitsprogramme; aber die Arbeit gerät wieder ins Stocken. Es fehlen Bindeglieder, um das Vorhandene, das Vorbereitete zu ordnen und vor allem, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. Nach neuen, ergebnislosen
Reisen kreuz und quer durch Deutschland im Jahre 1905 landet Rilke wieder bei dem Bildhauer, dessen unbezahlter Privatsekretär er nun wurde. Im Dezember dieses Jahres erscheint er endlich innerlich gesammelt, ruhiger geworden und voll Zuversicht: „Leben, Geduld haben, arbeiten und keinen Anlaß zur Freude versäumen.“ Es gelingt ihm, einige Umarbeitungen fertigzustellen: Neufassungen der „Weise von Liebe und Tod“, der „Frühen Gedichte“, einige Stücke des 1902 entstandenen „Buches der Bilder“. Aber zu richtiger innerer Einkehr und zu jenem letzten inneren Konzentriertsein auf sein Werk kommt er auch jetzt nicht. Eine fremde, unbezahlte, unfrucht-
bare und mechanische Arbeitspflicht, die er sich auferlegt hat, läßt ihn nicht dazu gelangen: „Erdrückt von den Korrespondenzen, die ich tun muß, und abgelenkt von mir durch das fortwährende Qui vive meines Postens, durch dieses nie innerlich Alleinseinkönnen.“ (April 1906.) Rodin hatte ihn in vollkommen ausnützerischer Art, die ihm einmal eigen war, zu seinem Kanzleischreiber degradiert, ohne daß er ihm dafür das geringste Entgelt zukommen ließ.
Ein geringfügiges Mißverständnis zwischen Rilke und dem Bildhauer veranlaßte diesen dazu, den Dichter wie einen betrügerischen Dienstboten hinauszujagen. Damals wagte es Rilke daz einzige Mal während seiner engen Verbundenheit mit Rodin, seinem angebeteten Meister die Wahrheit ins Gesidit zu sagen. Er erinnerte daran, daß Rodin ihn als Freund gebeten hatte, ihm zu helfen: „Sie werden mir ein bißchen helfen; das wird Ihnen nicht viel Zeit nehmen. Zwei Strunden jeden Morgen. Das waren Ihre Worte“, ruft ihm Rilke aufgeregt, ja das erstemal aufgebracht, am 12. Mai 1906 in einem Brief entgegen. Und weiter: „Auch habe ich nie gezögert, Ihnen an Stelle von zwei Stunden fast meine ganze Zeit und meine ganzen Kräfte (leider habe ich davon nicht zu viele) während sechs Monaten zu schenken. Meine eigenen Arbeiten sind seit langer Zeit im Rückstand geblieben; aber wie glücklich war ich trotzdem, Ihnen dienen zu dürfen, ein wenig die Voreingenommenheit zu verringern, die ihre wertvollen Anstrengungen störten.“ Rilke verweist in diesem Brief weiter darauf, wie er Rodin nur langsam näherzukommen wagte, in dem alleinigen Bestreben, ihm einmal ausgiebig helfen zu können. Der Grund für dieses Zerwürfnis war ein mehr als lächerlicher und kleinlicher nach außen hin. Wie so oft hatte Rilke einen Brief an Rodin geöffnet und dem Bildhauer vom Inhalt Mitteilung gemacht, worin dieser plötzlich und ganz unvermittelt einen Vertrauens-brudi sah. Dazu handelte es sich um ein höchst nebensächliches Schreiben. Der
tiefere Grund für diesen Bruch lag auch teils in einer äußerlich körperlichen, teils in einer großen seelischen Gegensätzlichkeit der beiden Künstler. Dem brutalen, männlich ausgeprägten Bildhauer war der feinnervige, weiche und ihm so ganz ergebene Dichter langsam widerwärtig geworden. Ein geringfügiger Anlaß bradite den Vulkan Rodin zum Ausbruch. Rilke sagte dem Bildhauer erstaunlich offen, daß er dadurch tief verwundet sei.
Wieder suchte Rilke einen Entschuldigungsgrund für die ungebotene Handlungsweise seines Meisters und gab sich am Schluß des tragisch anmutenden Briefes der Zuversicht hin, daß die Gerechtigkeit diesen Mißklang früher oder später ausgleichen würde. Die Trennung von Rodin dauerte nun ein. Jahr und erwies sich als äußerst fruchtbar für den Dichter. In der Einsamkeit, in dem Sichselbst-Überlassensein erschloß sich ihm die einzige Möglichkeit für die dichterische Tat, was er jetzt selbst unverschleiert erkennt. Wieder reist er nadi Italien, wo er die begonnenen Umarbeitungen vollendete, und schrieb hier in einem Brief vom Dezember 1906 die be-zekhnenden Worte: „Mein Inneres war dodi monatelang ausgerenkt, merk ich, und das Alleinsein stellt zunächst nur eine Art seelischen Gipsverband dar, in dem etwas heilt.“ Im gleichen Monat hält er eine ihm selbst voll entsprediende erweiterte Neuausgabe seines „Buches der Bilder“ in Händen.
1907 freut sich der Dichter über das glänzende Gelingen der Übertragung der berühmten „Sonette aus dem Portugiesischen“. Er fühlt, daß er nun wieder ein Stück vorwärtsgekommen ist uifti daß diese neue Schöpfung eine „Stelle in seiner Entwicklung“ einnehmen wird.
Im Sommer 1907 zieht es Rilke neuerdings zu Rodin. Am 14. Juli teilt er seiner Fravi mit, daß seine Rodin-Arbeit (der zweite Teil des Rodin-Buches, ein Vortrag) fertig sei. Mit dem vollendeten Vortrag reiste er wie ein Herold durch alle großen deutsdien Städte, um dem Namen des Meisters den gebührenden Klang zu verschaffen. Als er im November des Jahres bei Rodin eintraf, hatte er eine neue Sammlung von Versen, die unter dem Titel „Die neuen Gedichte“ herauskam, in Händen, denen bald darauf der dem Bildhauer gewidmete zweite Teil folgen sollte. Diese Gedichte tragen nicht umsonst den Titel „Neue Gedichte“, denn in ihnen gewann die neue Versform in Inhalt und Sprache gewaltigen Ausdruck. Rilke hatte seine Gedichte wie Plastiken scharf umgrenzt hingesetzt; kein weicher musikalischer Klang war mehr vorzufinden. Eine harte, äußerst bildhafte und klar abgrenzende Sprache machte diesem Platz. Der „Archaische Torso Apolls“, der am Beginn der „Neuen Gedichte“ steht, hob wie die Fanfare einer neuen Zeit an. Diese Gedicht-hände enthalten so wunderbar verinnerlichte Impressionen (Rodin und Rilke waren zu dieser Zeit im ausklingenden französischen Impressionismus nur scheinbar beheimatet, da ihre Werke unter der Schale der Impression die äußerste seelische Konzentration des Dargestellten beweisen), wie den „Panther“, die „blaue und die rote Hortensie“, „Das Karussell“ oder „Die Flamingos“.
Die freien Gedichtformen, die Rilke bis zu diesen zwei Gedichtbänden bevorzugt hatte, treten hinter den althergebrachten, vor allem dem nun sehr bevorzugten Sonett zurück. Auch hier macht sich die ungeheure Strenge der sprachlichen Kraft bemerkbar, i
Obwohl Rilke im Dezember 1907 voll Freude zu Rodin zurückgekehrt war, ließ sich das alte herzliche Verhältnis von Meister und Schüler nicht mehr herstellen. Der innere Grund ist wohl darin zu sehen, daß Rilke von Rodin trotz vielen schmerzlichen Erfahrungen all das für sein jetziges und späteres Schaffen empfangen hatte, was unumgänglich notwendig gewesen war. Mehr konnte er nicht für sich erhalten. So lockerte sich die Bindung von Jahr zu Jahr, obwohl die ehrfurchtsvolle Freundsdiaft Rilkes nach außen hin keinen Bruch mehr erlitt bis zum Jahre 1912, da Rodin den Dichter ein zweites und letztes Mal in unverständlicher Weise vor den Kopf stieß. In diesem Jahr hatte er der Gattin Rilkes, seiner früheren Schülerin also, versprochen, für ein Porträt, das für das Museum in Mannheim geschaffen werden sollte, zu sitzen. Er versprach und sagte ab. Das ging ein ganzes Jahr hindurch, schließlich weigerte er sich in brutaler Weise, die Bitte zu erfüllen. Trotz allem suchte der Dichter den großen Meister noch .einmal zu verstehen. Er hatte Einsicht mit dem Alter des Bildhauers. Bald danach hören die Briefe
auf. Der Krieg machte dem Verhältnis ein Ende. 1914 erkannte der Dichter in einem Brief an Lou Andreas Salome abschließend: „Es fällt mir nicht ein, daß eine geistige Aneignung der Welt, wo sie sich so völlig des Auges bedient, wie das bei mir der Fall war, dem bildenden Künstler ungefährlicher bliebe, weil sie sich greifbarer an körperlichen Ergebnissen beruhigt.“ Er wußte nun endlich um die Unvereinbarkeit der körper-
lichen Arbeit des bildenden Künstlers, des Bildhauers besonders, mit der rein geistigen und sich nur im Geist vorbereitenden schöpferisdien Tätigkeit des Dichters.
Aus der Rückschau sieht man heute mehr denn je, daß das Erlebnis Rodin im Mittelpunkt von des Dichters Leben und Schaffen gestanden hat und sowohl erziehungsmäßig wie formgebend daraus nicht mehr wegzudenken ist.