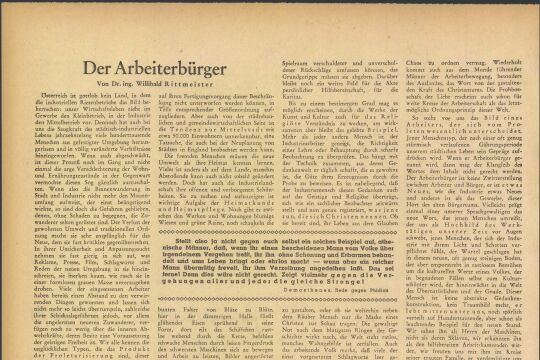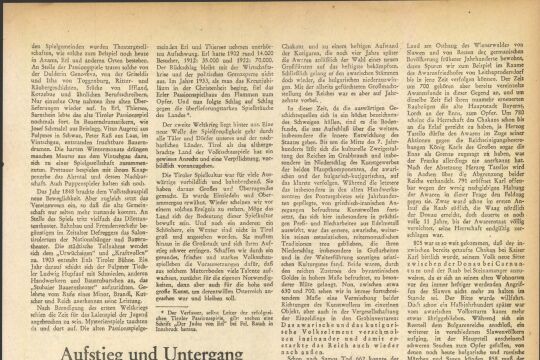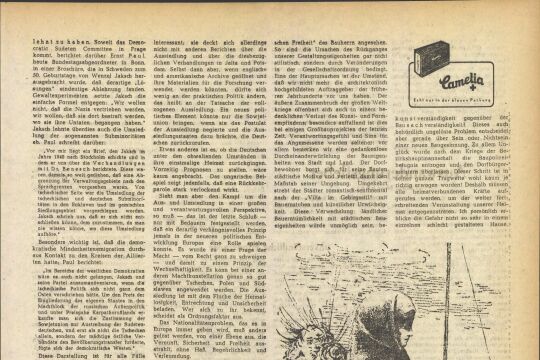Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schönheit technischer Werkanlagen
Als der vorzeitliche Mensch des Lebens in völlig freier Natur oder in Höhlen müde geworden war und sich — so primitiv das auch ausgesehen haben mochte — eine Hütte errichtete, eine Wohnstätte, stellte er diesen seinen ersten „technischen Bau“ in eine bisher völlig unberührte Landschaft hinein. Zweifellos wurde dadurch das Bild jener Landschaft in keiner Weise gestört, auch war damals noch kein Äuge so geschult, einen allfälligen Mißklang zu sehen, kein Geist so kritisch, über die Wahrnehmung tiefgründig urteilen zu können.
Seither sind viele Jahrtausende hingegangen und die Menschheit hat durch ihren Fortschritt im Bau-, im Handwerk-, im Verkehrs- und in manch anderem Wesen in all der Zeit ständig und ununterbrochen das Gesicht der Landschaft ihres Lebensraumes verändert, sie hat ihr sozusagen den Stempel der eigenen Art aufgedrückt: mit jedem Hausbau, mit jedem geschaffenen Weg, mit jeder Straße, die sie anlegte, mit jedem Wälderlichten, jedem Wassergraben, jedem Sägewerk, jeder Mühle, mit jeder Kapelle und Kirche, die da erstanden. Der Mensch wies zu allen Zeiten mit Stolz und mit verständlicher Freude an seinem Werk auf solche von ihm geschaffene Veränderungen. Sie waren, hatte sie der Mensch einmal geschaffen, für ihn nicht abgetan, sondern sie verbanden den Menschen mit der umgebenden Landschaft (Heimatgefühl) noch inniger.
Ja, es ist so, daß ein Abbild unberührter Natur (und sollte es aus der Hand eines hervorragenden Meisters stammen), abgesehen von der künstlerischen Reife, mit der es geschaffen wurde, wohl sehr schön sein kann und daß es uns im Innersten berührt, daß sich tber diese Wirkung vervielfältigt, sobald nur irgend etwas auf dem Bilde sichtbar ist, das mehr als die unberührte Natur bietet. Und sei dieses „Irgend-etwas“ vielleicht auch nur ein Saumpfad,
der ahnen läßt, daß jene Landschaft zuweilen von Menschen durchschritten wird: schon stellt unser Geist Beziehungen her zwischen der Gegend und uns Menschen, und just das ist es, was in uns das Gefühl des Schönen, des Verbindenden, des Künstlerischen an diesem Bild verstärkt.
Unsere Altvorderen haben es aus einem natürlichen Empfinden für das Schöne ausgezeichnet verstanden, alle ihre Bauwerke der Landschaft harmonisch einzufügen. Aber selbst dort, wo Bauten entstanden (etwa die Tempel- und Aquäduktbauten der Antike), die dem innersten Empfinden nach nicht als „schön“ im eigentlichen Sinn des Wortes bezeichnet werden können (zumal sie sich uns heutigen Betrachtern nur noch als Ruinen darbieten), läßt ein besonderer Umstand dennoch in uns das Gefühl aufwachsen, sie seien trotz alledem schön: es ist die große Zeitspanne, es sind die Jahrhunderte und Jahrtausende, die uns von der „damaligen Gegenwart“ trennen und die uns in einer Art Traditionsverbundenheit den Sinn für geschichtliche Größe in ein Gefühl ummünzen, das uns sogar noch, die Ruinen als „schön" erscheinen läßt.
Durch das raschere Leben der Welt, durch das Hasten und Jagen, das vor rund hundert Jahren deutlich spürbar einsetzte und sich sprunghaft steigerte und noch weiter steigert, haben wir manch wertvolles Lebensgefühl verloren und wir sind darob im Herzen leerer und freudloser geworden. Unter dem, was uns beinahe verlorenging, befand sich auch das sinnvolle Bauenkönnen, das harmonische Sich- einfügen des Bauwerks in die Landschaft. Man war daran, alles einzig und allein und ohne jede andere Rücksichtnahme dem Zweck zu opfern.
Aber noch inmitten dieses Niederbruches, der sich über Jahrzehnte hinzog, erkannte man dennoch, daß nicht der Zweck allein maßgebend ist, sondern daß die Uebereinstimmung, die Hrrmonie des Ganzen mit dabei sein müsse. Man erinnerte sich des „Goldenen Schnittes“ ebenso wie manch anderer natürlicher Schönheitsgesetze und mancher Unwägbarkeiten, die man vorher kurzerhand als schon für immer abgetan glaubte. Und man begann, insbesondere beim Bau industrieller Anlagen, beim Bau von Bahnhöfen, Brücken, großen öffentlichen Gebäuden usw., diese Gesetze wieder zu pflegen. Ja, man ist nun endlich auch daran, selbst den Miethäusern, die oft genug nichts als üble „Mietkasernen“ waren. Linienführungen und Maße zu geben, die das Auge des Beschauers und sein künstlerisches Empfinden, wenn schon nicht erfreuen und nicht aufjubeln lassen, so doch nicht mehr derart kraß beleidigen, wie es bisher oft genug der Fall war.
Besonderes Augenmerk muß bei all jenen Bauten aufgewendet werden, die weitgehend in bisher noch wenig berührte Naturgegenden eingreifen, also etwa bei Kraftwerkbauten an Gebirgsflüssen oder an Seen. Aber auch auf diesem Gebiete ist es gottlob so. daß sich Energiewirtschafter und Wasserbauspezialisten, Techniker, Architekten und Landschaftsplaner in oft jahrelangen Untersuchungen des gesamten Gebietes über die Vorbedingungen unterrichten, die zu erfüllen sind, um sinn- und zweckvoll bauen zu können. Sie tauschen dann nicht nur untereinander ihre Erfahrungen aus und stimmen diese aufeinander ab. sondern sie finden sich auch mit Biologen. Botanikern, Aerzten, Vertretern des Heimat- und Naturschutzes usw. zu gemeinsamen Beratungen zusammen, aus deren Ergebnissen dann ein allen Erfordernissen gerecht werdendes Werk entsteht. Just auf dem Gebiet der Wasserkraftwirtschaft wird dies in unserer Heimat mit Nachdruck so betrieben. Durch solche Zusammenarbeit aller beteiligten Faktoren erhielt z. B. gerade Oesterreich verschiedene Wasserkraftwerke (und der Bau weiterer, ebenso vorsichtig geplanter Werke ist noch vorgesehen), die nicht nur vortrefflich ihren volkswirtschaftlichen, arbeitschaftenden Zweck erfüllen, ohne die Natur oder sonst jemand zu schädigen, sondern die darüber hinaus in ihrem baulichen und konstruktiven Teil so gestaltet sind, daß sie sich harmonisch in die Landschaft ein- fügen, sie nicht stören und nicht „zerreißen", wodurch sie im weitesten Sinn des Wortes „schön" wirken. Unser Bild zeigt als Beispiel landschaftsverbundenen und naturschützenden Bauens die Ranna- Staumauer der OKA (Oberösterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft) mit dem künstlich geschaffenen, etwa 4 km langen Ranna-See.
Darauf zu dringen, daß diese Tendenz, den künstlerisch schönen und ausgeglichenen Bau zu schaffen, sich noch verstärkter durchsetzt, ist wohl Pflicht aller an Kunst, Kultur und Heimatpflege interessierter Kreise. Wir können uns ein Leben ohne Technik nicht mehr vorstellen, wir können das Rad der Entwicklung nicht zurückdrehen. Wir können aber — wenn wir es wollen! — das den Menschen in-’ ’ wohnende natürliche Schönheitsempfinden, d s uns das Persönlichkeitsgefühl schenkt und uns hilft, den Begriff „Kultur“ zu formen, mit den technischen Erfordernissen so übereinstimmen, daß daraus statt einer an allem Menschentum bisher vielfach geübten ständigen und entnervenden Zerreißprobe ein stetesf natürliches, kräftemehrendes Einanderfinden und somit eine Sammlung zum erfolgbringenden Fortschritt in die Zukunft wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!