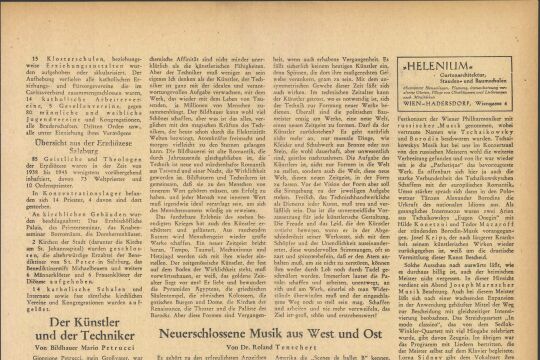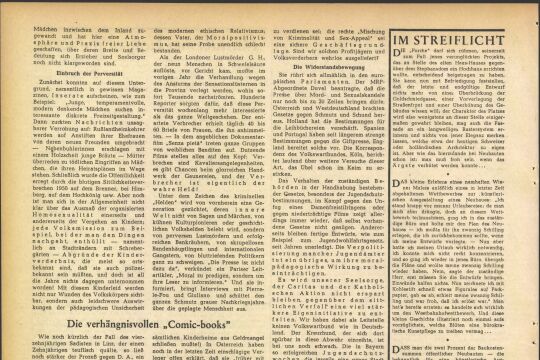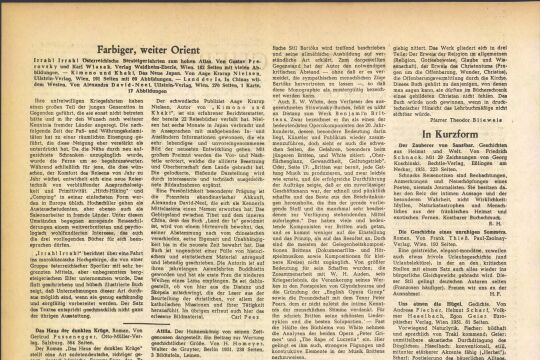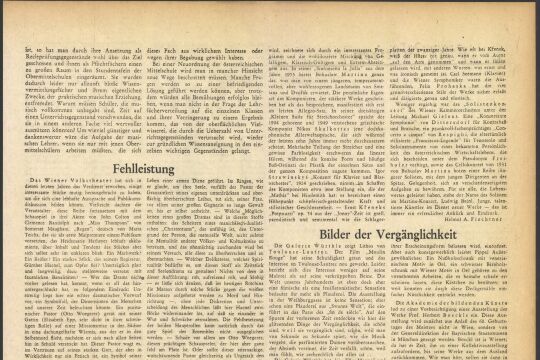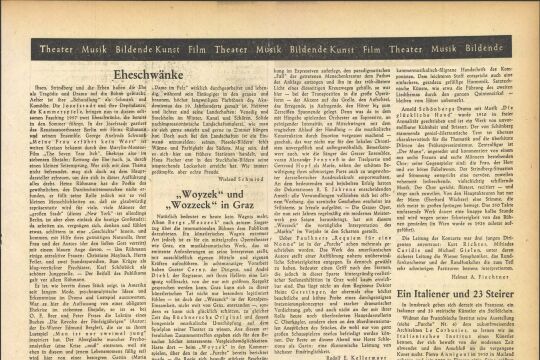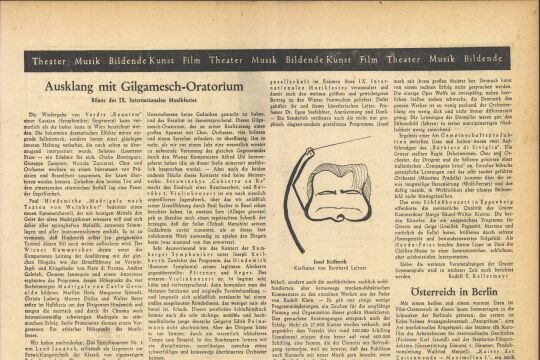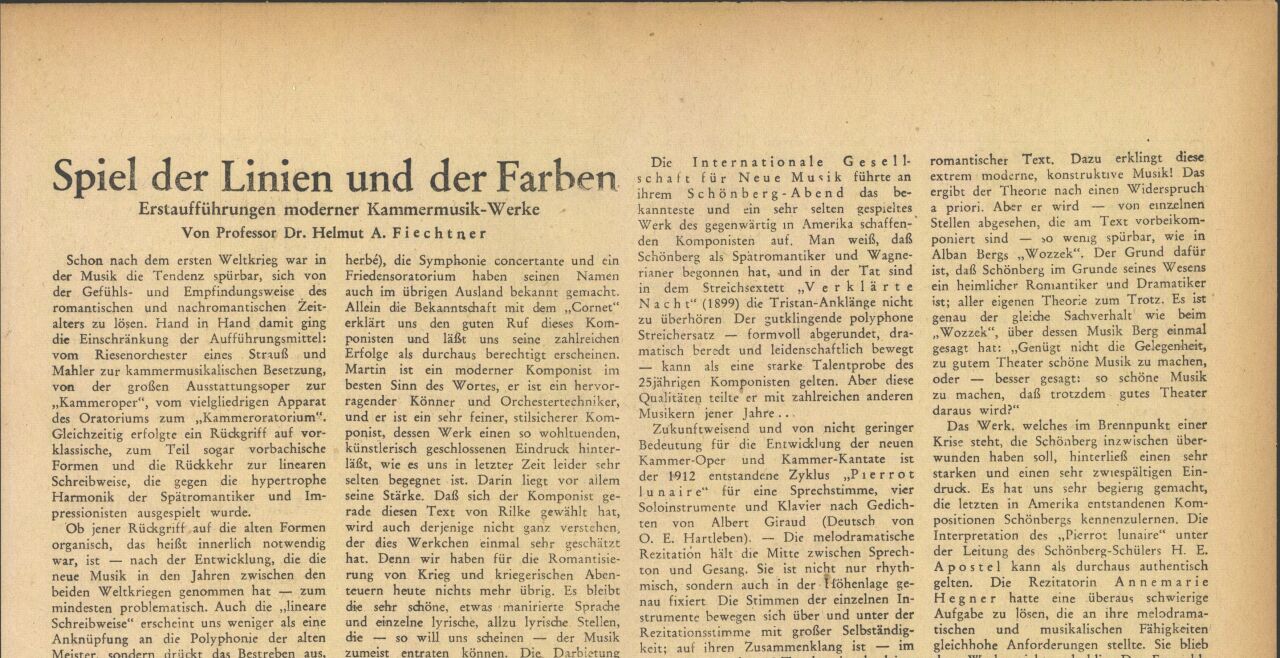
Schon nach dem ersten Weltkrieg war in der Musik die Tendenz spürbar, sich von der Gefühls- und Empfindungsweise des romantischen und nachromantischen Zeitalters zu lösen. Hand in Hand damit ging die Einschränkung der Aufführungsmittel: vom Riesenorchester eines Strauß und Mahler zur kammermusikalischen Besetzung, von der großen Ausstattungsoper zur „Kammeroper“, vom vielgliedrigen Apparat des Oratoriums zum „Kammeroratorium“. Gleichzeitig erfolgte ein Rückgriff auf vorklassische, zum Teil sogar vorbachische Formen und die Rückkehr zur linearen Schreibweise, die gegen die hypertrophe Harmonik der Spätromantiker und Impressionisten ausgespielt wurde.
Ob jener Rückgriff auf die alten Formen organisch, das heißt innerlich notwendig war, ist — nach der Entwicklung, die die neue Musik in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen genommen hat — zum mindesten problematisch. Auch die „lineare Schreibweise“ erscheint uns weniger als eine Anknüpfung an die Polyphonie der alten Meister, sondern drückt das Bestreben aus, jede Stimme zum Träger unmittelbaren Gefühlsausdruckes zu machen und gleichsam tönende Gefühlslinien zu schaffen. Daß das Ohr aber, sobald mehr als zwei (höchstens drei) Stimmen erklingen, mehr deren Zusammenklang, also die Harmonie, erfaßt und nicht mehr deren Einzelbewegung zu folgen vermag, sei nur nebenbei vermerkt. Der „lineare“ Komponist verzichtet also entweder auf den harmonischen Zusammenklang — und nimmt die schwerwiegenden Folgen eines solch-n Verzichts auf sich —, oder aber er macht Kompromisse Dann ist die Frage berechtigt: Wozu ein Prinzip auf seine Fahnen schreiben, dem man auf Schritt und Tritt zuwiderhandeln muß?
All: diese Vorgänge und Neuerungen sind, in ihrer Gesamtheit, nur auf dem Hintergrund sehr breiter und tiefgreifender Vorgänge, also kulturpsychologisch, zu verstehen. Damals, in den zwanziger Jahren, war die Reaktion auf die „alte“ Musik heftiger, die Programme der Neutöner kompromißloser. Daß die Träger jener neuen Gedanken nicht nur Querköpfe und Querulanten waren, erhellt daraus, daß ihre Ideen auch heute noch — oder wieder — wirksam sind und daß eine ganze Reihe ihrer Wer';e auch heut noch gültig ist. Denn — und das sei über allen kunsttheoretischen Debifen nie vergessen —: es kommt immer und überall auf die schöpferische Persönlichkeit, in zweiter Linie erst auf Theorien und Kunst.besetze an!
Als positives Ergebnis jener Neuerungen und Anregungen ist geblieben- die Abkehr vom romantischen Schwulst jeder Art (vom Riesenorchester und einer schwelgerischen Harmonik) und die Hinwendung zur kleinen Besetzung, zu klaren und übersichtlichen Formen.
Besonders deutlich wurden die Tendenzen der neuen Musik in einem Konzert des Schweizer Dirigenten Paul Sacher, der zwei interessante neue Werke zur Wiener Erstaufführung brachte: die „M -1 a m o r-p hosen“ “des 82jährigen Richard Strauß und „Der C o r n e t“, eine Kammerkantate des Schweize- Komponisten Frank Martin (geb. 1890). Das im vergangenen Jahr komponierte Werk von Richard Strauß, eine Studie für 23 Solostreicher, war eine Überraschung und — eine Enttäuschung. Alles andere war zu erwarten, nur nicht, daß Strauß in einem Alterswerk bei Beethoven anknüpfen würde, und zwar nicht nur thematisch; ebenso überraschten uns die Anklänge an das Tannhäuser-Vorspiel in den Ecksätzen des sechsteiligen, ohne Unterbrechung gespielten Werkes. Enttäuscht wurde mancher vielleicht dadurch, daß das Werk die reichen polyphonen Möglichkeiten von 23 Solostreichern kaum ausnützt, sich in den Adagio-Teilen mit einem fast schulmäßigen (allerdings sehr schön klingenden) Satz begnügt und im bewegten Mittelteil orchestral Effekte anstrebt, die kein Streicherkörper zu verwirklichen vermag. Die Hinwendung zur kammermusikalischen Form entbehrt also der inneren Notwendigkeit. Doch sei auch diese späte Blüte dankbar empf mgen, entspringt sie doch einem Stamm, der so schöne und verschiedenartige Früchte getragen hat.
Frank Martin ist einer der erfolgreichsten Schweizer Komponisten der mittleren Generation. Eine Tristan-Kantate (Le vin herbe), die Symphonie concertante und ein Friedensoratorium haben seinen Namen auch im übrigen Ausland bekannt gemacht. Allein die Bekanntschaft mit dem „Cornet“ erklärt uns den guten Ruf dieses Komponisten und läßt uns seine zahlreichen Erfolge als durchaus berechtigt erscheinen. Martin ist ein moderner Komponist im besten Sinn des Wortes, er ist ein hervorragender Könner und Orchestertechniker, und er ist ein sehr feiner, stilsicherer Komponist, dessen Werk einen so wohltuenden, künstlerisch geschlossenen Eindruck hinterläßt, wie es uns in letzter Zeit leider sehr selten begegnet ist. Darin liegt vor ailem seine Stärke. Daß sich der Komponist gerade diesen Text von Rilke gewählt hat, wird auch derjenige nicht ganz verstehen, der dies Werkchen einmal sehr geschätzt hat. Denn wir haben für die Romantisierung von Krieg und kriegerischen Abenteuern heute nichts mehr übrig. Es bleibt die sehr schöne, etwas nianirierte Sprache und einzelne lyrische, allzu lyrische Stellen, die — so will uns scheinen — der Musik zumeist entraten können. Die. Darbietung durch die Solistin Elisabeth Höngen und die Wiener Philharmoniker war mustergültig; die beiden Aufführungen hint-rließen einen geschlossenen Gesamt- 1 e'ndruck.
Im zweiten Kammerkonzert des Collegium musicam wurden drei vorklassische Werke (Corelli. Vivaldi und Porpora), die unter der Leitung von Kurt Rapf auber und stilvoll musiziert wurden, drei modernen Kompositionen gegenübergestellt. Mit seiner Vierten Symphonie für zehn Streichinstrumente (1921) hat es sich Darius Milhaud sehr leicht gemacht. Das ganze Werk dauert sechs Minuten und umfaßt drei Miniatursätze: „Ouvertüre“ in Form einer kontrapunktischen Studie, „Choral“, gregorianisch stilisiert, und eine Fugato-„EtudT“'. Was der Komponist angestrebt hat uni demon-srieren wollte, ist klar. Was er mit diesem Werkchen geschaffen hat, mag man als zeit-und entwicklungsgeschichtliches Kunosum zur Kenntnis nehmen. Der Rückgriff auf die kleine Besetzung und die alten Formen bleibt ein rein äußerlicher.
Paul Angerers „Annexus musicae cum r a t i o n e“, op. 2C (1941 komponiert), ist ein dreisätzieps Werk für Klavier zu vier Händen. Gute thematisch Einfälle, ein gediegenes s itvr rchnische? Können und stilistische Gesiilosseriheit zeichnen auch dieses Werk des junsen Komponisten aus, auf dessen Schaffen in der „Furche“ bereits hingewiesen wurde. Der Durchbruch aus der Gefühlswelt der Romantik und des Impressionismus scheint in diesem Werk organisch und gültig vollzogen zu sein. Um aber zu einem Eigenstil zu gelangen, um den Weg freizulegen, muß sich Angerer unbedingt von der Gregoria-nik lösen — so bedeutsam und anregend sie für ihn gewesen sein mag. In Anton und Erna Heiller hatte der Komponist ideale Interpreten, die das schwierige Werk mit Hingabe und schönem Eifer den Zuhörern vermittelten.
Ein im besten Sinn des Wortes „modernes“ Werk nach Haltung, Gehalt und Besetzung ist die „B a 11 a d e“ für Flöte. Streichorchester und Klavier (1941) von Frank Martin, dem Komponisten des „Cornet“. Die Sparsamkeit und richtige Wahl der Darstellungsmittel, die klare Form und die eigentümlich-reizvolle Melodik und Harmonik machen aus Martins „Ballade“ (die vielleicht besser „Pastorale“ heißen sollte) eines der erfre-iüchsten Kammermusikwerke, die wir während der letzten Monate hören durften . . . Martin soll mit der 12-Tontechnik angefangen, haben; aber in diesem Werk ist nicht mehr viel davon zu spüren Seiner Musik haftet nichts Doktrinäres an Mit der Harmonik schaltet er frei, versteht es aber meisterhaft, dissonante Härten durch aparte Instrumentierung zu mildern. Darin äußert sich wohl auch d.e soziablere Natur des Halbromanen. Mit leichter und wählerischer Hand fügt Martin seinem Werk auch einige moderne Tanzrhythmen ein. die det Komposition eine sehr aparte Note ver leihen. Mit der Auswahl dieses Werkes hat das Collegium musicum einen iehr glücklichen Griff getan. Hans Reznicek war der Solist, der seinen nicht nur brillanten, sondern auch gehaltvollen Part mit Verständnis und guter Technik meisterte.
Die Internationale Gesellschaft für Neue Musik führte an ihrem Schönberg-Abend das bekannteste und ein sehr selten gespieltes Werk des gegenwärtig in Amerika schaffenden Komponisten auf. Man weiß, daß Schönberg als Spätromantiker und Wagnerianer begonnen hat, und in der Tat sind in dem Streichsextett „Verklärte Nach t“ (1899) die Tristan-Anklänge nicht zu überhören Der gutklingende polyphone Streichersatz — formvoll abgerundet, dramatisch beredt und leidenschaftlich bewegt — kann als eine srarke Talentprobe des 25jährigen Komponisten gelten. Aber diese Qualitäten teilte er mit zahlreichen anderen Musikern jener Jahre .. .
Zükunftweisend und von nicht geringer Bedeutung für die Entwicklung der neuen Kammer-Oper und Kammer-Kantate ist der 1912 entstandene Zyklus „Pierrot 1 u n a i r e“ für eine Sprechstimme, vier Soloinstrumente und Klavier nach Gedichten von Albert Giraud (Deutsch von O. E. Hartleben). — Die melodramatische Rezitation hält die Mitte zwischen Sprechton und Gesang. Sie ist nicht nur rhythmisch, sondern auch in der Höhenlage genau fixiert Die Stimmen der einzelnen Instrumente bewegen sich über und unter der Rezitationsstimme mit großer Selbständigkeit; auf ihren Zusammenklang ist — im Sinne der aus der 12-Tontheorie abgeleiteten atonaler Harmonik und nach den Gesetzen des linearen Kontrapunkts — kaum Rücksicht genommen. Der Text stammt aus der Sphäre Baudelaires. Rimbauds und Verlaines — also: ein symbolistischer, neuromantischer Text. Dazu erklingt diese extrem moderne, konstruktive Musik! Das ergibt der Theorie nach einen Widerspruch a priori. Aber er wird — von einzelnen Stellen abgesehen, die am Text vorbeikomponiert sind — so wenig spürbar, wie in Alban Bergs „Wozzek“. Der Grund dafür ist, daß Schönberg im Grunde seines Wesens ein heimlicher Romantiker und Dramatiker ist; aller eigenen Theorie zum Trotz. Es ist genau der gleiche Sachverhalt wie beim „Wozzek“, über dessen Musik Berg einmal gesagt hat: „Genügt nicht die Gelegenheit, zu gutem Theater schöne Musik zu machen, oder — besser gesagt: so schöne Musik zu machen, daß trotzdem gutes Theater daraus wird?“
Das Werk, welches im Brennpunkt einer Krise steht, die Schönberg inzwischen überwunden haben soll, hinterließ einen sehr starken und einen sehr zwiespältigen Eindruck. Es hat uns sehr begierig gemacht, die letzten in Amerika entstandenen Kompositionen Schönbergs kennenzulernen. Die Interpretation des „Pierrot lunaire“ unter der Leitung des Schönberg-Schülers H. E. Apostel kann als durchaus authentisch gelten. Die Rezitatorin Annemarie H e g n e r hatte eine überaus schwierige Aufgabe zu lösen, die an ihre melodramatischen und musikalischen Fähigkeiten gleichhohe Anforderungen stellte. Sie blieb dem Werke nichts schuldig. Das Ensemble beider Werke bestand aus Musikern, die diese schwere und — vom Standpunkt des Virtuosen — undankbare Musik mit jener selbstlosen Hingabe spielten, die den wahren Künstler, den idealen Interpreten ausmacht.