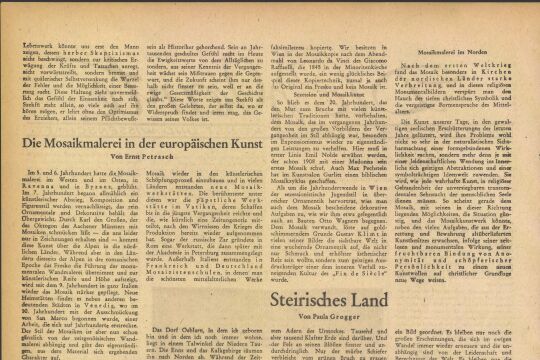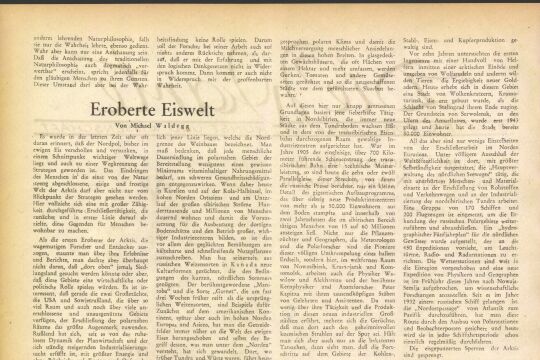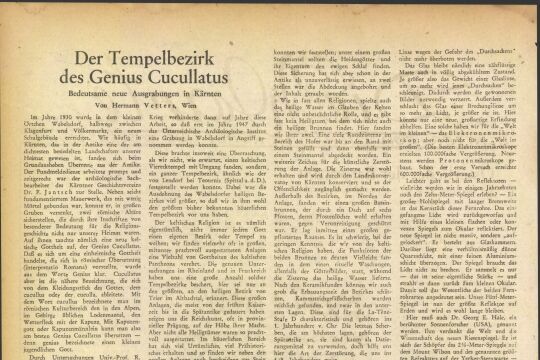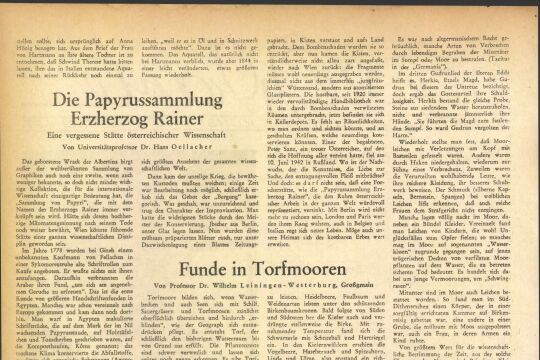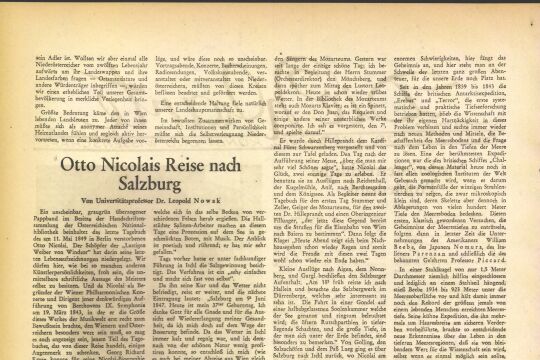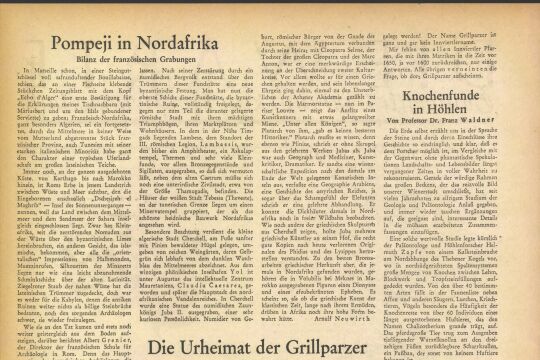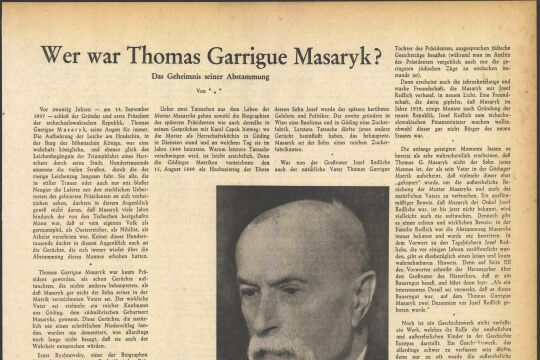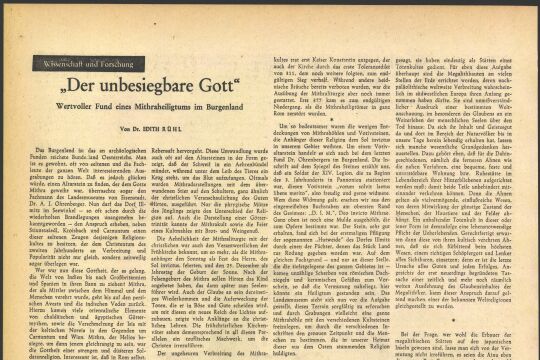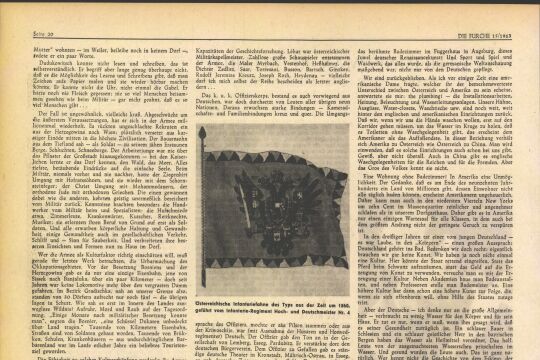Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Umweltsünden schon im Altertum
Als in den sechziger Jahren das öffentliche Bewußtsein die verheerenden Auswirkungen unserer Zivilisation auf die Ökologie der Erde wahrzunehmen begann, wurde ein Begriff modern: Umweltkrise. Aber ihre Wurzeln reichen weit zurück, Fragen zum Thema Harmonie zwischen Mensch und Natur sind schon viel früher gestellt worden.
Gern wird aus der Genesis jene Stelle zitiert, in der Gott zum neu erschaffenen Menschen sagt: „Füllet die Erde und machet sie euch Untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.” Tatsächlich hatdie christliche Religion keine nennenswerte umweltschützerische Wirkung entfaltet.
Doch es baute in Umweltfragen auf Gedankengut der Antike auf. Und dort (wenn nicht sogar in urgeschichtlichen Zeiten) liegen die Wurzeln unserer Umweltkrise.
So kannte schon das Altertum Über-fischung und Überjagen. Ersteres betraf etwa den Stör, letzteres den damals noch in Europa verbreiteten Löwen. Auch über die regionale Ausrottung von Elefanten und Nilpferden, die in den römischen Arenen für Tierhetzen eingesetzt wurden, berichten antike Autoren. Der Fang von Singvögeln war in Athen und Rom sehr beliebt. Mit Leimruten und unter Mithilfe geblendeter Lockvögel wurde den fliegenden Leckerbissen nachgestellt. Schonzeiten oder Futterkrippen waren weitgehend unbekannt. Und Plinius der Ältere schildert in seiner „naturalis historia”, daß die Rotbarbe, ein beliebter Speisefisch, lebend gekocht werde, weil sie dabei ein reizvolles Farbenspiel zeige.
Günther E. Thüry beleuchtet in seinem Buch „Die Wurzeln unserer Umweltkrise und die griechisch-römische Antike” das antike Mensch - Umwelt-Verhältnis aus dem Blickwinkel der Klassischen Altertumswissenschaften. Bestechend ist die Fülle an Details und die große Zahl ausgewerteter Quellen. Jedem, dem am Verstehen der heutigen Umweltmisere gelegen ist, kann dieses Buch empfohlen werden. Schade, daß es nicht umfangreicher geworden ist.
Zwar sei die Waldarmut der Mittelmeerländer nicht als Folge der antiken Waldrodungen zu sehen (sie ist dem neuzeitlichen Baubbau anzulasten). Doch beschreibt bereits Piaton Erosion und Überschwemmungen im Zuge großflächiger Waldvernichtung. Der Bedarf an Holz für den Haus- und Schiffsbau, besonders aber für Feuerzwecke, war groß, systematische Wiederaufforstungen kannte die Antike kaum. Verbiß durch Ziegen und Schafe tat ein übriges.
Das antike Herrschaftsdenken über die Natur, so Thüry, äußerte sich auch in der Faszination durch technische Errungenschaften. Ein Beispiel frühgriechischer Ingenieurkunst ist der nach seinem Erbauer benannte Eupalinos-Tunnel auf Samos. Um die Hauptstadt mit frischem Quellwasser zu versorgen, wurde ein über 1000. Meter langer Tunnel quer durch einen Berg getrieben. Noch viel mehr setzten die Römer auf Technik. Sie überzogen das Land mit einem gewaltigen Straßennetz. Dabei nahmen sie auf das Gelände wenig Bücksicht. Möglichst schnurgerade zogen sich die Wege durch die Lande, Brücken und Tunnel kamen hinzu. Bäche und Flüsse wurden kanalisiert, Stauseen angelegt, Dämme errichtet, Kanäle, Wasserleitungen und Hafenanlagen erbaut. Für den römischen Limes wurden vielerorts breite Schneisen in den Wald geschlagen. Bis heute haben diese Verteidigungswälle deutliche Spuren in der Landschaft hinterlassen. Und der Siedlungsbau stieg so an, daß schon antike Schriftsteller von einer Zersiedelung der Flußtäler, Seeufer und Küsten sprechen.
Äcker und Weiden fraßen immer mehr Naturlandschaft, fremde Tiere und Pflanzen wurden eingebürgert. Plinius berichtet, daß eine als Heil-und Küchenpflanze sehr geschätzte Art durch Übernutzung verschwand und das angeblich letzte Exemplar Kaiser Nero überbracht wurde.
Bedeutend war auch die Verschmutzung der Natur durch Abfälle und Emissionen. Noch heute ist in Ostia, dem antiken Frachthafen Borns, der 35 Meter hohe „Scherbenberg” zu sehen, der gänzlich aus Tonscherben besteht. Die Beste zerbrochener Amphoren wurden so endgelagert. Privater Abfall wurde auch in den Häusern deponiert, im Keller, oder, noch einfacher, durch Eintreten in den Lehmfußboden. Flüssigen Unrat leerte man aus Fenster oder Tür auf die Straße. Zwar gab es bereits Kanalisation, etwa die Cloaca Maxima in der Innenstadt Borns, aber es gab sie nicht überall. Jedenfalls beklagt schon Plinius die vom Abwasser verschmutzten, stinkenden Flüsse.
Daß antike Eingriffe in die Natur bis heute nachwirken können, sogar weit entfernt vom Ursprungsort, zeigt die hohe Bleibelastung in den Sedimenten südschwedischer Seen. Durch die frühen Bergbau- und Verhüttungsarbeiten erhöhte sich der Bleigehalt in der Atmosphäre stark. Durch den Wind wurden die Luftverschmutzungen hunderte Kilometer weit vertragen.
Dem Wunsch nach Naturbeherrschung standen jedoch drei geistige Einstellungen entgegen, die eine totale Ausbeutung der Natur zumindest bremsten. Zum einen war es die Naturliebe des antiken Menschen, die sich in vielfältiger Weise äußerte. Beispielsweise in Gestalt der Tierliebe. Heim- und Schoßtiere gehörten schon früh zum Alltagsleben. Besonders Vögel, Hunde und Pferde wurden sehr geschätzt. In Loig bei Salzburg entdeckte man ein römisches Pferdegrab. Das Tier muß über 30 Jahre alt geworden sein, was nur einer intensiven Pflege zu verdanken gewesen sein kann. Plutarch spricht sogar von der „moralische(n) Pflicht für einen anständigen Menschen, Pferde und Hunde auch im Alter zu pflegen”.
Auch die Liebe zu Pflanzen war allgegenwärtig. Bei Gelagen regnete es Blumen, bei kultischen Zeremonien wurden Kränze aus Blüten und Blättern getragen. Es gab in Born Blumenläden und Gärtnereien. Öffentliche und private Parkanlagen und Ziergärten erfreuten sich großer Beliebtheit, ebenso das Picknick im Freien oder in natürlichen und künstlichen Grotten. Der Zweitwohnsitz am Land war bei den wohlhabenden Stadtbewohnern Borns „in”.
Wildtiere blieben von der Zuneigung ausgeschlossen. Auch die Liebe zur Landschaft war auf die von Menschenhand veränderte beschränkt. Eine umgestaltete Landschaft galt als Gewinn für die Schönheit der Welt. Das Ideal verkörperte die Kulturlandschaft. Technische Bauten wurden als Naturververbesserung interpretiert.
Ein zweites Element der Gegensteuerung war die Naturfurcht. Dichte Wälder und deren Bewohner wie Bären, Wölfe und Wildschweine wurden gefürchtet. Ebenso Sümpfe und reißende Gewässer, hohe Gebirge und die rauhe See. Groß war die Angst vor den Naturgewalten. Unzugängliche Gebiete wurden als alleiniger Aufenthaltsort der Naturgottheiten und dem Menschen verbotene Zonen betrachtet. Mond- und Sonnenfinsternisse, Unwetter, Erdbeben oder Vulkanausbrüche deutete der antike Mensch als Anzeichen für Störungen des Verhältnisses zwischen den Menschen und den Göttern. Durch Gebete, Opfer, Gelübde und Weihegeschenke warb man um Vergebung und Schutz.
Damit ist indirekt die dritte Komponente angesprochen, die übermäßige Ausbeutung verhinderte: die Verehrung des Göttlichen in der Natur. In der Antike galt die gesamte Natur als von göttlichen Wesen beseelt. So bewohnten oder verkörperten Nymphen Bäume, Wiesen, Berge und Grotten, Flußgötter waren* für Gewässer zuständig. Tacitus berichtet, daß ein vom Senat diskutiertes Flußregulierungsprogramm nicht ausgeführt wurde, weil die Gewässer religiöse Verehrung genossen.
Für geweihte Bezirke wurden strenge Schutzbestimmungen erlassen. In heiligen Hainen durfte kein Baum geschlagen, kein Müll abgeladen, kein Wasser verschmutzt werden. Sogar Verbotstafeln wurden aufgestellt. Durch geeignete Darstellungen konnte auch der Analphabet erkennen, was verboten war und wie die Götter auf einen Umweltfrevel reagieren würden, beispielsweise mit todbringenden Blitzen.
Entschloß man sich dennoch zu Eingriffen in die Natur, gab es Ausgleichsmaßnahmen, um die Götter und wohl auch das eigene Gewissen zu beruhigen. So weihte zur Entsühnung der stellvertretende Gouverneur Pannoniens anläßlich einer Bachregulierung in Cetium, dem heutigen St. Pölten, dem Gott Neptun einen Altar.
Eine andere Methode war es, technische Errungenschaften weniger ihren menschlichen Erfindern oder Erbauern zuzuschreiben, als vielmehr bestimmten Gottheiten. So wurden die Straßen Wegegottheiten geweiht, Brunnen, Brücken, Aquädukte erhielten ihre zugehörigen Nymphen. Und schließlich half die Vorstellung, daß von Menschen veränderte Umwelt schöner und besser sei als ihr Natur gebliebenes Gegenstück.
Freilich war die religiöse Hemmschwelle nicht absolut. Der dem Apoll heilige Schwan wurde mit tierquäleri-schen Methoden gemästet. Die von Gottheiten bewohnten Flüsse verwendete man dennoch als Müllschlucker, etwa den Tiber in Born.
Umweltfragen waren also auch in der Antike ein Thema. Die Gesellschaft war in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite die Naturschützer, die (zum Teil religiös motiviert) in den menschlichen Natureingriffen nichts Gutes erblicken konnten. Auf der anderen bedenkenlose Naturbenützer, die bisweilen sogar euphorisch den Sieg der Zivilisation und der Technik über die Natur feierten. Herrschaftsdenken gegenüber der Natur als geistige Voraussetzung der Umweltkrise ist also ein altes Phänomen, das der antike Mensch aber durch gegenläufige Einstellungen bremste. Heute stellen viele den Herrschaftsanspruch der Menschheit gegenüber der Natur wieder in Frage.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!